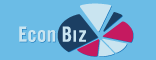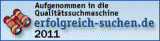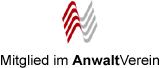- -> zur Mobil-Ansicht
- Arbeitsrecht aktuell
- Tipps und Tricks
- Handbuch Arbeitsrecht
- Gesetze zum Arbeitsrecht
- Urteile zum Arbeitsrecht
- Urteile 2023
- Urteile 2021
- Urteile 2020
- Urteile 2019
- Urteile 2018
- Urteile 2017
- Urteile 2016
- Urteile 2015
- Urteile 2014
- Urteile 2013
- Urteile 2012
- Urteile 2011
- Urteile 2010
- Urteile 2009
- Urteile 2008
- Urteile 2007
- Urteile 2006
- Urteile 2005
- Urteile 2004
- Urteile 2003
- Urteile 2002
- Urteile 2001
- Urteile 2000
- Urteile 1999
- Urteile 1998
- Urteile 1997
- Urteile 1996
- Urteile 1995
- Urteile 1994
- Urteile 1993
- Urteile 1992
- Urteile 1991
- Urteile bis 1990
- Arbeitsrecht Muster
- Videos
- Impressum-Generator
- Webinare zum Arbeitsrecht
-
Kanzlei Berlin
 030 - 26 39 62 0
030 - 26 39 62 0
 berlin@hensche.de
berlin@hensche.de
AnfahrtDetails -
Kanzlei Frankfurt
 069 - 71 03 30 04
069 - 71 03 30 04
 frankfurt@hensche.de
frankfurt@hensche.de
AnfahrtDetails -
Kanzlei Hamburg
 040 - 69 20 68 04
040 - 69 20 68 04
 hamburg@hensche.de
hamburg@hensche.de
AnfahrtDetails -
Kanzlei Hannover
 0511 - 89 97 701
0511 - 89 97 701
 hannover@hensche.de
hannover@hensche.de
AnfahrtDetails -
Kanzlei Köln
 0221 - 70 90 718
0221 - 70 90 718
 koeln@hensche.de
koeln@hensche.de
AnfahrtDetails -
Kanzlei München
 089 - 21 56 88 63
089 - 21 56 88 63
 muenchen@hensche.de
muenchen@hensche.de
AnfahrtDetails -
Kanzlei Nürnberg
 0911 - 95 33 207
0911 - 95 33 207
 nuernberg@hensche.de
nuernberg@hensche.de
AnfahrtDetails -
Kanzlei Stuttgart
 0711 - 47 09 710
0711 - 47 09 710
 stuttgart@hensche.de
stuttgart@hensche.de
AnfahrtDetails
BVerfG, Beschluss vom 29.09.2016, 2 BvR 1549/07
| Schlagworte: | Massenentlassung, Konsultationsverfahren | |
| Gericht: | Bundesverfassungsgericht | |
| Aktenzeichen: | 2 BvR 1549/07 | |
| Typ: | Beschluss | |
| Entscheidungsdatum: | 29.09.2016 | |
| Leitsätze: | ||
| Vorinstanzen: | Bundesarbeitsgericht, Urteil vom 01.02.2007, 2 AZR 15/06 | |
BUNDESVERFASSUNGSGERICHT
- 2 BvR 1549/07 -
IM NAMEN DES VOLKES
In dem Verfahren
über
die Verfassungsbeschwerde
des Herrn J…
- Bevollmächtigte:
1.Prof. Dr. Dr. h.c. Götz Frank, Cäcilienplatz 4, 26122 Oldenburg,
2.Prof. Dr. Dagmar Schiek, University of Leeds School of Law, 20 Lyddon Terrace, Leeds LS2 9JT, Großbritannien -
gegen
das Urteil des Bundesarbeitsgerichts
vom 1. Februar 2007 - 2 AZR 15/06 -
hat die 3. Kammer des Zweiten Senats des Bundesverfassungsgerichts durch
die Richter Huber,
Müller,
Maidowski
am 10. Dezember 2014 einstimmig beschlossen:
Das Urteil des Bundesarbeitsgerichts vom 1. Februar 2007 - 2 AZR 15/06 - verletzt den Beschwerdeführer in seinem grundrechtsgleichen Recht aus Artikel 101 Absatz 1 Satz 2 des Grundgesetzes.
Das Urteil wird aufgehoben.
Die Sache wird an das Bundesarbeitsgericht zurückverwiesen.
Die Bundesrepublik Deutschland hat dem Beschwerdeführer seine notwendigen Auslagen zu erstatten.
G r ü n d e :
Die Verfassungsbeschwerde betrifft unter anderem Fragen der Vorlagepflicht zum Gerichtshof der Europäischen Union (im Folgenden: Gerichtshof).
I.
1. Der Beschwerdeführer war seit 4. Januar 1993 bei der Beklagten des ar-beitsgerichtlichen Ausgangsverfahrens, die eine Großbäckerei betrieb, als Produktionshelfer beschäftigt. Im August 2004 beschloss die Beklagte des Ausgangsverfahrens, die eigene Herstellung von Backwaren zum 1. April 2005 einzustellen. Sie kündigte deshalb das Arbeitsverhältnis mit dem Beschwerdeführer mit Schreiben vom 18. November 2004 zum 31. März 2005. Mit Schreiben vom 25. Januar 2005 zeigte die Beklagte des Ausgangsverfahrens die Entlassung von 16 ihrer 65 Mitarbeiter gemäß § 17 des Kündigungsschutzgesetzes (KSchG) bei der Bundes-agentur für Arbeit an. Diese stimmte den von der Beklagten angezeigten Entlassungen mit Bescheid vom 15. Februar 2005 zu.
Der Beschwerdeführer erhob Kündigungsschutzklage zum Arbeitsgericht Hamburg, die er unter anderem damit begründete, dass die Beklagte gegen §§ 17, 18 KSchG in Verbindung mit Art. 2 f. der Richtlinie 98/59/EG des Rates vom 20. Juli 1998 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über Massenentlassungen (ABl Nr. L 225/16; im Folgenden: Massenentlassungsrichtlinie) verstoßen habe, indem sie den Konsultations- und Informationspflichten gemäß Art. 2 bis Art. 4 Massenentlassungsrichtlinie nicht vor Zugang des Kündigungsschreibens beim Beschwerdeführer entsprochen habe.
§ 17 KSchG lautet auszugsweise:
(1) 1Der Arbeitgeber ist verpflichtet, der Agentur für Arbeit Anzeige zu erstatten, bevor er
1. […]
2. in Betrieben mit in der Regel mindestens 60 und weniger als 500 Arbeitnehmern 10 vom Hundert der im Betrieb regelmäßig beschäftigten Arbeitnehmer oder aber mehr als 25 Arbeitnehmer,
3. […]
innerhalb von 30 Kalendertagen entlässt. [...]
(2) 1Beabsichtigt der Arbeitgeber, nach Absatz 1 anzeigepflichtige Entlassungen vorzunehmen, hat er dem Betriebsrat rechtzeitig die zweckdienlichen Auskünfte zu erteilen und ihn schriftlich insbesondere zu unterrichten über […].
§ 18 KSchG lautet auszugsweise:
(1) Entlassungen, die nach § 17 anzuzeigen sind, werden vor Ablauf eines Monats nach Eingang der Anzeige bei der Agentur für Arbeit nur mit deren Zustimmung wirksam; […].
Art. 2 bis Art. 4 Massenentlassungsrichtlinie lauten auszugsweise:
Artikel 2
(1) Beabsichtigt ein Arbeitgeber, Massenentlassungen vorzunehmen, so hat er die Arbeitnehmervertreter rechtzeitig zu konsultieren, um zu einer Einigung zu gelangen.
(2) Diese Konsultationen erstrecken sich zumindest auf die Möglichkeit, Massenentlassungen zu vermeiden oder zu beschränken, sowie auf die Möglichkeit, ihre Folgen durch soziale Begleitmaßnahmen, die insbesondere Hilfen für eine anderweitige Verwendung oder Umschulung der entlassenen Arbeitnehmer zum Ziel haben, zu mildern.
Artikel 3
(1) Der Arbeitgeber hat der zuständigen Behörde alle beabsichtigten Massenentlassungen schriftlich anzuzeigen.
Artikel 4
(1) Die der zuständigen Behörde angezeigten beabsichtigten Massenentlassungen werden frühestens 30 Tage nach Eingang der in Artikel 3 Absatz 1 genannten Anzeige wirksam; […].
(2) Die Frist des Absatzes 1 muss von der zuständigen Behörde dazu benutzt werden, nach Lösungen für die durch die beabsichtigten Massenentlassungen aufgeworfenen Probleme zu suchen.
2. Das Bundesarbeitsgericht hatte seit 1973 (vgl. BAG, Urteil vom 6. Dezember 1973 - 2 AZR 10/73 -, NJW 1974, S. 1263 f.) in ständiger Rechtsprechung die Auffassung vertreten, dass unter „Entlassung“ im Sinne der §§ 17, 18 KSchG nicht die Kündigungserklärung, sondern die mit ihr beabsichtigte tatsächliche Beendigung des Arbeitsverhältnisses zu verstehen sei (vgl. BAG, Urteile vom 24. Februar 2005 - 2 AZR 207/04 -, NZA 2005, S. 766 <767>; vom 13. April 2000 - 2 AZR 215/99 -, NZA 2001, S. 144 <145>; zuletzt grundlegend BAG, Urteil vom 18. September 2003 - 2 AZR 79/02 -, NZA 2004, S. 375 <379 ff.>). Die Anzeige einer Massenentlassung musste daher nicht vor dem Ausspruch der Kündigung erfolgen (vgl. BAG, Urteil vom 24. Oktober 1996 - 2 AZR 895/95 -, NJW 1997, S. 2131 <2132>). Das Bundesarbeitsgericht hatte zudem betont, dass eine möglicherweise gebotene richtlinienkonforme Interpretation des Begriffs „Entlassung“ als „Kündigungserklärung“ im Hinblick auf die Massenentlassungsrichtlinie, die unter anderem durch die Regelungen der §§ 17 f. KSchG umgesetzt werden soll (vgl. BTDrucks 13/668, S. 9; siehe auch Kiel, in: Erfurter Kommentar zum Arbeitsrecht, 14. Aufl. 2014, § 17 KSchG, Rn. 1), nicht zulässig sei (vgl. BAG, Urteil vom 18. September 2003 - 2 AZR 79/02 -, NZA 2004, S. 375 <381 f.>).
3. Mit Urteil vom 27. Januar 2005 entschied der Gerichtshof der Europäischen Union in der Rechtssache Junk (EuGH, Urteil vom 27. Januar 2005, Junk, C-188/03, Slg. 2005, I-885) im Rahmen eines vom Arbeitsgericht Berlin beantragten Vorabentscheidungsverfahrens zur Auslegung der Art. 1 bis Art. 4 Massenentlassungsrichtlinie (vgl. ArbG Berlin, Vorlagebeschluss vom 30. April 2003 - 36 Ca 19726/02 -, juris), dass die Kündigungserklärung des Arbeitgebers das Ereignis sei, das als Entlassung gelte, und dass der Arbeitgeber Massenentlassungen (erst) nach Ende des Konsultationsverfahrens nach Art. 2 Massenentlassungsrichtlinie und nach der Anzeige der beabsichtigten Massenentlassung im Sinne der Art. 3 und Art. 4 Massenentlassungsrichtlinie vornehmen dürfe (vgl. EuGH, Urteil vom 27. Januar 2005, Junk, C-188/03, Slg. 2005, I-885, Rn. 39 ff.).
4. Das Arbeitsgericht Hamburg wies die Kündigungsschutzklage des Beschwerdeführers mit Urteil vom 25. Mai 2005 ab (Az. 13 Ca 375/04).
5. Die dagegen eingelegte Berufung des Beschwerdeführers wies das Landesarbeitsgericht Hamburg mit Urteil vom 25. November 2005 zurück (Az. 6 Sa 82/05).
6. Mit angegriffenem Urteil vom 1. Februar 2007 wies das Bundesarbeitsgericht die Revision des Beschwerdeführers zurück (Az. 2 AZR 15/06), da die Kündigung nicht wegen Verstoßes gegen § 17 Abs. 1 Satz 1 KSchG rechtsunwirksam sei. Zwar wäre die beklagte Arbeitgeberin nach dieser Norm verpflichtet gewesen, die Massenentlassung vor Ausspruch der Kündigung bei der Bundesagentur für Arbeit anzuzeigen, weil unter „Entlassung“ im Sinne von § 17 Abs. 1 Satz 1 KSchG - wie der Senat in seiner Entscheidung vom 23. März 2006 im Verfahren 2 AZR 343/05 unter Aufgabe seiner früheren Rechtsprechung angenommen habe - der Ausspruch der Kündigung zu verstehen sei. Der Unwirksamkeit der Kündigung stehe jedoch der Grundsatz des Vertrauensschutzes entgegen. Die hierfür maßgeblichen Grundsätze seien bereits im Urteil vom 23. März 2006 dargelegt worden.
Das Bundesarbeitsgericht führte insofern aus, dass Gerichte aufgrund ihrer Bindung an das Rechtsstaatsprinzip bei Änderung ihrer Rechtsprechung, nicht anders als bei Gesetzesänderungen der Gesetzgeber, den Grundsatz des Vertrauensschutzes beachten müssten. Deshalb dürfe eine Rechtsprechungsänderung regelmäßig nicht dazu führen, einer Partei rückwirkend Handlungspflichten aufzuerlegen, die sie nachträglich nicht mehr erfüllen könne. Zwar wirke die Änderung einer auch lange geltenden höchstrichterlichen Rechtsprechung grundsätzlich zurück, soweit dem nicht der Grundsatz von Treu und Glauben entgegenstehe; eine über § 242 BGB hinausgehende Einschränkung der Rückwirkung sei aber geboten, wenn die von der Rückwirkung der Rechtsprechung betroffene Partei auf die Fortgeltung der bisherigen höchstrichterlichen Rechtsprechung habe vertrauen dürfen und die Anwendung der geänderten Auffassung wegen ihrer Rechtsfolgen im Streitfall oder der Wirkung auf andere vergleichbare Rechtsbeziehungen auch unter Berücksichtigung der berechtigten Interessen des Prozessgegners eine unzumutbare Härte bedeuten würde. Eine solche Situation sei hier gegeben.
Dem Senat sei die Entscheidung über den Vertrauensschutz auch nicht „entzogen”. Insbesondere sei er nicht zur Vorlage an den Gerichtshof der Europäischen Union verpflichtet (unter Zitierung von Schiek, AuR 2006, S. 41 <43 f.>), weil er lediglich seine eigene Rechtsprechung und die Auslegung der nationalen Regelungen des Kündigungsschutzgesetzes an das Gemeinschaftsrecht angepasst habe. Indem er den Begriff der „Entlassung” zukünftig im Sinne der vom Gerichtshof entwickelten Auslegung der Richtlinie verstanden wissen wolle, habe er kein Gemeinschaftsrecht ausgelegt, sondern lediglich das nationale Kündigungsschutzrecht „richtlinienkonform” angewandt. Das sei eine Frage der nationalen Rechtsanwendung.
II.
Der Beschwerdeführer sieht sich durch das Urteil des Bundesarbeitsgerichts in seinem grundrechtsgleichen Recht aus Art. 101 Abs. 1 Satz 2 GG sowie in seinen Grundrechten aus Art. 19 Abs. 4 GG beziehungsweise Art. 2 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 20 Abs. 3 GG und Art. 12 GG verletzt.
Eine Verletzung seines Rechts aus Art. 101 Abs. 1 Satz 2 GG liege insbesondere darin, dass das Bundesarbeitsgericht in seinem Urteil vom 1. Februar 2007 die zeitliche Wirkung der Junk -Entscheidung beziehungsweise das unionsrechtliche Gebot der richtlinienkonformen Auslegung derjenigen Rechtsnormen, die die Massenentlassungsrichtlinie umsetzten, unter Berufung auf Vertrauensschutz nach nationalem Recht auf die Zeit nach dem 27. Januar 2005 beschränkt habe, ohne den Gerichtshof der Europäischen Union zuvor mit der Frage nach der Zulässigkeit der zeitlichen Beschränkung der Junk -Entscheidung zu befassen. Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs sei die Entscheidung über die zeitliche Wirkung seiner Entscheidungen jedoch ihm selbst vorbehalten.
Dem Bundesverfassungsgericht lagen die Akten des Ausgangsverfahrens vor. Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales, das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz und die Beklagte des Ausgangsverfahrens hatten Gelegenheit zur Stellungnahme.
III.
Die Verfassungsbeschwerde ist zur Entscheidung anzunehmen, weil dies zur Durchsetzung des grundrechtsgleichen Rechts des Beschwerdeführers aus Art. 101 Abs. 1 Satz 2 GG angezeigt ist (§ 93a Abs. 2 Buchstabe b BVerfGG). Der Verfassungsbeschwerde ist durch die Kammer stattzugeben, da die maßgeblichen verfassungsrechtlichen Fragen durch das Bundesverfassungsgericht bereits entschieden sind und die zulässige Verfassungsbeschwerde offensichtlich begründet ist (§ 93b Satz 1 i.V.m. mit § 93c Abs. 1 Satz 1 BVerfGG). Das angegriffene Urteil des Bundesarbeitsarbeitsgerichts verletzt das grundrechtsgleiche Recht des Beschwerdeführers auf den gesetzlichen Richter (Art. 101 Abs. 1 Satz 2 GG). Das Bundesarbeitsgericht hat unter Berufung auf den Grundsatz des Vertrauensschutzes auf der Grundlage seiner früheren Auslegung der §§ 17 f. KSchG über die Revision des Beschwerdeführers entschieden, ohne sich zuvor gemäß Art. 267 Abs. 1 und Abs. 3 AEUV an den Gerichtshof der Europäischen Union zu wenden und die Frage klären zu lassen, ob die Gewährung von Vertrauensschutz mit der unionsrechtlichen Pflicht zur richtlinienkonformen Auslegung nationalen Rechts (Art. 288 Abs. 3 AEUV und Art. 4 Abs. 3 EUV) und die damit einhergehende Beschränkung der Wirkung der Junk -Entscheidung mit dem Unionsrecht vereinbar sind.
1. Der Gerichtshof der Europäischen Union ist gesetzlicher Richter im Sinne von Art. 101 Abs. 1 Satz 2 GG (vgl. BVerfGE 73, 339 <366 ff.>; 75, 223 <233>; 82, 159 <192>; 126, 286 <315>; 128, 157 <186 f.>; 129, 78 <105>). Unter den Voraussetzungen des Art. 267 Abs. 3 AEUV sind die nationalen Gerichte von Amts wegen gehalten, den Gerichtshof anzurufen (vgl. BVerfGE 82, 159 <192 f.>; 128, 157 <187>; 129, 78 <105>; stRspr). Kommt ein deutsches Gericht seiner Pflicht zur Anrufung des Gerichtshofs im Wege des Vorabentscheidungsverfahrens nicht nach, kann dem Rechtsschutzsuchenden des Ausgangsrechtsstreits der gesetzliche Richter entzogen sein (vgl. BVerfGE 73, 339 <366 ff.>; 126, 286 <315>; zuletzt ausführlich BVerfG, Urteil vom 28. Januar 2014 - 2 BvR 1561/12, 2 BvR 1562/12, 2 BvR 1563/12, 2 BvR 1564/12 -, NVwZ 2014, S. 646 <657>).
a) Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union (vgl. EuGH, Urteil vom 6. Oktober 1982, CILFIT, 283/81, Slg. 1982, 3415, Rn. 21) muss ein nationales letztinstanzliches Gericht seiner Vorlagepflicht gemäß Art. 267 Abs. 3 AEUV nachkommen, wenn sich in einem bei ihm schwebenden Verfahren eine Frage des Unionsrechts stellt, es sei denn, das Gericht hat festgestellt, dass die gestellte Frage nicht entscheidungserheblich ist, dass die betreffende unionsrechtliche Bestimmung bereits Gegenstand einer Auslegung durch den Gerichtshof war oder dass die richtige Anwendung des Unionsrechts derart offenkundig ist, dass für vernünftigen Zweifel keinerlei Raum bleibt (vgl. zuletzt BVerfG, Urteil vom 28. Januar 2014 - 2 BvR 1561/12, 2 BvR 1562/12, 2 BvR 1563/12, 2 BvR 1564/12 -, NVwZ 2014, S. 646 <657>).
b) Das Bundesverfassungsgericht beanstandet die Auslegung und Anwendung von Normen, die die gerichtliche Zuständigkeitsverteilung regeln, jedoch nur, wenn sie bei verständiger Würdigung der das Grundgesetz bestimmenden Gedanken nicht mehr verständlich erscheinen und offensichtlich unhaltbar sind. Durch die grundrechtsähnliche Gewährleistung des Art. 101 Abs. 1 Satz 2 GG wird es nicht zu einem Kontrollorgan, das jeden die Zuständigkeit eines Gerichts berührenden Verfahrensfehler korrigieren müsste; vielmehr ist das Bundesverfassungsgericht gehalten, seinerseits die Kompetenzregeln zu beachten, die den Fachgerichten die Kontrolle über die Befolgung der Zuständigkeitsordnung übertragen.
Diese Grundsätze gelten auch für die unionsrechtliche Zuständigkeitsvorschrift des Art. 267 Abs. 3 AEUV. Das Bundesverfassungsgericht überprüft daher nur, ob die Auslegung und Anwendung der Zuständigkeitsregel des Art. 267 Abs. 3 AEUV bei verständiger Würdigung der das Grundgesetz bestimmenden Gedanken nicht mehr verständlich erscheint und offensichtlich unhaltbar ist. Durch die zurückgenommene verfassungsrechtliche Prüfung behalten die Fachgerichte bei der Auslegung und Anwendung von Unionsrecht einen Spielraum eigener Einschätzung und Beurteilung, der demjenigen bei der Handhabung einfachrechtlicher Bestimmungen der deutschen Rechtsordnung entspricht. Das Bundesverfassungsgericht wacht allein über die Einhaltung der Grenzen dieses Spielraums. Ein „oberstes Vorlagenkontrollgericht“ ist es nicht (vgl. BVerfGE 82, 159 <194>; 126, 286 <315 f.>; 128, 157 <187>; 129, 78 <106>; BVerfG, Urteil vom 28. Januar 2014 - 2 BvR 1561/12, 2 BvR 1562/12, 2 BvR 1563/12, 2 BvR 1564/12 -, NVwZ 2014, S. 646 <657>).
Das Bundesverfassungsgericht hat die Anforderungen des Art. 101 Abs. 1 Satz 2 GG hinsichtlich der Vorlagepflicht gemäß Art. 267 Abs. 3 AEUV anhand beispielhafter Fallgruppen näher präzisiert.
aa) Danach wird die Vorlagepflicht nach Art. 267 Abs. 3 AEUV in den Fällen offensichtlich unhaltbar gehandhabt, in denen ein letztinstanzliches Hauptsachegericht eine Vorlage trotz der - seiner Auffassung nach bestehenden - Entscheidungserheblichkeit einer unionsrechtlichen Frage überhaupt nicht in Erwägung zieht, obwohl es selbst Zweifel hinsichtlich der richtigen Beantwortung der Frage hegt und das Unionsrecht somit eigenständig fortbildet (grundsätzliche Verkennung der Vorlagepflicht; vgl. BVerfGE 82, 159 <195 f.>; 126, 286 <316 f.>; 128, 157 <187 f.>; 129, 78 <106 f.>; BVerfG, Urteil vom 28. Januar 2014 - 2 BvR 1561/12, 2 BvR 1562/12, 2 BvR 1563/12, 2 BvR 1564/12 -, NVwZ 2014, S. 646 <657>).
Dies gilt erst recht, wenn sich das Gericht hinsichtlich des (materiellen) Unionsrechts nicht hinreichend kundig macht. Es verkennt dann regelmäßig die Bedingungen für die Vorlagepflicht (vgl. BVerfGK 8, 401 <405>; BVerfG, Beschlüsse der 3. Kammer des Ersten Senats vom 14. Mai 2007 - 1 BvR 2036/05 -, NVwZ 2007, S. 942 <945>; vom 20. Februar 2008 - 1 BvR 2722/06 -, NVwZ 2008, S. 780 <781>; vom 25. Februar 2010 - 1 BvR 230/09 -, NJW 2010, S. 1268 <1269>). Gleiches gilt, wenn es offenkundig einschlägige Rechtsprechung des Gerichtshofs nicht auswertet. Um eine Kontrolle am Maßstab des Art. 101 Abs. 1 Satz 2 GG zu ermöglichen, hat es die Gründe für seine Entscheidung über die Vorlagepflicht anzugeben.
bb) Die Frage nach dem Bestehen einer Vorlagepflicht gemäß Art. 267 Abs. 3 AEUV wird auch dann in nicht mehr verständlicher und offensichtlich unhaltbarer Weise beantwortet, wenn ein letztinstanzliches Hauptsachegericht in seiner Entscheidung bewusst von der Rechtsprechung des Gerichtshofs zu entscheidungserheblichen Fragen abweicht und gleichwohl nicht oder nicht neuerlich vorlegt (bewusstes Abweichen ohne Vorlagebereitschaft; vgl. BVerfGE 82, 159 <195 f.>; 126, 286 <316 f.>; 128, 157 <187 f.>; 129, 78 <106 f.>).
cc) Liegt zu einer entscheidungserheblichen Frage des Unionsrechts einschlägige Rechtsprechung des Gerichtshofs noch nicht vor oder hat eine vorliegende Rechtsprechung die entscheidungserhebliche Frage möglicherweise noch nicht erschöpfend beantwortet oder erscheint eine Fortentwicklung der Rechtsprechung des Gerichtshofs nicht nur als entfernte Möglichkeit (Unvollständigkeit der Rechtsprechung), wird Art. 101 Abs. 1 Satz 2 GG verletzt, wenn das letztinstanzliche Hauptsachegericht den ihm in solchen Fällen notwendig zukommenden Beurteilungsrahmen in unvertretbarer Weise überschreitet (vgl. BVerfGE 82, 159 <195 f.>; 126, 286 <316 f.>; 128, 157 <187 f.>; 129, 78 <106 f.>). Dies ist jedenfalls dann der Fall, wenn das Fachgericht das Vorliegen eines „acte clair“ oder eines „acte éclairé“ willkürlich bejaht.
c) Zu den wesentlichen Elementen des Rechtsstaatsprinzips zählt die Rechtssicherheit. Der rechtsunterworfene Bürger soll nicht durch die rückwirkende Beseitigung erworbener Rechte in seinem Vertrauen auf die Verlässlichkeit der Rechtsordnung enttäuscht werden (vgl. BVerfGE 45, 142 <167>; 72, 175 <196>; 88, 384 <403>; 105, 48 <57>; 126, 286 <313>).
Das Vertrauen in den Fortbestand eines Gesetzes kann auch durch die rückwirkende Feststellung seiner Nichtanwendbarkeit berührt werden. Die Schutzwürdigkeit des Vertrauens in ein unionsrechtswidriges Gesetz bestimmt sich insbesondere danach, inwieweit vorhersehbar war, dass der Gerichtshof eine derartige Regelung als unionsrechtswidrig einordnet. Es ist ferner von Belang, dass eine Disposition im Vertrauen auf eine bestimmte Rechtslage vorgenommen, das Vertrauen mit anderen Worten betätigt wurde (vgl. BVerfGE 13, 261 <271>; 126, 286 <313 f.>).
aa) Art. 267 AEUV spricht dem Gerichtshof der Europäischen Union die grundsätzlich abschließende Entscheidungsbefugnis über die Auslegung der Verträge und über die Gültigkeit und die Auslegung der dort genannten Handlungen von Stellen der Union zu (vgl. BVerfGE 52, 187 <200>; 73, 339 <368>; 75, 223 <234>). Im Fall von Auslegungsentscheidungen erläutert er allgemein, in welchem Sinn und mit welcher Tragweite die vorgelegte Vorschrift seit ihrem Inkrafttreten richtigerweise zu verstehen und anzuwenden ist beziehungsweise gewesen wäre (vgl. EuGH, Urteil vom 27. März 1980, Denkavit italiana, 61/79, Slg. 1980, 1205, Rn. 16; vgl. auch BVerfGE 126, 286 <304>). Daraus folgt, dass die nationalen Gerichte die Unionsvorschrift in dieser Auslegung (grundsätzlich) auch auf andere Rechtsverhältnisse als das dem Vorabentscheidungsersuchen zugrundeliegende anwenden können und müssen, und zwar auch auf solche, die vor Erlass der auf das Auslegungsersuchen ergangenen Entscheidung des Gerichtshofs entstanden sind (vgl. BVerfGE 126, 286 <314>; vgl. auch EuGH, Urteil vom 27. März 1980, Denkavit italiana, 61/79, Slg. 1980, 1205, Rn. 16; BAG, Urteil vom 24. März 2009 - 9 AZR 983/07 -, NZA 2009, S. 538 <542>). Dies dient den Zielen der Verträge über die Europäische Union, der Rechtssicherheit und der Rechtsanwendungsgleichheit sowie einer einheitlichen Auslegung und Anwendung des Unionsrechts (vgl. BVerfGE 52, 187 <200>; 75, 223 <234>).
Aus dem Erfordernis der einheitlichen Anwendung des Unionsrechts folgt auch, dass es Sache des Gerichtshofs ist, darüber zu entscheiden, ob - entgegen der grundsätzlichen ex-tunc-Wirkung von Entscheidungen gemäß Art. 267 AEUV (vgl. BVerfGE 126, 286 <314>; so auch Ludewig, Die zeitliche Beschränkung der Wirkung von Urteilen des EuGH im Vorabentscheidungsverfahren, S. 64 u. 88; Waldhoff, Rückwirkung von EuGH-Entscheidungen, S. 4 u. 33) - aufgrund der unionsrechtlichen Grundsätze der Rechtssicherheit und des Vertrauensschutzes die Geltung der von ihm vorgenommenen Auslegung einer Norm in zeitlicher Hinsicht ausnahmsweise eingeschränkt werden soll (vgl. BVerfGE 126, 286 <314>). Eine solche Einschränkung der Wirkung einer Vorabentscheidung aus Gründen des unionsrechtlichen allgemeinen Rechtsgrundsatzes des Vertrauensschutzes (vgl. Wissmann, Vertrauensschutz - europäisch und deutsch, Festschrift für Jobst-Hubertus Bauer, S. 1161 <1163 f.>) muss - wegen des Erfordernisses der einheitlichen Anwendung des Unionsrechts - nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs in dem (ersten) Urteil selbst enthalten sein, durch das über die Auslegungsfrage entschieden wird (vgl. EuGH, Urteil vom 27. März 1980, Denkavit italiana, 61/79, Slg. 1980, 1205, Rn. 17 f. unter Verweis auf EuGH, Urteil vom 8. April 1976, Defrenne, 43/75, Slg. 1976, 455, Rn. 74/75).
bb) Die Möglichkeiten der nationalen Gerichte zur Gewährung von Vertrauensschutz sind somit unionsrechtlich vorgeprägt und begrenzt. Die Auslegung des Unionsrechts durch den Gerichtshof ist von ihnen auch auf Rechtsverhältnisse anzuwenden, die vor Erlass der Vorabentscheidung begründet wurden. Vertrauensschutz kann von nationalen Gerichten demnach grundsätzlich nicht dadurch gewährt werden, dass sie die Wirkung einer Vorabentscheidung zeitlich beschränken, indem sie die unionsrechtswidrige nationale Regelung für die Zeit vor Erlass der Vorabentscheidung anwenden (vgl. BVerfGE 126, 286 <314>).
d) Richtlinien können im Verhältnis zwischen Privaten mangels horizontaler Wirkung allerdings auch nach einer Auslegungsentscheidung des Gerichtshofs gemäß Art. 267 AEUV grundsätzlich nicht selbst Verpflichtungen für einen Bürger begründen und nicht gegenüber einem Bürger in Anspruch genommen werden (vgl. EuGH, Urteile vom 26. Februar 1986, Marshall, 152/84, Slg. 1986, 723, Rn. 48; vom 11. Juni 1987, Pretore di Salò, 14/86, Slg. 1987, 2545, Rn. 19; vom 5. Oktober 2004, Pfeiffer, C-397/01, Slg. 2004, I-8835, Rn. 109; stRspr); im Verhältnis zwischen Privaten können sie (in der Regel) nur im Wege richtlinienkonformer Auslegung nationaler Vorschriften angewandt werden.
aa) Auch trifft der Gerichtshof im Vorabentscheidungsverfahren über die Auslegung einer Richtlinie grundsätzlich keine Entscheidung über die Auslegung des nationalen Rechts (vgl. BVerfGE 52, 187 <201> unter Verweis auf EuGH, Urteil vom 3. Februar 1977, Benedetti, 52/76, Slg. 1977, 163, Rn. 25; BVerfGK 19, 89 <100>; vgl. auch EuGH, Urteile vom 4. Juli 2006, Adeneler, C-212/04, Slg. 2006, I-6057, Rn. 103; vom 23. April 2009, Angelidaki, C-378/07 bis 380/07, Slg. 2009, I-3071, Rn. 163). Gemäß Art. 288 Abs. 3 AEUV obliegt es vielmehr den Mitgliedstaaten und im Rahmen ihrer Zuständigkeiten den nationalen Gerichten, das in der Richtlinie vorgesehene Ziel zu verwirklichen. Dabei sind sie gemäß Art. 4 Abs. 3 EUV verpflichtet, alle ihnen zur Verfügung stehenden geeigneten Maßnahmen zur Erfüllung dieser Verpflichtung zu treffen (vgl. u.a. EuGH, Urteile vom 10. April 1984, 14/83, von Colson und Kamann, Slg. 1984, 1891, Rn. 26; vom 18. Dezember 1997, Inter-Environnement Wallonie, C-129/96, Slg. 1997, I-7411, Rn. 40; vom 15. April 2008, Impact, C-268/06, Slg. 2008, I-2483, Rn. 41 u. 85). Den nationalen Gerichten obliegt es, den Rechtsschutz zu gewährleisten, der sich für den Einzelnen aus den unionsrechtlichen Bestimmungen ergibt, und dabei die volle Wirksamkeit des Unionsrechts sicherzustellen. Bei der Anwendung des innerstaatlichen Rechts, insbesondere einer speziell zur Umsetzung einer Richtlinie erlassenen Norm, müssen sie das innerstaatliche Recht daher so weit wie möglich anhand des Wortlauts und des Zwecks der Richtlinie auslegen, um der Verpflichtung aus Art. 288 Abs. 3 AEUV nachzukommen (vgl. in diesem Sinne u. a. Urteile des EuGH vom 10. April 1984, von Colson und Kamann, 14/83, Slg. 1984, 1891, Rn. 26; vom 15. Januar 2014, Association de médiation sociale, C-176/12, Slg. 2014, I-0000, Rn. 38 m.w.N.).
bb) Die auch aus dem Grundsatz der Unionstreue (Art. 4 Abs. 3 EUV) folgende Verpflichtung der Gerichte, diejenige Auslegung des nationalen Rechts zu wählen, die dem Inhalt der Richtlinie (in der vom Gerichtshof entschiedenen Auslegung) entspricht (vgl. BVerfGE 75, 233 <237>), findet ihre Grenzen in dem nach der innerstaatlichen Rechtstradition methodisch Erlaubten. Das nationale Gericht ist insoweit nur verpflichtet, innerstaatliches Recht „soweit wie möglich“ anhand des Wortlauts und des Zwecks der Richtlinie auszulegen und dabei seine Zuständigkeit nicht zu überschreiten (vgl. EuGH, Urteile vom 10. April 1984, 14/83, von Colson und Kamann, Slg. 1984, 1891, Rn. 26; vom 5. Oktober 2004, C-397/01, Pfeiffer, Slg. 2004, I-8835, Rn. 113 ff.; stRspr). Überdies hat der Gerichtshof - auch bezogen auf arbeitsrechtliche Regelungen des Unionsrechts - anerkannt, dass die Pflicht zur richtlinienkonformen Auslegung in den allgemeinen Rechtsgrundsätzen, insbesondere im Grundsatz der Rechtssicherheit und im Rückwirkungsverbot, ihre Schranken findet und nicht als Grundlage für eine Auslegung des nationalen Rechts contra legem dienen kann (vgl. EuGH, Urteile vom 8. Oktober 1987, Kolpinghuis Nijmegen, 80/86, Slg. 1987, 3969, Rn. 13; vom 4. Juli 2006, Adeneler, C-212/04, Slg. 2006, I-6057, Rn. 110; vom 15. April 2008, Impact, C-268/06, Slg. 2008, I-2483, Rn. 100; vom 23. April 2009, Angelidaki, C-378/07 bis 380/07, Slg. 2009, I-3071, Rn. 199; vom 16. Juli 2009, Mono Car Styling, C-12/08, Slg. 2009, I-6653, Rn. 61; vom 15. Januar 2014, Association de médiation sociale, C-176/12, Slg. 2014, I-0000, Rn. 39). Ob und inwieweit das innerstaatliche Recht eine entsprechende richtlinienkonforme Auslegung zulässt, können nur innerstaatliche Gerichte beurteilen (vgl. BVerfGK 19, 89 <99 f.>; EuGH, Urteile vom 25. Februar 1999, Carbonari, C-131/97, Slg. 1999, I-1103, Rn. 49; vom 5. Oktober 2004, Pfeiffer, C-397/01, Slg. 2004, I-8835, Rn. 113 u. 116; vom 16. Juli 2009, Mono Car Styling, C-12/08, Slg. 2009, I-6653, Rn. 63).
2. Gemessen an diesen Grundsätzen hat das Bundesarbeitsgericht das Recht des Beschwerdeführers aus Art. 101 Abs. 1 Satz 2 GG verletzt. Es hat unter Berufung auf den Grundsatz des Vertrauensschutzes auf der Grundlage seiner früheren Auslegung der §§ 17 f. KSchG über die Revision des Beschwerdeführers entschieden, ohne sich zuvor gemäß Art. 267 Abs. 1 und Abs. 3 AEUV an den Gerichtshof der Europäischen Union zu wenden und die Frage klären zu lassen, ob die Gewährung von Vertrauensschutz mit der unionsrechtlichen Pflicht zur richtlinienkonformen Auslegung nationalen Rechts (Art. 288 Abs. 3 AEUV und Art. 4 Abs. 3 EUV) und die damit einhergehende Beschränkung der Wirkung der Junk -Entscheidung mit dem Unionsrecht vereinbar sind.
a) Zwar hat das Bundesarbeitsgericht im Ausgangsverfahren zunächst die vom Gerichtshof der Europäischen Union in seiner Junk -Entscheidung festgestellte Auslegung des Begriffs „Entlassung“ gemäß Art. 2 bis Art. 4 Massenentlassungsrichtlinie ohne - auch ohne zeitliche - Einschränkung der Auslegung von § 17 Abs. 1 Satz 1 KSchG zugrunde gelegt und unter Aufgabe seiner bisherigen Rechtsprechung entsprechend der Entscheidung vom 23. März 2006 (- 2 AZR 343/05 -, NZA 2006, S. 971 ff.) den Begriff „Entlassung“ in § 17 Abs. 1 Satz 1 KSchG als „Kündigungserklärung“ ausgelegt. Es hat auch nicht entgegen dem Urteil des Gerichtshofs vom 27. Januar 2005 festgestellt, dass der Begriff der „Entlassung“ im Sinne der Massenentlassungsrichtlinie aus Gründen des unionsrechtlichen Vertrauensschutzes nicht ex-tunc, sondern erst ab einem bestimmten späteren Zeitpunkt nach der Junk -Entscheidung zu verstehen sei (vgl. Wissmann, Vertrauensschutz - europäisch und deutsch, Festschrift für Jobst-Hubertus Bauer, S. 1161 <1164>), und ist hinsichtlich des zeitlichen Anwendungsbereichs der Auslegung des Begriffs „Entlassung“ im Sinne der Massenentlassungsrichtlinie daher nicht von der Rechtsprechung des Gerichtshofs abgewichen (vgl. EuGH, Urteil vom 6. Oktober 1982, CILFIT, 283/81, Slg. 1982, 3415, Rn. 13 f.).
b) Das Bundesarbeitsgericht hat das Recht des Beschwerdeführers aus Art. 101 Abs. 1 Satz 2 GG jedoch dadurch verletzt, dass es § 17 Abs. 1 Satz 1 KSchG in der angegriffenen Entscheidung aus Gründen des in Art. 20 Abs. 3 GG verankerten Grundsatzes des Vertrauensschutzes ohne Vorlage an den Gerichtshof der Europäischen Union (noch) nicht richtlinienkonform ausgelegt beziehungsweise angewendet hat, obwohl dies methodisch möglich war. Die Gewährung von Vertrauensschutz in die frühere, nicht richtlinienkonforme Auslegung von § 17 Abs. 1 Satz 1 KSchG beeinträchtigt die Verwirklichung der mit der Massenentlassungsrichtlinie verbundenen Ziele (aa). Dennoch hat das Bundesarbeitsgericht von einer Vorlage an den Gerichtshof abgesehen (bb) und Art. 267 Abs. 3 AEUV insoweit in einer offensichtlich unhaltbaren und nicht mehr verständlichen Weise ausgelegt beziehungsweise angewendet (cc).
aa) Das Bundesarbeitsgericht hat aus Art. 20 Abs. 3 GG ein aus seiner Sicht bestehendes Hindernis für eine richtlinienkonforme Auslegung beziehungsweise Anwendung von § 17 Abs. 1 Satz 1 KSchG abgeleitet und damit auf den ersten Blick nicht über die Auslegung von Unionsrecht entschieden, das heißt über eine Frage, für deren Beantwortung gemäß Art. 267 AEUV der Gerichtshof zuständig ist. Durch die Anwendung von Art. 20 Abs. 3 GG hat es jedoch die praktische Wirksamkeit der Massenentlassungsrichtlinie in der Auslegung des Gerichtshofs beeinträchtigt und der unionsrechtlichen Verpflichtung, das nationale Recht richtlinienkonform auszulegen, nicht ausreichend Rechnung getragen. Die Anforderungen an die praktische Wirksamkeit einer Richtlinie ergeben sich aus dem Unionsrecht. Sie zu bestimmen, ist Sache des Gerichtshofs der Europäischen Union, der grundsätzlich auch über eine zeitliche Begrenzung der Wirkungen seiner Urteile entscheiden muss (vgl. EuGH, Urteile vom 27. März 1980, Denkavit italiana, 61/79, Slg. 1980, 1205, Rn. 17 f. unter Verweis auf EuGH, Urteil vom 8. April 1976, Defrenne, 43/75, Slg. 1976, 455, Rn. 74/75; vom 10. April 1984, von Colson und Kamann, 14/83, Slg. 1984, 1891, Rn. 26; vom 16. Juli 2009, Mono Car Sty-ling, C-12/08, Slg. 2009, I-6653, Rn. 60; vom 19. Januar 2010, Kücükdeveci, C-555/07, Slg. 2010, I-365, Rn. 48; vom 15. Januar 2014, Association de médiation sociale, C-176/12, Slg. 2014, I-0000, Rn. 38). Mit Blick auf die Massenentlassungsrichtlinie hat er eine derartige (zeitliche) Begrenzung nicht für erforderlich gehalten (vgl. EuGH, Urteil vom 27. Januar 2005, Junk, C-188/03, Slg. 2005, I-885).
bb) Dennoch hat es das Bundesarbeitsgericht vorliegend unterlassen, den Gerichtshof mit der im Ausgangsverfahren entscheidungserheblichen Frage zu befassen, ob es gegen Art. 288 Abs. 3 AEUV beziehungsweise Art. 4 Abs. 3 EUV verstößt, wenn die unionsrechtlich gebotene und methodisch mögliche Auslegung von §§ 17 f. KSchG aus Gründen des in Art. 20 Abs. 3 GG verankerten Grundsatzes des Vertrauensschutzes abgelehnt wird, beziehungsweise ob die Gewährung von Vertrauensschutz und die damit (faktisch) einhergehende zeitliche Beschränkung der Wirkung der Junk -Entscheidung ausschließlich ihm vorbehalten ist (vgl. Vorlagefrage 7 des Arbeitsgerichts Nienburg, Gerichtsinformation des EuGH vom 27. Juni 2012 zur Rechtssache - C-311/12 -, juris).
cc) Das Bundesarbeitsgericht hat hierbei Art. 267 Abs. 3 AEUV in einer offensichtlich unhaltbaren und nicht mehr verständlichen Weise ausgelegt beziehungsweise angewendet und dadurch das grundrechtsgleiche Recht des Beschwerdeführers aus Art. 101 Abs. 1 Satz 2 GG verletzt. Zwar hat es das Vorliegen einer Vorlagepflicht nach Art. 267 Abs. 3 AEUV geprüft und seine Entscheidung auch begründet (1). Es hat sie jedoch in nicht mehr vertretbarer Weise verneint (2).
(1) Ausweislich der Begründung hat das Bundesarbeitsgericht die Frage der Vorlagepflicht hinsichtlich der Gewährung von Vertrauensschutz in die frühere, nicht richtlinienkonforme Auslegung der §§ 17 f. KSchG zwar durchaus gesehen. Dies ergibt sich aus der ausdrücklichen Feststellung, dass dem Bundesarbeitsgericht die Entscheidung über den Vertrauensschutz nicht „entzogen“ sei und es (diesbezüglich) insbesondere nicht zur Vorlage an den Gerichtshof verpflichtet sei, sowie aus dem Hinweis auf die eine Vorlagepflicht bejahende Auffassung von Schiek (AuR 2006, S. 41 <43 f.>), die sich das Bundesarbeitsgericht nicht zu Eigen gemacht hat. Es hat die Vorlagepflicht vielmehr verneint und dies in der Sache damit begründet, dass es nicht Unionsrecht, sondern nationales Recht auslege und sich insoweit allein im Bereich der nationalen Rechtsanwendung befinde. Aus seiner Sicht war somit keine unionsrechtliche Frage entscheidungserheblich, so dass eine Vorlagepflicht nicht in Betracht kam.
(2) Damit hat es die Frage der Vorlagepflicht in nicht mehr verständlicher und offensichtlich unhaltbarer Weise beantwortet, weil es sich hinsichtlich des (materiellen) Unionsrechts nicht hinreichend kundig gemacht und seine Vorlagepflicht insoweit grundlegend verkannt hat.
(a) Die Annahme des Bundesarbeitsgerichts, es könne eine richtlinienkonforme Auslegung der §§ 17 f. KSchG unter Berufung auf seine frühere Rechtsprechung unterlassen, verkennt die Pflicht zur richtlinienkonformen Auslegung des nationalen Rechts grundlegend. Es hat sich insoweit darüber hinweggesetzt, dass die Gewährung von Vertrauensschutz und die damit verbundene Unterlassung der richtlinienkonformen Auslegung einer nationalen Norm zumindest auch eine Frage des Unionsrechts ist. Hinzu kommt, dass der Gerichtshof in der Junk -Entscheidung (EuGH, Urteil vom 27. Januar 2005, Junk, C-188/03, Slg. 2005, I-885) die Geltung der von ihm vorgenommenen Auslegung der Richtlinie 98/59/EG des Rates vom 20. Juli 1998 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über Massenentlassungen (ABl Nr. L 225/16) nicht aus Gründen des unionsrechtlichen Rechtsgrundsatzes des Vertrauensschutzes in zeitlicher Hinsicht eingeschränkt und eine zeitliche Geltungsbeschränkung damit implizit abgelehnt hat. Durch die Unterlassung der richtlinienkonformen Auslegung der §§ 17 f. KSchG in der angegriffenen Entscheidung verschiebt das Bundesarbeitsgericht die Anwendung der Massenentlassungsrichtlinie in der vom Gerichtshof vorgenommenen Auslegung aus Gründen des Vertrauensschutzes nach nationalem Recht auf einen Zeitpunkt nach ihrem Inkrafttreten (vgl. BVerfGE 126, 286 <314>).
(b) Zwar ist ein Rückgriff auf nationales Verfassungsrecht nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts auch bei der Anwendung des Unionsrechts in Deutschland nicht generell ausgeschlossen. Dies setzt jedoch voraus, dass der vom Grundgesetz gebotene Mindeststandard an Grundrechtsschutz durch das Unionsrecht verfehlt würde (vgl. BVerfGE 37, 271 <280 ff.>; 73, 339 <371 f., 387>; 89, 155 <174 f.>; 102, 147 <163 f.>). Eine solche Feststellung wäre überdies dem Bundesverfassungsgericht vorbehalten (vgl. BVerfGE 123, 267 <354>; 126, 286 <308>). Anhaltspunkte dafür, dass das vom Grundgesetz geforderte Mindestmaß an Grundrechtsschutz unterschritten sein könnte, liegen hier jedoch ersichtlich nicht vor und wurden vom Bundesarbeitsgericht nicht thematisiert. Indem es Bestimmungen des nationalen Verfassungsrechts ins Feld führt, um die praktische Wirksamkeit einer Richtlinie zu begrenzen, setzt es sich daher über die etablierte Rechtsprechung des Gerichtshofs zum Vorrang des Unionsrechts (vgl. EuGH, Urteil vom 17. Dezember 1970, Internationale Handelsgesellschaft, 11/70, Slg. 1970, 1125, Rn. 3) hinweg und verkennt auch insoweit seine Vorlagepflicht.
(c) Dass sich das Bundesarbeitsgericht, obwohl es sich grundsätzlich bewusst war, die Junk -Entscheidung aufgrund ihrer (unionsrechtlichen) Bindungswirkung beachten zu müssen, bei der Prüfung der Entscheidungserheblichkeit einer unionsrechtlichen Frage im Zusammenhang mit der Gewährung von Vertrauensschutz zudem mit keinem Wort näher mit der (unionsrechtlichen) Bindungswirkung von Vorabentscheidungen auseinandergesetzt hat, erscheint ebenfalls nicht mehr verständlich.
Aufgrund dieser methodischen Mängel ist die Anwendung von Art. 267 Abs. 3 AEUV durch das Bundesarbeitsgericht nicht mehr verständlich und offensichtlich unhaltbar. Liegt in Fällen, in denen das Fachgericht die Entscheidungserheblichkeit einer unionsrechtlichen Frage erkennt, sodann jedoch eine Vorlage zum Gerichtshof der Europäischen Union trotz Zweifeln an der richtigen Beantwortung einer unionsrechtlichen Frage nicht in Erwägung zieht (sogenannte grundsätzliche Verkennung der Vorlagepflicht), ein Verstoß gegen die Garantie des gesetzlichen Richters aus Art. 101 Abs. 1 Satz 2 GG vor (vgl. BVerfGE 82, 159 <195 f.>; 126, 286 <316 f.>; 128, 157 <187 f.>; 129, 78 <106 f.>; BVerfG, Urteil vom 28. Januar 2014 - 2 BvR 1561/12, 2 BvR 1562/12, 2 BvR 1563/12, 2 BvR 1564/12 -, NVwZ 2014, S. 646 <657>), so kann im vorliegenden Fall, in dem ein letztinstanzliches Gericht eine Vorlagepflicht verneint, weil es trotz offenkundiger Anhaltspunkte gar nicht erkennt, dass eine unionsrechtliche Frage entscheidungserheblich ist, und die Entscheidung allein an nationalen Maßstäben orientiert trifft, nichts anderes gelten. In beiden Fällen wird Art. 267 Abs. 3 AEUV in einer methodisch eindeutig unzureichenden und auf einer offenkundigen Verkennung seines Regelungsgehalts beruhenden Weise ausgelegt. Diese willkürliche Verneinung der Vorlagepflicht ist daher als Verstoß gegen Art. 101 Abs. 1 Satz 2 GG in Verbindung mit Art. 267 Abs. 3 AEUV verfassungsrechtlich zu beanstanden.
3. Das Urteil des Bundesarbeitsgerichts ist gemäß § 93c Abs. 2 in Verbindung mit § 95 Abs. 2 BVerfGG aufzuheben. Die Sache ist an das Bundesarbeitsgericht zurückzuverweisen.
4. Die Entscheidung über die Auslagenerstattung beruht auf § 34a Abs. 2 BVerfGG.
Huber Müller Maidowski
Weitere Auskünfte erteilen Ihnen gern:
 |
Dr. Martin Hensche Rechtsanwalt Fachanwalt für Arbeitsrecht Kontakt: 030 / 26 39 620 hensche@hensche.de |
 |
Christoph Hildebrandt Rechtsanwalt Fachanwalt für Arbeitsrecht Kontakt: 030 / 26 39 620 hildebrandt@hensche.de |
 |
Nina Wesemann Rechtsanwältin Fachanwältin für Arbeitsrecht Kontakt: 040 / 69 20 68 04 wesemann@hensche.de |