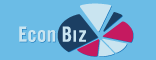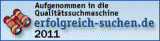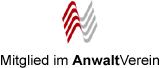- -> zur Mobil-Ansicht
- Arbeitsrecht aktuell
- Tipps und Tricks
- Handbuch Arbeitsrecht
- Gesetze zum Arbeitsrecht
- Urteile zum Arbeitsrecht
- Urteile 2023
- Urteile 2021
- Urteile 2020
- Urteile 2019
- Urteile 2018
- Urteile 2017
- Urteile 2016
- Urteile 2015
- Urteile 2014
- Urteile 2013
- Urteile 2012
- Urteile 2011
- Urteile 2010
- Urteile 2009
- Urteile 2008
- Urteile 2007
- Urteile 2006
- Urteile 2005
- Urteile 2004
- Urteile 2003
- Urteile 2002
- Urteile 2001
- Urteile 2000
- Urteile 1999
- Urteile 1998
- Urteile 1997
- Urteile 1996
- Urteile 1995
- Urteile 1994
- Urteile 1993
- Urteile 1992
- Urteile 1991
- Urteile bis 1990
- Arbeitsrecht Muster
- Videos
- Impressum-Generator
- Webinare zum Arbeitsrecht
-
Kanzlei Berlin
 030 - 26 39 62 0
030 - 26 39 62 0
 berlin@hensche.de
berlin@hensche.de
AnfahrtDetails -
Kanzlei Frankfurt
 069 - 71 03 30 04
069 - 71 03 30 04
 frankfurt@hensche.de
frankfurt@hensche.de
AnfahrtDetails -
Kanzlei Hamburg
 040 - 69 20 68 04
040 - 69 20 68 04
 hamburg@hensche.de
hamburg@hensche.de
AnfahrtDetails -
Kanzlei Hannover
 0511 - 89 97 701
0511 - 89 97 701
 hannover@hensche.de
hannover@hensche.de
AnfahrtDetails -
Kanzlei Köln
 0221 - 70 90 718
0221 - 70 90 718
 koeln@hensche.de
koeln@hensche.de
AnfahrtDetails -
Kanzlei München
 089 - 21 56 88 63
089 - 21 56 88 63
 muenchen@hensche.de
muenchen@hensche.de
AnfahrtDetails -
Kanzlei Nürnberg
 0911 - 95 33 207
0911 - 95 33 207
 nuernberg@hensche.de
nuernberg@hensche.de
AnfahrtDetails -
Kanzlei Stuttgart
 0711 - 47 09 710
0711 - 47 09 710
 stuttgart@hensche.de
stuttgart@hensche.de
AnfahrtDetails
BAG, Urteil vom 06.09.2012, 2 AZR 858/11
| Schlagworte: | Kündigungsbefugnis, Kündigungsfrist | |
| Gericht: | Bundesarbeitsgericht | |
| Aktenzeichen: | 2 AZR 858/11 | |
| Typ: | Urteil | |
| Entscheidungsdatum: | 06.09.2012 | |
| Leitsätze: | ||
| Vorinstanzen: | Arbeitsgericht Hamburg, Urteil vom 05.07.2010, 22 Ca 25/10 Landesarbeitsgericht Hamburg, Urteil vom 07.04.2011, 7 Sa 66/10 |
|
BUNDESARBEITSGERICHT
2 AZR 858/11
7 Sa 66/10
Landesarbeitsgericht
Hamburg
Im Namen des Volkes!
Verkündet am
6. September 2012
URTEIL
Freitag, Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle
In Sachen
Kläger, Berufungskläger und Revisionskläger,
pp.
Beklagte, Berufungsbeklagte und Revisionsbeklagte,
hat der Zweite Senat des Bundesarbeitsgerichts aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 6. September 2012 durch den Vorsitzenden Richter am Bundesarbeitsgericht Kreft, die Richterinnen am Bundesarbeitsgericht Berger und Dr. Rinck sowie die ehrenamtlichen Richter Dr. Grimberg und Wolf für Recht erkannt:
- 2 -
1. Auf die Revision des Klägers wird das Urteil des Landesarbeitsgerichts Hamburg vom 7. April 2011 - 7 Sa 66/10 - aufgehoben.
2. Die Sache wird zur neuen Verhandlung und Entscheidung - auch über die Kosten des Revisionsverfahrens - an das Landesarbeitsgericht zurückverwiesen.
Von Rechts wegen!
Tatbestand
Die Parteien streiten darüber, ob ihr Arbeitsverhältnis aufgrund einer Kündigung der Beklagten geendet hat. In diesem Zusammenhang streiten sie in erster Linie darüber, ob die vorliegende Klage fristgerecht erhoben wurde.
Die Beklagte betreibt eine Spedition mit etwa 100 Mitarbeitern. Der Kläger war bei ihr seit 2007 als Lagerarbeiter beschäftigt. Am 15. Dezember 2009 erhielt er ein auf Firmenpapier der Beklagten verfasstes Kündigungsschreiben von diesem Tage. Das Schreiben enthält eingangs die Angabe „Unsere Ref.: P. D/sk“ und endet unter der vollständig aufgeführten Firma der Beklagten mit zwei handschriftlichen Zeichnungen. Die linke beginnt mit „ppa.“ und stellt den Schriftzug des Prokuristen V dar. Die rechte beginnt mit „i.V.“ und ist die Zeichnung der Personalverantwortlichen und Handlungsbevollmächtigten P D.
Am 2. Februar 2010 erhob der Kläger gegen die Kündigung Klage. Mit Schreiben seines Prozessbevollmächtigten vom 28. Mai 2010 wies er die Kündigung zurück und forderte die Beklagte zur Genehmigung auf. Mit einem von zwei Prokuristen unterzeichneten Schreiben vom 1. Juni 2010, welches dem Kläger am Folgetag zuging, genehmigte die Beklagte die Kündigung vorsorglich.
Der Kläger hat die Auffassung vertreten, er habe die Klage rechtzeitig erhoben, weil keine schriftliche Kündigung vorliege. Die handschriftlichen Zeichnungen auf dem Schreiben vom 15. Dezember 2009 seien keine Unterschriften, sondern lediglich Paraphen. Es habe zudem an der Vertretungsbe-
- 3 -
fugnis der unterzeichnenden Personen gefehlt. Ausweislich des Handelsregisters habe die Beklagte Herrn V lediglich Gesamtprokura erteilt. Frau D sei keine Prokuristin. Sie dürfe ihrerseits zwar zusammen mit dem sog. Business-Unit-Manager kündigen. Herr V habe diese Funktion aber nicht bekleidet. Falls er in Vertretung des Business-Unit-Managers habe handeln wollen, hätte er dies zum Ausdruck bringen müssen. Die Dreiwochenfrist des § 4 Satz 1 KSchG habe deshalb frühestens mit der Genehmigung der Kündigungserklärung begonnen.
Der Kläger hat zuletzt beantragt
festzustellen, dass sein Arbeitsverhältnis durch die
Kündigung der Beklagten vom 15. Dezember 2009 nicht geendet hat.
Die Beklagte hat beantragt, die Klage abzuweisen. Sie hat die Auffassung vertreten, die Kündigung gelte wegen Nichteinhaltung der dreiwöchigen Klagefrist gemäß § 7 KSchG als von Anfang an wirksam. Sie genüge der Schriftform des § 623 BGB. Frau D sei als Personalleiterin bevollmächtigt gewesen, die Kündigung zusammen mit einem Business-Unit-Manager zu unterzeichnen. Herr V sei Abwesenheitsvertreter des Business-Unit-Managers gewesen. Die nach ordnungsgemäßer Betriebsratsanhörung ausgesprochene Kündigung sei sozial gerechtfertigt.
Die Vorinstanzen haben die Klage abgewiesen. Mit der vom Bundesarbeitsgericht zugelassenen Revision verfolgt der Kläger sein Klagebegehren weiter.
Entscheidungsgründe
Die zulässige Revision ist begründet. Auf der Grundlage seiner bisherigen Feststellungen durfte das Landesarbeitsgericht die Kündigung nicht als wirksam ansehen. Der Senat kann in der Sache nicht abschließend entscheiden, weil der relevante Sachverhalt noch nicht hinreichend festgestellt ist (§ 563 Abs. 3 ZPO). Das angegriffene Urteil war deshalb aufzuheben (§ 562 Abs. 1
- 4 -
ZPO) und die Sache zur neuen Verhandlung und Entscheidung an das Berufungsgericht zurückzuverweisen (§ 563 Abs. 1 Satz 1 ZPO).
I. Aufgrund des vom Landesarbeitsgericht festgestellten Sachverhalts lässt sich nicht beurteilen, ob der Kläger die dreiwöchige Klagefrist des § 4 Satz 1 KSchG gewahrt hat.
1. Will der Arbeitnehmer geltend machen, eine Kündigung sei sozial ungerechtfertigt oder aus „anderen Gründen“ rechtsunwirksam, muss er gemäß § 4 Satz 1 KSchG innerhalb von drei Wochen nach Zugang der schriftlichen Kündigung beim Arbeitsgericht Klage auf Feststellung erheben, dass das Arbeitsverhältnis durch die Kündigung nicht aufgelöst worden ist. Wird die Unwirksamkeit der Kündigung nicht rechtzeitig geltend gemacht, gilt die Kündigung gemäß § 7 KSchG als von Anfang an rechtswirksam. Eine verspätet erhobene Kündigungsschutzklage ist deshalb als unbegründet abzuweisen (BAG 26. Juni 1986 - 2 AZR 358/85 - zu B II 3 b der Gründe, BAGE 52, 263).
2. Da § 4 Satz 1 KSchG auf den Zugang der schriftlichen Kündigung abstellt, kann der Mangel der Schriftform auch noch nach Ablauf der Dreiwochenfrist geltend gemacht werden (BAG 28. Juni 2007 - 6 AZR 873/06 - Rn. 10, BAGE 123, 209).
3. Nach Sinn und Zweck der gesetzlichen Regelung setzt der Beginn der Klagefrist ferner den Zugang einer vom Arbeitgeber stammenden, ihm jedenfalls zurechenbaren Kündigung voraus.
a) Die Erweiterung des § 4 Abs. 1 KSchG auf „sonstige Unwirksamkeitsgründe“ durch das Gesetz zu Reformen am Arbeitsmarkt vom 24. Dezember 2003 erfolgte im Interesse einer raschen Klärung der Frage, ob eine Kündigung das Arbeitsverhältnis beendet hat oder nicht (BR-Drucks. 421/03 S. 11 und 19). Die dreiwöchige Klagefrist dient vor allem dem Schutz des Arbeitgebers. Er soll nach Ablauf von drei Wochen nach Zugang und einer Zeitspanne für die Klagezustellung darauf vertrauen dürfen, dass seine Kündigung das Arbeitsverhältnis aufgelöst hat (APS/Hesse 4. Aufl. § 4 KSchG Rn. 10c). Dieses Schutzes bedarf der Arbeitgeber nicht, wenn weder er selbst noch ein Vertreter mit Wirkung für und gegen ihn gekündigt hat (BAG 26. März 2009 - 2 AZR 403/07 - Rn. 22, AP
- 5 -
KSchG 1969 § 4 Nr. 70; APS/Hesse aaO; ErfK/Kiel 12. Aufl. § 4 KSchG Rn. 6; MünchKommBGB/Hergenröder 6. Aufl. § 4 KSchG Rn. 1; Genenger RdA 2010, 274, 277 ff.). Schon dieser Umstand spricht gegen die Ansicht, die Klagefrist werde auch durch eine dem Arbeitgeber nicht zuzurechnende Kündigung in Gang gesetzt. Hinzu kommt, dass es andernfalls uU ein Dritter in der Hand hätte, das Arbeitsverhältnis aufzulösen, ohne dass zumindest eine Partei des Arbeitsvertrags dies tatsächlich wollte. Versäumte der Arbeitnehmer die Einhaltung der Klagefrist, träte die Wirksamkeitsfiktion des § 7 KSchG ein, ohne dass der Arbeitgeber die Möglichkeit gehabt hätte, dies zu verhindern. Er wäre vielmehr darauf angewiesen, dass die (ohne Befugnis) ausgesprochene Kündigung auch vom Arbeitnehmer nicht akzeptiert und klageweise angegriffen wird (BAG 26. März 2009 - 2 AZR 403/07 - Rn. 23, aaO).
b) Eine Kündigung durch einen Vertreter ohne Vertretungsmacht ist dem Arbeitgeber nicht zuzurechnen, weil sie nicht von seinem Willen getragen ist. Die erforderliche Zurechenbarkeit wird erst durch eine (nachträglich) erteilte Genehmigung hergestellt (BAG 26. März 2009 - 2 AZR 403/07 - Rn. 21, AP KSchG 1969 § 4 Nr. 70). Eine solche ist gemäß § 180 Satz 2, § 177 Abs. 1 BGB möglich, wenn der Erklärungsempfänger die Vertretungsmacht nicht „bei der Vornahme“ beanstandet hat (BAG 16. Dezember 2010 - 2 AZR 485/08 - Rn. 13, AP BGB § 626 Nr. 232 = EzA BGB 2002 § 626 Nr. 33). Materiellrechtlich kann die Genehmigung sowohl gegenüber dem Vertreter als auch dem Erklärungsempfänger erklärt werden (§ 182 Abs. 1 BGB). Da aber § 4 Satz 1 KSchG den Beginn der Frist an den Zugang der Kündigungserklärung knüpft und damit von der Kenntnismöglichkeit des Arbeitnehmers abhängig macht, ist auch für die Genehmigung - ebenso wie im Fall des § 4 Satz 4 KSchG - auf ihren Zugang beim Arbeitnehmer abzustellen (ErfK/Kiel 12. Aufl. § 4 KSchG Rn. 6; APS/Hesse 4. Aufl. KSchG § 4 Rn. 10c; v. Hoyningen-Huene/Linck KSchG 14. Aufl. § 4 Rn. 20). Die materiellrechtliche Rückwirkung der Genehmigung (§ 184 Abs. 1 BGB) ist für den Lauf der Klagefrist ohne Bedeutung (vgl. allgemein Palandt/Ellenberger 72. Aufl. § 184 Rn. 2; zur Verjährung: Staudinger/Gursky 2009 BGB § 184 Rn. 38 mwN). Das Interesse des Arbeitgebers an der raschen Klärung der Frage, ob die Kündigung das Arbeitsverhältnis
- 6 -
beendet hat, beginnt im Fall der Kündigung durch einen Vertreter ohne Vertretungsmacht erst mit der Genehmigung.
4. Das Landesarbeitsgericht hat im Streitfall zu Recht angenommen, die Kündigung genüge der Schriftform (§§ 623, 126 Abs. 1 BGB).
a) Die in § 623 BGB angeordnete Schriftform der Kündigung soll Rechtssicherheit für die Vertragsparteien und eine Beweiserleichterung im Rechtsstreit bewirken. Durch die dazu von § 126 Abs. 1 BGB verlangte eigenhändige Unterschrift wird der Aussteller der Urkunde erkennbar. Die Unterschrift stellt eine unzweideutige Verbindung zwischen Erklärung und Erklärendem her. Der Empfänger der Erklärung erhält die Möglichkeit zu überprüfen, wer sie abgegeben hat und ob sie echt ist (BAG 24. Januar 2008 - 6 AZR 519/07 - Rn. 11, BAGE 125, 325; 21. April 2005 - 2 AZR 162/04 - zu II 1 der Gründe, AP BGB § 623 Nr. 4 = EzA BGB 2002 § 623 Nr. 4).
aa) Ob eine eigenhändige Unterschrift vorliegt, hängt nicht davon ab, ob aufgrund der Unterschrift schon bei Zugang der schriftlichen Erklärung die Person des Ausstellers für den Empfänger zweifelsfrei feststeht. Der Aussteller soll nur identifiziert werden können (BAG 24. Januar 2008 - 6 AZR 519/07 - Rn. 11, BAGE 125, 325; BT-Drucks. 14/4987 S. 16). Hierzu bedarf es nicht der Lesbarkeit des Namenszugs. Es genügt ein die Identität des Unterschreibenden ausreichend kennzeichnender Schriftzug, der individuelle und entsprechend charakteristische Merkmale aufweist, die eine Nachahmung erschweren. Der Schriftzug muss sich als Wiedergabe eines Namens darstellen und die Absicht einer vollen Unterschriftsleistung erkennen lassen, selbst wenn er flüchtig niedergelegt und von einem starken Abschleifungsprozess gekennzeichnet ist (BAG 24. Januar 2008 - 6 AZR 519/07 - Rn. 11, aaO; 20. September 2006 - 6 AZR 82/06 - Rn. 72 mwN, BAGE 119, 311; BGH 27. September 2005 - VIII ZB 105/04 - Rn. 8, NJW 2005, 3775).
bb) Die Unterschrift ist von einer bewussten und gewollten Namensabkürzung (Handzeichen, Paraphe) zu unterscheiden (BGH 21. Februar 2008 - V ZB 96/07 - Rn. 8, Grundeigentum 2008, 539; 10. Juli 1997 - IX ZR 24/97 - zu II 1
- 7 -
der Gründe mwN, NJW 1997, 3380). Auch das Gesetz differenziert in § 126 Abs. 1 BGB zwischen einer Namensunterschrift und einem Handzeichen; letzteres wahrt die Schriftform nur im Falle notarieller Beglaubigung. Für die Abgrenzung zwischen Unterschrift und Handzeichen (Paraphe) ist das äußere Erscheinungsbild maßgebend. Der Wille des Unterzeichnenden ist nur von Bedeutung, soweit er in dem Schriftzug seinen Ausdruck gefunden hat (BAG 24. Januar 2008 - 6 AZR 519/07 - Rn. 11, BAGE 125, 325; BGH 22. Oktober 1993 - V ZR 112/92 - NJW 1994, 55).
b) Danach genügt die Kündigungserklärung dem Schriftformerfordernis nach §§ 623, 126 Abs. 1 BGB.
aa) Bezogen auf die Zeichnung des Prokuristen hat der Kläger die entsprechende Annahme der Vorinstanzen mit der Revision nicht mehr angegriffen.
bb) Auch bei dem Schriftzug von Frau D handelt es sich um eine Unterschrift und nicht lediglich um eine Paraphe. Sie stellt sich nicht als bewusste und gewollte Namensabkürzung dar. Durch die Länge des aus drei Abschnitten bestehenden Schriftzugs wird der Wille der Ausstellerin deutlich, zwar mit abgekürztem Vor-, aber mit vollem Zunamen und deshalb nicht nur mit einer Abkürzung zu zeichnen. Das Landesarbeitsgericht hat ferner zu Recht darauf abgestellt, dass in dem Zusatz „i.V.“ die Absicht zum Ausdruck kommt, eine nach außen gerichtete, für den Rechtsverkehr verbindliche und nicht nur eine interne Erklärung abzugeben.
cc) Der Schriftzug genügt den an eine Unterschrift zu stellenden Anforderungen.
(1) Entgegen der Auffassung des Klägers ist weder die Lesbarkeit des gesamten Namens noch die einzelner Buchstaben erforderlich. Es genügt ein die Identität des Unterschreibenden ausreichend kennzeichnender Schriftzug. Dessen charakteristische Merkmale müssen sich allerdings aus ihm selbst ergeben. Es genügt nicht, dass sich die Identität des Unterzeichners aufgrund von Umständen - hier dem im Briefkopf enthaltenen Diktatzeichen - feststellen lässt, die außerhalb des Schriftzugs liegen.
- 8 -
(2) Der Schriftzug von Frau D weist hinreichende individuelle Merkmale auf. Dem langgezogenen krummen Strich nach dem Zusatz „i.V.“ lässt sich andeutungsweise entnehmen, dass es sich um die Abkürzung des Vornamens „P“ handelt. Sodann folgen eine geschlossene sowie eine offene Schlaufe, an welche sich ein kleiner Haken anschließt. Darin lassen sich bei der gebotenen großzügigen Betrachtungsweise andeutungsweise die nach einem starken Abschleifungsprozess übrig gebliebenen Oberlängen der im Namen „D“ enthaltenen Buchstaben „D“ und „k“ erkennen. Durch die charakteristischen Linien und den unterschiedlichen Druck, mit welchem der Schriftzug aufgetragen ist, ist seine Nachahmung hinreichend erschwert.
5. Die Klagefrist ist mit Zugang des Kündigungsschreibens am 15. Dezember 2009 nur dann in Gang gesetzt worden, wenn zu diesem Zeit-punkt eine entsprechende Vollmacht der erklärenden Personen bestand. Entgegen der Auffassung des Landesarbeitsgerichts führt allein der Rechts-schein einer solchen Bevollmächtigung nicht dazu, dass die Kündigungserklärung der Beklagten zurechenbar wäre. § 4 KSchG dient dem Schutz des Arbeitgebers. Die gewohnheitsrechtlich anerkannte Figur der Anscheinsvoll-macht (vgl. Palandt/Ellenberger 72. Aufl. BGB § 172 Rn. 6) dient hingegen dem Schutz des Arbeitnehmers als des Erklärungsempfängers. In dessen Interesse aber liegt eine Zurechenbarkeit der Kündigung zum Arbeitgeber gerade nicht. Der Arbeitgeber wiederum ist bei Vorliegen eines bloßen Rechtsscheins wegen des Fehlens einer tatsächlich von seinem Willen getragenen Erklärung nicht im Sinne von § 4 KSchG schutzbedürftig. Die Sichtweise des Landesarbeitsgerichts ist weder mit dem Schutzzweck des § 4 Satz 1 KSchG noch mit dem der Anscheinsvollmacht vereinbar.
II. Die Sache ist nicht entscheidungsreif. Der Senat kann nicht selbst beurteilen, ob die die Kündigung aussprechenden Personen bei deren Zugang am 15. Dezember 2009 Vertretungsmacht besaßen. Hierzu hat das Landesarbeitsgericht bislang keine Feststellungen getroffen. Im Rahmen der neuen Verhandlung wird es dem entsprechenden streitigen Vortrag der Parteien nachzugehen haben.
- 9 -
1. Sollte die behauptete Vollmacht bereits bei Zugang der Kündigung am 15. Dezember 2009 bestanden haben, hätte der Kläger mit der Klageerhebung am 2. Februar 2010 die Frist des § 4 Satz 1 KSchG nicht gewahrt, so dass die Wirksamkeitsfiktion des § 7 KSchG eingetreten und die Klage deshalb unbegründet wäre.
2. Sollte das Landesarbeitsgericht zu dem Ergebnis gelangen, dass die erforderliche Vertretungsmacht am 15. Dezember 2009 nicht vorgelegen hat, wäre die Frist des § 4 Satz 1 KSchG mit dem Zugang der Genehmigung bei dem Kläger, also sogar erst nach Klageerhebung angelaufen. Die Wirksamkeitsfiktion des § 7 KSchG wäre in diesem Fall nicht eingetreten. Das Landesarbeitsgericht müsste deshalb prüfen, ob die Betriebsratsanhörung ordnungsgemäß erfolgt und ggf. die Kündigung sozial gerechtfertigt ist.
Kreft
Berger
Rinck
Grimberg
Wolf
Weitere Auskünfte erteilen Ihnen gern:
 |
Dr. Martin Hensche Rechtsanwalt Fachanwalt für Arbeitsrecht Kontakt: 030 / 26 39 620 hensche@hensche.de |
 |
Christoph Hildebrandt Rechtsanwalt Fachanwalt für Arbeitsrecht Kontakt: 030 / 26 39 620 hildebrandt@hensche.de |
 |
Nina Wesemann Rechtsanwältin Fachanwältin für Arbeitsrecht Kontakt: 040 / 69 20 68 04 wesemann@hensche.de |