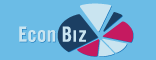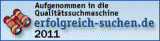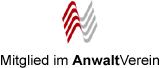- -> zur Mobil-Ansicht
- Arbeitsrecht aktuell
- Tipps und Tricks
- Handbuch Arbeitsrecht
- Gesetze zum Arbeitsrecht
- Urteile zum Arbeitsrecht
- Urteile 2023
- Urteile 2021
- Urteile 2020
- Urteile 2019
- Urteile 2018
- Urteile 2017
- Urteile 2016
- Urteile 2015
- Urteile 2014
- Urteile 2013
- Urteile 2012
- Urteile 2011
- Urteile 2010
- Urteile 2009
- Urteile 2008
- Urteile 2007
- Urteile 2006
- Urteile 2005
- Urteile 2004
- Urteile 2003
- Urteile 2002
- Urteile 2001
- Urteile 2000
- Urteile 1999
- Urteile 1998
- Urteile 1997
- Urteile 1996
- Urteile 1995
- Urteile 1994
- Urteile 1993
- Urteile 1992
- Urteile 1991
- Urteile bis 1990
- Arbeitsrecht Muster
- Videos
- Impressum-Generator
- Webinare zum Arbeitsrecht
-
Kanzlei Berlin
 030 - 26 39 62 0
030 - 26 39 62 0
 berlin@hensche.de
berlin@hensche.de
AnfahrtDetails -
Kanzlei Frankfurt
 069 - 71 03 30 04
069 - 71 03 30 04
 frankfurt@hensche.de
frankfurt@hensche.de
AnfahrtDetails -
Kanzlei Hamburg
 040 - 69 20 68 04
040 - 69 20 68 04
 hamburg@hensche.de
hamburg@hensche.de
AnfahrtDetails -
Kanzlei Hannover
 0511 - 89 97 701
0511 - 89 97 701
 hannover@hensche.de
hannover@hensche.de
AnfahrtDetails -
Kanzlei Köln
 0221 - 70 90 718
0221 - 70 90 718
 koeln@hensche.de
koeln@hensche.de
AnfahrtDetails -
Kanzlei München
 089 - 21 56 88 63
089 - 21 56 88 63
 muenchen@hensche.de
muenchen@hensche.de
AnfahrtDetails -
Kanzlei Nürnberg
 0911 - 95 33 207
0911 - 95 33 207
 nuernberg@hensche.de
nuernberg@hensche.de
AnfahrtDetails -
Kanzlei Stuttgart
 0711 - 47 09 710
0711 - 47 09 710
 stuttgart@hensche.de
stuttgart@hensche.de
AnfahrtDetails
BAG, Urteil vom 24.04.2014, 8 AZR 369/13
| Schlagworte: | Betriebsübergang, Widerspruch | |
| Gericht: | Bundesarbeitsgericht | |
| Aktenzeichen: | 8 AZR 369/13 | |
| Typ: | Urteil | |
| Entscheidungsdatum: | 24.04.2014 | |
| Leitsätze: | Der Widerspruch nach § 613a Abs. 6 BGB ist gegenüber dem „neuen Inhaber“ oder dem „bisherigen Arbeitgeber“ zu erklären; er richtet sich gegen den letzten Übergang des Arbeitsverhältnisses infolge des letzten Betriebsübergangs. | |
| Vorinstanzen: | Arbeitsgericht Gera, Urteil vom 21.5.2012 - 1 Ca 113/12 Thüringer Landesarbeitsgericht, Urteil vom 5.2.2013 - 1 Sa 189/12 |
|
BUNDESARBEITSGERICHT
8 AZR 369/13
1 Sa 189/12
Thüringer
Landesarbeitsgericht
Im Namen des Volkes!
Verkündet am
24. April 2014
URTEIL
Schiege, Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle
In Sachen
Kläger, Berufungsbeklagter und Revisionskläger,
pp.
Beklagte, Berufungsklägerin und Revisionsbeklagte,
hat der Achte Senat des Bundesarbeitsgerichts aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 24. April 2014 durch den Vorsitzenden Richter am Bundesarbeitsgericht Hauck, den Richter am Bundesarbeitsgericht Breinlinger, die Richterin am Bundesarbeitsgericht Dr. Winter sowie die ehrenamtlichen Richter Kandler und Avenarius für Recht erkannt:
- 2 -
Die Revision des Klägers gegen das Urteil des Thüringer Landesarbeitsgerichts vom 5. Februar 2013 - 1 Sa 189/12 - wird zurückgewiesen.
Der Kläger hat die Kosten des Revisionsverfahrens zu tragen.
Von Rechts wegen!
Tatbestand
Die Parteien streiten um die Frage, ob zwischen ihnen ein Arbeitsverhältnis nach mehreren Betriebsübergängen aufgrund des Widerspruchs des Klägers gegen den Übergang seines Arbeitsverhältnisses besteht.
Der Kläger war 1978 in die Dienste einer der Rechtsvorgängerinnen der Beklagten getreten. Bei der Beklagten arbeitete der Kläger seit dem Jahr 2000 als Kundenberater im Callcenter G, seine monatliche Bruttovergütung betrug damals ca. 3.000,00 Euro.
Der Beschäftigungsbetrieb des Klägers ging am 1. September 2007 von der Beklagten auf die „V GmbH“ (V) über. Davon war der Kläger durch ein Unterrichtungsschreiben der V vom 26. Juli 2007 informiert worden. Der Kläger erhob damals keinen Widerspruch gegen den Übergang seines Arbeitsverhältnisses. Er erhielt von der V im November 2007 einen neuen Arbeitsvertrag, dem zufolge das Arbeitsverhältnis „am 01.09.2007“ begonnen haben solle und in dem der übernommene soziale und rechtliche Besitzstand oder die Tatsache eines Betriebsübergangs keine Erwähnung fand. Zum 15. Februar 2008 nahm die V eine Versetzung des Klägers vor, der zufolge er nicht mehr wie bisher „Teamleiter Kundenservice Center“, sondern „Service Center Agent, CEO, Operation 1, Service Center, Abteilung K 16“ am Standort G sein sollte, bei ansonsten unveränderten Bedingungen.
- 3 -
Mit Datum vom 25. Oktober 2008 wurde der Kläger von der V und einer T G GmbH (T) über einen (weiteren) Betriebsübergang von der V auf die T unterrichtet, der am 1. Dezember 2008 stattfand und dem der Kläger nicht widersprach.
Nach einem Jahr Weiterarbeit für T erhielt er im Dezember 2009 den Entwurf eines neuen Arbeitsvertrages, den der Kläger schließlich am 30. Dezember 2009 unterschrieb. Die Arbeitsbedingungen des Klägers änderten sich. Die Vergütung wurde um ca. 1/3 auf knapp 2.100,00 Euro abgesenkt (mit Lohnausgleichsbeiträgen bis September 2010). Die Zusage zur betrieblichen Altersversorgung wurde zum 31. Dezember 2009 zurückgenommen. Die Wochenarbeitszeit wurde von 38 auf 39 Stunden erhöht. Im Gegenzug verzichtete T bis zum 30. November 2013 auf den Ausspruch betriebsbedingter Kündigungen am Standort G mit Ausnahme einer Betriebsstilllegung. Für diesen Ausnahmefall waren arbeitsvertragliche Lohnausgleichszahlungen vereinbart. Der Kläger arbeitete gemäß diesen arbeitsvertraglichen Bedingungen für die T in den Jahren 2010 und 2011. Nach den protokollierten Feststellungen in der Berufungsverhandlung hat der Kläger bestätigt, auch später dem Übergang seines Arbeitsverhältnisses auf T nicht widersprochen zu haben.
Mit Urteil vom 26. Mai 2011 (- 8 AZR 18/10 -) entschied der Senat zu einem wortgleichen Unterrichtungsschreiben der V, ebenfalls vom 26. Juli 2007, aber ein anderes Arbeitsverhältnis betreffend, dass die Unterrichtung fehlerhaft war. Eine Pressemitteilung wurde zu diesem Urteil nicht herausgegeben. Der Kläger will davon aus der Presse erst im Winter 2011 erfahren haben. Er ließ unter dem 27. Januar 2012 durch seinen Prozessbevollmächtigten gegenüber der Beklagten dem Übergang seines Arbeitsverhältnisses „durch Betriebsübergang vom 31.07.2007 in die V GmbH“ widersprechen. Nach den Feststellungen des Landesarbeitsgerichts betraf dieses Widerspruchsschreiben trotz mehrerer redaktioneller Fehler das Arbeitsverhältnis des Klägers.
- 4 -
Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 28. August 2013 wurde die T umfirmiert in „T O GmbH“, was am 3. September 2013 in das Handelsregister eingetragen wurde (HRB des Amtsgerichts H). Über deren Vermögen wurde nach Bestellung eines vorläufigen Insolvenzverwalters unter dem 10. Oktober 2013 am 16. Januar 2014 das Insolvenzverfahren eröffnet (AG H). Die Gesellschaft ist aufgelöst.
Der Kläger hat die Auffassung vertreten, im Januar 2012 noch dem 8 Übergang seines Arbeitsverhältnisses von der Beklagten auf die V im Sommer 2007 widersprechen gekonnt zu haben. Die damalige Unterrichtung über den Betriebsübergang sei fehlerhaft gewesen und habe die Monatsfrist zum Widerspruch nach § 613a Abs. 6 BGB nicht in Gang gesetzt.
Er hat beantragt
festzustellen, dass das zwischen den Parteien begründete Arbeitsverhältnis nicht mit Betriebsübergang auf die V GmbH zum 1. September 2007 beendet worden ist, sondern zu den am 30. August 2007 geltenden Vertragsbedingungen unverändert fortbesteht.
Ihren Antrag auf Klageabweisung hat die Beklagte vor allem damit begründet, das Widerspruchsrecht des Klägers sei verwirkt.
Ohne dass der zwischen dem Kläger und T geschlossene neue Arbeitsvertrag vorgelegen hätte, hat das Arbeitsgericht der Klage stattgegeben. Auf die Berufung der Beklagten hat das Landesarbeitsgericht das erstinstanzliche Urteil abgeändert und die Klage abgewiesen. Mit der vom Landesarbeitsgericht zugelassenen Revision verfolgt der Kläger die Wiederherstellung des erstinstanzlichen Urteils.
- 5 -
Entscheidungsgründe
Die zulässige Revision ist unbegründet. Einen Widerspruch gegen den früheren Übergang seines Arbeitsverhältnisses von der Beklagten auf die V konnte der Kläger, dessen Arbeitsverhältnis mittlerweile mit T besteht, nicht mehr einlegen, § 613 Abs. 6 Satz 2 BGB.
A. Das Landesarbeitsgericht hat seine Entscheidung im Wesentlichen wie folgt begründet: Die Klage sei zulässig. Es bestehe ein rechtliches Interesse des Klägers an der Feststellung der von ihm behaupteten Rechtsbeziehung zur Beklagten. Jedoch sei die Klage unbegründet. Zwar habe der Kläger am 27. Januar 2012 dem Übergang seines Arbeitsverhältnisses von der Beklagten auf die V widersprochen, was eine Auslegung und die Zusammenschau des Widerspruchsschreibens mit der Vollmacht und der unmittelbar darauf erhobenen Klage ergebe. Auch sei der Widerspruch nicht verfristet gewesen, weil das Unterrichtungsschreiben, wie vom Senat anderweitig entschieden, fehlerhaft gewesen sei und die Frist zur Erklärung des Widerspruchs gegen den Über-gang des Arbeitsverhältnisses nicht in Lauf zu setzen vermochte.
Der Kläger habe aber sein Recht zum Widerspruch verwirkt. Nach 54 Monaten könne durchaus von einer Verwirklichung des Zeitmoments ausgegangen werden. Mit dem Abschluss des so genannten Sanierungsarbeitsvertrages sei das Arbeitsverhältnis mit T auf eine neue Grundlage gestellt worden. Somit habe der Kläger mit dem nächsten Übernehmer eine Disposition über das Arbeitsverhältnis als Ganzes getroffen und das Umstandsmoment verwirklicht. Die Disposition gegenüber dem Zweiterwerber des Betriebes müsse einer Disposition gegenüber dem Ersterwerber gleichstehen. Dies müsse insbesondere bei „Kettenübergängen“ gelten, obwohl zwischen Veräußerer und Zweiterwerber keine Verantwortungsgemeinschaft bestehe und die Verwirkung des Rechts zum Widerspruch eine Ausprägung des Grundsatzes von Treu und Glauben sei, bei dem das Interesse des Vertrauensschutzes beim Verpflichteten das Interesse des zum Widerspruch Berechtigten überwiegen solle.
- 6 -
B. Der Senat folgt dem im Ergebnis. Die Frage der Verwirkung des Widerspruchsrechts stellt sich jedoch in Konstellationen wie der vorliegenden schon deswegen nicht, weil nach dem Gesetz die betroffenen Arbeitnehmer nicht Widerspruch gegen den Übergang ihres mittlerweile bei einem Nacherwerber bestehenden Arbeitsverhältnisses auf einen Ersterwerber einlegen können.
I. Seinen Widerspruch gegen den Übergang des Arbeitsverhältnisses am 1. September 2007 auf die V hat der Kläger am 27. Januar 2012 gegenüber der Beklagten erklärt. Die Erklärung erfolgte damit entgegen § 613a Abs. 6 Satz 2 BGB nicht gegenüber dem „neuen Inhaber“ - T - oder „dem bisherigen Arbeitgeber“ (V), sondern gegenüber der Beklagten als einer früheren Arbeitgeberin. Eine solche Widerspruchsmöglichkeit besteht nach dem Gesetz nicht.
1. Der Widerspruch gegenüber einem ehemaligen Arbeitgeber ist nach dem Wortlaut des Gesetzes nicht möglich. „Bisheriger“ Arbeitgeber in der Situation, in der sich der Kläger im Januar 2012 nach zwei Betriebsübergängen befand, wäre im Sinne des Gesetzes die V gewesen. „Bisher/ig“ bedeutet: „bis jetzt“ (Brockhaus-Wahrig Deutsches Wörterbuch S. 703 [1980]); „von einem unbestimmten Zeitpunkt an bis zum heutigen Tag“ (Duden Das große Wörterbuch der deutschen Sprache 3. Aufl. S. 607); „bislang/bis jetzt/bis heute/bis da-to/bis zum heutigen Tage/bis zur jetzigen Stunde“ (Knaurs Lexikon der sinnverwandten Wörter S. 116). Bezogen auf einen Betriebsübergang also ist der „bisherige Arbeitgeber“ derjenige, der vor dem aktuellen Arbeitgeber den Betrieb innehatte. Die derzeitige Arbeitgeberin des Klägers, die T, ist „neue Inhaberin“ iSd. § 613a Abs. 6 Satz 2 BGB, da sie beim letzten Betriebsübergang den Betrieb erworben hat. Zur Beklagten steht der Kläger im Zeitpunkt der Erklärung seines Widerspruchs nicht mehr in einer, auch nicht in einer durch § 613a Abs. 6 BGB vermittelten arbeitsrechtlichen oder sonstigen vertragsrechtlichen Beziehung. Die Beklagte war bei Erklärung des Widerspruchs nicht „bisheriger“ Arbeitgeber, sondern hatte diese Eigenschaft lange vor dem Widerspruch am 1. Dezember 2008 durch den Betriebsübergang von V auf T - an V - verloren.
- 7 -
2. Dem entspricht die Gesetzesbegründung (BT-Drs. 14/7760 S. 20) für das Widerspruchsrecht. Mit der Würde des Menschen, dem Recht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit und dem Recht auf freie Arbeitsplatzwahl (Art. 1, 2 und 12 GG) wäre es unvereinbar, wenn ein Arbeitnehmer verpflichtet würde, für einen Arbeitgeber zu arbeiten, den er nicht frei gewählt hatte (BAG 22. April 1993 - 2 AZR 50/92 -; EuGH 16. Dezember 1992 - C-132/91, C-138/91, C-139/91 - [Katsikas ua.] Rn. 32, Slg. 1992, I-6577). Im Zeitpunkt des Widerspruchs konnte jedoch die Würde des Klägers nicht mehr dadurch beeinträchtigt werden, dass er für die V zu arbeiten hatte, die er nicht frei gewählt hat. Denn die Arbeitspflicht des Klägers für die V bestand nur bis zum 30. November 2008, ab 1. Dezember 2008 besteht sie gegenüber der T infolge des weiteren Betriebsübergangs. Gegen diesen neuen Betriebsinhaber als Partei seines Arbeitsvertrages hat sich der Kläger nie mit einem Widerspruch gegen den Übergang seines Arbeitsverhältnisses gewendet.
3. Auch systematische Überlegungen führen zu dem Ergebnis, dass der Widerspruch nur gegenüber dem „bisherigen“ Inhaber oder „dem neuen Inhaber“, den letzten Übergang des Arbeitsverhältnisses betreffend, erklärt werden kann, nicht jedoch gegenüber vormaligen Arbeitgebern oder alten Inhabern wegen früherer Betriebsübergänge.
a) Nach ständiger Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts und der herrschenden Auffassung im Schrifttum ist das Widerspruchsrecht nach § 613a Abs. 6 BGB ein Gestaltungsrecht in Form eines Rechtsfolgenverweigerungsrechts (vgl. zuletzt BAG 16. April 2013 - 9 AZR 731/11 - Rn. 29; 6. Juli 2011 - 4 AZR 501/09 - Rn. 80; 2. April 2009 - 8 AZR 178/07 - Rn. 28; 19. Februar 2009 - 8 AZR 176/08 - Rn. 22 mwN, BAGE 129, 343). Gestaltet werden kann nur ein bestehendes Rechtsverhältnis, dh. das Arbeitsverhältnis, das bei Ausübung des Widerspruchs besteht. Im Falle des Widerspruchs durch den Kläger war das das Arbeitsverhältnis mit T. Mit V war er nur noch als „bisherigem Arbeitgeber“ verbunden. Dagegen bestand das vormalige Arbeitsverhältnis des Klägers mit V zum Zeitpunkt des Widerspruchs nicht mehr, es war nicht mehr „gestaltungsfähig“. Mit anderen Worten: Der Kläger konnte einen Widerspruch
- 8 -
an die V nur wegen ihrer Eigenschaft als „bisherige Arbeitgeberin“ richten, dann hätte dies aber den Übergang seines Arbeitsverhältnisses von V auf T betroffen. Die V als „neuen Inhaber“ oder die Beklagte als „früheren Arbeitgeber“ mit der Ausübung eines Gestaltungsrechts zu konfrontieren geht ins Leere, weil die vormalige Rechtsbeziehung des Klägers nach dem Betriebsübergang auf T nicht mehr besteht. Zudem müssen Gestaltungsrechte so ausgeübt werden, dass dem Gebot der Rechtsklarheit Geltung verschafft wird. Nicht ausgeübte und damit obsolet gewordene Gestaltungsrechte unabhängig von einem gestaltungsfähigen Rechtsverhältnis wieder aufleben zu lassen, bedeutete das Gegenteil von Rechtsklarheit.
b) Der Senat hat bereits darauf hingewiesen, dass das Widerspruchsrecht als Gestaltungsrecht in Form eines Rechtsfolgenverweigerungsrechts durch Erklärung des Widerspruchs vorrangig inhaltlich zum Ausdruck bringt, dass der Arbeitnehmer nicht zum neuen Inhaber mit dem Arbeitsverhältnis wechseln will. Diesen Unwillen zu wechseln kann er auch gegenüber dem bisherigen Arbeitgeber erklären, ohne damit zugleich zum Ausdruck zu bringen, dass er hinsichtlich eines vorausgegangenen ersten Betriebsübergangs einen Widerspruch nicht mehr erklären wird (BAG 26. Mai 2011 - 8 AZR 18/10 - Rn. 35). Hat der Kläger mit dem am 27. Januar 2012 erklärten Widerspruch somit gesagt: „Ich will nicht zur V wechseln“, so ging diese Erklärung ins Leere, denn der Kläger ist am 27. Januar 2012 schon längst nicht mehr bei der V, sondern seit dem 1. Dezember 2008 bei T beschäftigt, § 613a Abs. 1 Satz 1 BGB. Gegen diesen Übergang seines Arbeitsverhältnisses hat er einen Widerspruch nicht erklärt. Ob der Kläger, hätte er dem Übergang seines Arbeitsverhältnisses auf T widersprochen und wäre ein solcher Widerspruch wirksam gewesen, danach und noch wirksam einen Widerspruch gegen den Übergang seines Arbeitsverhältnisses von der Beklagten auf V hätte erklären können, ist vorliegend nicht zu entscheiden. Der Senat hat zwar in ständiger Rechtsprechung entschieden, dass neuer und alter Arbeitgeber sich wechselseitig auf die Kenntnis des anderen vom Arbeitnehmerverhalten berufen können, eine nachgewiesene subjektive Kenntnis des in Anspruch genommenen Verpflichteten von einem bestimmten Arbeitnehmerverhalten dagegen nicht erforderlich ist, wenn feststeht, dass
- 9 -
dieses Verhalten wenigstens dem anderen Verpflichteten bekannt geworden ist (BAG 27. November 2008 - 8 AZR 174/07 - Rn. 35, BAGE 128, 328). Der Senat hat es aber ausdrücklich offen gelassen, ob und inwieweit dies gilt, wenn Dritte, etwa ein weiterer Betriebserwerber oder ein Insolvenzverwalter in die Arbeitgeberstellung einrücken und sich im Verhältnis zu diesen Verwirkungsumstände ergeben (BAG 27. November 2008 - 8 AZR 174/07 - Rn. 36, aaO). Die gesetzliche Gestaltung des Widerspruchsrechts deutet zumindest darauf hin, dass es bei dem Gesamtschuldverhältnis zwischen Betriebsveräußerer und Betriebserwerber hinsichtlich der gemeinsamen Unterrichtungspflicht nach § 613a Abs. 5 BGB bleiben soll.
4. Das entspricht dem europäischen Recht. Der EuGH hat in ständiger Rechtsprechung klargestellt, dass Art. 3 Abs. 1 der Richtlinie 77/187/EWG des Rates vom 14. Februar 1977 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedsstaaten über die Wahrung von Ansprüchen der Arbeitnehmer beim Über-gang von Unternehmen, Betrieben oder Betriebsteilen so auszulegen ist, dass der Fortsetzung des Arbeitsvertrages oder des Arbeitsverhältnisses eines zum Zeitpunkt des Unternehmensübergangs iSd. Art. 1 Abs. 1 der Richtlinie vom Veräußerer beschäftigten Arbeitnehmers durch den Erwerber nicht entgegen-steht, wenn dieser Arbeitnehmer beim Übergang seines Arbeitsvertrages oder Arbeitsverhältnisses auf den Erwerber widerspricht (EuGH 24. Januar 2002 - C-51/00 - [Temco] Rn. 37, Slg. 2002, I-969). Es ist Sache der Mitgliedsstaaten zu bestimmen, was in einem solchen Fall mit dem Arbeitsvertrag oder dem Arbeitsverhältnis zwischen dem Veräußerer und dem Widersprechenden geschieht (EuGH 7. März 1996 - C-171/94 und C-172/94 - [Merckx, Neuhuys], Slg. 1996, I-1253; 16. Dezember 1992 - C-132/91, C-138/91, C-139/91 - [Katsikas ua.] Slg. 1992, I-6577). Das europäische Recht schreibt zwar ein Recht zum Widerspruch nicht vor, steht aber einer nationalen Regelung nicht entgegen, wenn die Arbeitnehmer „beim Übergang des Arbeitsvertrages oder Arbeitsverhältnisses auf den Erwerber“ widersprechen. Auch die Richtlinie behandelt nur Arbeitnehmer, die „zum Zeitpunkt des Unternehmensübergangs“ beim Veräußerer beschäftigt sind.
- 10 -
II. Da der vom Kläger erklärte Widerspruch gegen den Übergang seines Arbeitsverhältnisses von der Beklagten auf V unbeachtlich ist, kommt es auf die Frage, ob und wodurch der Kläger den erklärten Widerspruch verwirkt haben könnte, nicht an.
C. Die Kostenentscheidung beruht auf § 97 ZPO.
Hauck
Breinlinger
Winter
R. Kandler
F. Avenarius
Weitere Auskünfte erteilen Ihnen gern:
 |
Dr. Martin Hensche Rechtsanwalt Fachanwalt für Arbeitsrecht Kontakt: 030 / 26 39 620 hensche@hensche.de |
 |
Christoph Hildebrandt Rechtsanwalt Fachanwalt für Arbeitsrecht Kontakt: 030 / 26 39 620 hildebrandt@hensche.de |
 |
Nina Wesemann Rechtsanwältin Fachanwältin für Arbeitsrecht Kontakt: 040 / 69 20 68 04 wesemann@hensche.de |