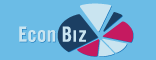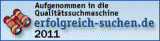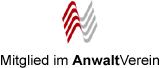- -> zur Mobil-Ansicht
- Arbeitsrecht aktuell
- Tipps und Tricks
- Handbuch Arbeitsrecht
- Gesetze zum Arbeitsrecht
- Urteile zum Arbeitsrecht
- Urteile 2023
- Urteile 2021
- Urteile 2020
- Urteile 2019
- Urteile 2018
- Urteile 2017
- Urteile 2016
- Urteile 2015
- Urteile 2014
- Urteile 2013
- Urteile 2012
- Urteile 2011
- Urteile 2010
- Urteile 2009
- Urteile 2008
- Urteile 2007
- Urteile 2006
- Urteile 2005
- Urteile 2004
- Urteile 2003
- Urteile 2002
- Urteile 2001
- Urteile 2000
- Urteile 1999
- Urteile 1998
- Urteile 1997
- Urteile 1996
- Urteile 1995
- Urteile 1994
- Urteile 1993
- Urteile 1992
- Urteile 1991
- Urteile bis 1990
- Arbeitsrecht Muster
- Videos
- Impressum-Generator
- Webinare zum Arbeitsrecht
-
Kanzlei Berlin
 030 - 26 39 62 0
030 - 26 39 62 0
 berlin@hensche.de
berlin@hensche.de
AnfahrtDetails -
Kanzlei Frankfurt
 069 - 71 03 30 04
069 - 71 03 30 04
 frankfurt@hensche.de
frankfurt@hensche.de
AnfahrtDetails -
Kanzlei Hamburg
 040 - 69 20 68 04
040 - 69 20 68 04
 hamburg@hensche.de
hamburg@hensche.de
AnfahrtDetails -
Kanzlei Hannover
 0511 - 89 97 701
0511 - 89 97 701
 hannover@hensche.de
hannover@hensche.de
AnfahrtDetails -
Kanzlei Köln
 0221 - 70 90 718
0221 - 70 90 718
 koeln@hensche.de
koeln@hensche.de
AnfahrtDetails -
Kanzlei München
 089 - 21 56 88 63
089 - 21 56 88 63
 muenchen@hensche.de
muenchen@hensche.de
AnfahrtDetails -
Kanzlei Nürnberg
 0911 - 95 33 207
0911 - 95 33 207
 nuernberg@hensche.de
nuernberg@hensche.de
AnfahrtDetails -
Kanzlei Stuttgart
 0711 - 47 09 710
0711 - 47 09 710
 stuttgart@hensche.de
stuttgart@hensche.de
AnfahrtDetails
LAG Baden-Württemberg, Urteil vom 03.12.2014, 4 Sa 41/14
| Schlagworte: | Arbeitnehmerüberlassung: Scheinwerkvertrag, Leiharbeit: Scheinwerkvertrag, Scheinwerkvertrag | |
| Gericht: | Landesarbeitsgericht Baden-Württemberg | |
| Aktenzeichen: | 4 Sa 41/14 | |
| Typ: | Urteil | |
| Entscheidungsdatum: | 03.12.2014 | |
| Leitsätze: | ||
| Vorinstanzen: | Arbeitsgericht Stuttgart - 16 Ca 8713/13 | |
Ausfertigung
Landesarbeitsgericht Baden-Württemberg
Aktenzeichen:
4 Sa 41/14
16 Ca 8713/13 ArbG Stuttgart
(Bitte bei allen Schreiben angeben!)
Verkündet am 03.12.2014
Haupt
Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle
Im Namen des Volkes
Urteil
In der Rechtssache
- Kläger/Berufungskläger -
Proz.-Bev.:
gegen
- Beklagte/Berufungsbeklagte -
Proz.-Bev.:
hat das Landesarbeitsgericht Baden-Württemberg - 4. Kammer - durch den Vorsitzenden Richter am Landesarbeitsgericht Stöbe, den ehrenamtlichen Richter Dick und den ehrenamtlichen Richter Lux auf die mündliche Verhandlung vom 03.12.2014
für Recht erkannt:
1. Auf die Berufung des Klägers wird das Urteil des Arbeitsgerichts Stuttgart vom 08.04.2014 (16 Ca 8713/13) abgeändert.
Es wird festgestellt, dass zwischen den Parteien seit 20.05.2011 ein Arbeitsverhältnis besteht.
2. Die Beklagte hat die Kosten des Rechtsstreits zu tragen.
3. Die Revision wird für die Beklagte zugelassen.
- 2 -
Tatbestand
Die Parteien streiten darüber, ob zwischen ihnen seit 20.05.2011 ein Arbeitsverhältnis besteht, weil der Kläger seit diesem Zeitpunkt nur im Rahmen sogenannter „Scheinwerkverträge“ an die Beklagte überlassen war.
Der am XXX 1979 geborene, ledige und gegenüber keinen Kindern zum Unterhalt verpflichtete Kläger ist Entwicklungsingenieur. Er wurde von der Beklagten, einem Tochterunternehmen der D. AG, seit 20.05.2011 als sogenannte „Fremdarbeitskraft“ eingesetzt.
Für den Zeitraum 20.05.2011 bis 31.12.2012 hatte der Kläger einen Arbeitsvertrag mit der Firma E.D. GmbH (nachfolgend: E.) als Konstrukteur geschlossen. In dem schriftlichen Arbeitsvertrag vom 10.05.2011 (Anlage K1, Bl. 8-14 d. arbeitsgerichtl. Akte) lautete es auszugsweise:
„2. Aufgabenbereich
Der Arbeitnehmer wird als Konstrukteur für den Standort M. eingestellt.
.........
Das Arbeitsverhältnis bezieht sich auf eine Tätigkeit in M.. Der AG behält sich vor, den AN innerhalb des gesamten Unternehmens in Deutschland auch an einen anderen Ort zu versetzen.10. Arbeitnehmerüberlassung
Die Firma E. GmbH ist im Besitz einer unbefristet gültigen Erlaubnis zur gewerbsmäßigen Arbeitnehmerüberlassung, erteilt durch die Bundesagentur für Arbeit Regionaldirektion Ba-den-Württemberg, S. ab dem 17.02.09.Im Falle einer Arbeitnehmerüberlassung behält der AN sämtliche Ansprüche aus diesem Arbeitsvertrag. Die Bezugnahme auf den Tarifvertrag zwischen dem Bundesverband Zeitar-beit Personal-Dienstleistungen e.V. (BZA) und den Mitgliedsgewerkschaften des DGB in der jeweils gültigen Fassung wird vereinbart. Auf Verlangen bekommt der Arbeitnehmer den Ta-rifvertrag ausgehändigt.
- 3 -
Der AN wird darauf hingewiesen, dass er an verschiedenen Orten eingesetzt werden kann. Er ist damit einverstanden, dass er anderen Firmen zur Arbeitsleistung überlassen werden kann. Der räumliche Einsatzbereich wird dann eindeutig abgegrenzt und schriftlich mitgeteilt. Dem Leiharbeitnehmer wird ein Merkblatt für Leiharbeiter der Bundesagentur für Arbeit in der jeweiligen Muttersprache ausgehändigt.“
Dieses Arbeitsverhältnis wurde begründet, nachdem sich der Kläger mit dem Vorgesetzten der Firma E., Herrn F., beim künftigen Vorgesetzten des Klägers bei der Beklagten, Herr U., vorgestellt hatte und von diesem als geeignet befunden wurde.
Für den Zeitraum 01.01.2013 bis 30.09.2013 war der Kläger vertraglich angestellt bei der Firma B. T. GmbH (nachfolgend: B.) auf der Grundlage eines schriftlichen unbefristeten Arbeitsvertrages vom 29.10.2012 (Bl. 15-25 d. arbeitsgerichtl. Akte). Darin hieß es auszugsweise:
„§ 1 Beginn des Anstellungsverhältnisses, Vertragsdauer
1. Der Arbeitnehmer wird ab 01.01.2013 als Konstruktionsingenieur Omnibus eingestellt.
2. Das Anstellungsverhältnis wird auf unbestimmte Zeit abgeschlossen.§ 2 Einsatzorte, Aufgabengebiet
1. Der Arbeitnehmer hat die vertragsgemäße Arbeit am Sitz des Arbeitgebers oder am Sitz des Auftraggebers des Arbeitgebers zu verrichten. Damit ist der Einsatz an ver-schiedenen Orten verbunden. Der Arbeitnehmer hat keinen Anspruch auf einen be-stimmten Einsatzort.
.........
5. Wird der Arbeitnehmer am Sitz des Auftraggebers des Arbeitgebers eingesetzt, erfolgt dieser Einsatz stets dauerhaft.§ 14 Kompetenzübertragung
1. Die Kompetenzübertragung zeichnet sich dadurch aus, dass das Direktionsrecht des Arbeitgebers auf dessen Auftraggeber übertragen wird. Das allgemeine Direktionsrecht des Arbeitgebers bleibt hingegen unberührt.
2. Die Kompetenzübertragung erfolgt auf der Grundlage des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes.
- 4 -
3. Der Arbeitgeber hat von der Bundesagentur für Arbeit, Regionaldirektion Baden-Württemberg, S. am 19.10.2004 gemäß § 1 AÜG die Erlaubnis zur gewerbsmäßigen Arbeitnehmerüberlassung erhalten. Der Arbeitgeber verpflichtet sich, den Arbeitnehmer unverzüglich über den Wegfall der behördlichen Erlaubnis zu unterrichten; entsprechendes gilt für die Nichtverlängerung, die Rücknahme und den Widerruf der Er-laubnis.
4. Die Kompetenzübertragung richtet sich nach Tarifverträgen, und zwar nach den zwischen dem Bundesverband Zeitarbeit Personaldienstleistungen e.V. und der Tarifgemeinschaft des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) geschlossenen Tarifverträgen, derzeit bestehend aus Manteltarifvertrag (MTV), Entgeltrahmentarifvertrag (ERTV) und Entgelttarifvertrag (ETV) sowie etwaigen ergänzenden oder ersetzenden Tarifverträgen in deren jeweils gültiger Fassung. Diese Tarifverträge finden auch dann Anwendung, wenn der Arbeitnehmer nicht Mitglied einer Mitgliedsgewerkschaft des DGB ist. Die jeweils gültigen Tarifverträge sind zur Einsichtnahme beim Arbeitgeber ausgelegt.
...........“
Ab 01.10.2013 war der Kläger angestellt bei der Firma e. e. AG (nachfolgend: E.E.). Auf der Grundlage eines schriftlichen Arbeitsvertrages vom 02.09.2013 (Bl. 26-32 d. arbeitsgerichtl. Akte). In diesem Arbeitsvertrag hieß es auszugsweise:
„Präambel
Die e.e. AG ist eine Ingenieurgesellschaft und bearbeitet für nationale wie internationale Kundenunternehmen Projekte aus allen technischen Fachbereichen. Das Leistungsspektrum der e.e. AG erstreckt sich dabei über die Konzeption, Entwicklung/Konstruktion und Dokumentation, Versuch und Berechnung bis hin zum Prototyping und Projektmanagement.1. Tätigkeit
Die vom Bundesverband Zeitarbeit Personaldienstleistungen e.V. (BZA) mit den Mitgliedern der Tarifgemeinschaft des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) .......... abgeschlosse-nen ........... Tarifverträge finden auf das Arbeitsverhältnis in der jeweils geltenden Fassung und im Falle der Nachwirkung Anwendung.
..........
- 5 -
Mit Abschluss dieses Arbeitsvertrages wird der Mitarbeiter als Entwicklungsingenieur für ee tätig. Das Arbeitsgebiet des Mitarbeiters erstreckt sich auf das Leistungsspektrum von ee wie in der Präambel beschrieben.
............
Der Mitarbeiter unterliegt den Weisungen von ee über Inhalt, Umfang und Einteilung der in den Geschäftsräumen von ee oder einem Kunden von ee zu verrichtenden Tätigkeiten in folgendem Vertragsgebiet: Bundesrepublik Deutschland.
............8. Projektbearbeitung im Rahmen der Arbeitnehmerüberlassung
Soweit wegen betrieblicher Erfordernisse eine Projektbearbeitung im Kundenbetrieb im Rahmen des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes erfolgen muss, verpflichtet sich der Mitar-beiter, in dem jeweiligen Kundenbetrieb unter fachlicher Aufsicht und fachlicher Weisung des Kunden tätig zu werden.
........
Die gesetzliche Erlaubnis zum Abschluss von Arbeitnehmerüberlassungsverträgen gemäß § 1 des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes wurde ee am 25.11.1994 erteilt. Die zuständige Erlaubnisbehörde ist die Regionaldirektion Baden-Württemberg der Bundesagentur für Arbeit in S..“
Im Betrieb der Beklagten war der Kläger tätig bis 16.05.2014 als der Kläger von der Beklagten „abbestellt“ wurde. Das Arbeitsverhältnis des Klägers wurde daraufhin von der E.E. gekündigt.
Alle drei Vertragsarbeitgeber des Klägers sind im Besitz einer Arbeitnehmerüberlassungserlaubnis, die schon jeweils vor 2011 erteilt wurde.
Dem Einsatz des Klägers als Fremdarbeitskraft im Betrieb der Beklagten lagen „Einkaufsabschlüsse“ genannte Rahmenverträge der Konzernmutter D. AG (Anlage B1, Bl. 189-210 und Anlage B8, Bl. 222-232 d. arbeitsgerichtl. Akte) zugrunde. In diesen „Einkaufsabschlüssen“ wurden die zu erbringenden Leistungen größtenteils als im Werkvertrag zu erbringende Leistungen beschrieben. Die festgeschriebenen Preise für die Dienstleistungen hatten jeweils einen festgelegten Gültigkeitszeitraum. Die abzunehmende Quote/Menge an Dienstleistungen wurde größtenteils mit „Ges./nach Bedarf“ beschrieben.
- 6 -
Der Kläger übte seine Tätigkeiten durchgehend im Werk M. der Beklagten aus im Bau 10, 1. Obergeschoss, Raum 205. Es handelt sich um ein Großraumbüro, in welchem das Team „Innen-ausstattung“ untergebracht ist, welches aus eigenen Mitarbeitern der Beklagten besteht, sowie aus Fremdarbeitskräften diverser Drittunternehmen. Die Arbeitsplätze der Fremdarbeitskräfte sind als solche beschildert. Im Organigramm der Beklagten (Anlage K6, Bl. 36 d. arbeitsgerichtl. Akte) wurden sowohl die eigenen Arbeitskräfte der Beklagten als auch die Fremdarbeitskräfte namentlich benannt.
Der Kläger wurde weitestgehend mit der Bearbeitung von Kundensonderwünschen betreffend Deckenabhängungen betraut, aber auch im Bereich der Neuentwicklungen und der Konstruktion diverser Bauteile der Serienfertigung für die Modelle X. XX und XX.
Im Rahmen der Auftragserfüllungen arbeitete der Kläger ausschließlich mit Betriebsmitteln der Beklagten. Dem Kläger wurden sämtliche Berechtigungen erteilt, um mit den Systemen der Beklagten zu kommunizieren. Die Konstruktionen erfolgten auf den Konstruktionsprogrammen der Beklagten, zu denen der Kläger, beschränkt auf Konstruktions- und Entwicklungsleistungen, ebenfalls volle Zugangsberechtigung hatte.
Die täglich zu bearbeitenden Arbeitsaufgaben wurden von den jeweiligen Fachabteilungen direkt in das SAP-System eingegeben unter namentlicher Zuordnung an den Kläger. Die Arbeitsaufgaben wurden darin genau beschrieben. Diese Aufgabenzuweisungen wurden vom Kläger direkt über das SAP-System der Beklagten abgerufen. Der Kläger musste sodann anhand der mitgeteilten Kundensonderwünsche entsprechende Zeichnungen fertigen und geänderte Produktionsparameter in die Systeme der Beklagten einarbeiten. Der Kläger musste Detailkonstruktionen festlegen, Stücklisten erstellen und vorschlagen, welche Teile noch haben beschafft werden müssen. Die Prüfung und die Freigabe erfolgte durch Vorgesetzte der Beklagten. Die Aufgabenerledigung war vom Kläger in das SAP-System der Beklagten einzugeben und dort zu dokumentieren. Auf die Auflistung der täglichen einzelnen Arbeitsaufgaben zwischen 21.07.2011 bis 27.09.2013 (An-lagenkonvolut K14, Bl. 57-76 d. arbeitsgerichtl. Akte) und die einzelnen Aufgabenbeschreibung (Anlage K5, Bl. 77-99 d. arbeitsgerichtl. Akte) wird Bezug genommen.
- 7 -
Der Kläger nahm bei der Beklagten an diversen Schulungsmaßnahmen sowohl betreffend die bei der Beklagten angewandten EDV-Systeme und Programme (SAP-ZKSW, CATIA V5), als auch betreffend die bei der Beklagten einzuhaltenden Arbeitsweisen teil. Insoweit wird Bezug genom-men auf die Teilnahmebestätigungen (Anlage K5, Bl. 34-35 d. arbeitsgerichtl. Akte) und die Schu-lungsunterlagen zum Arbeitsweisenkurs (Anlage K20, Bl. 243-261). Zur Teilnahme an diesen Kur-sen wurde der Kläger vom Teamvorgesetzten der Beklagten Herrn U. angemeldet (vgl. Anlage K19, Bl. 242).
Bei der Beklagten wurde über den gesamten Zeitraum der Beschäftigung des Klägers ein Ur-laubskalender (Anlage K8, Bl. 52 d. arbeitsgerichtl. Akte) geführt, der bezogen auf die Abteilung Innenausstattung sowohl die eigenen Mitarbeiter der Beklagten als auch die sogenannten Fremdarbeitskräfte aufführte. Insbesondere für Brückentage und Tage der Betriebsruhe wurden die Fremdarbeitskräfte vom Vorgesetzten Herrn U. per E-Mail (Anlagen K10, 12 und 13, Bl. 53, 55 bis 56 d. arbeitsgerichtl. Akte) angewiesen, Urlaub zu nehmen. Außerdem gab es zum Beispiel Anweisungen per Eilumlauf an die Fremdarbeitskräfte (Anlage K11, Bl. 54 d. arbeitsgerichtl. Akte), ihre Resturlaubstage und Gleitzeitstunden in eine Liste einzutragen.
Der Kläger meinte, die gesamte Abwicklung lasse nur darauf schließen, dass er bei der Beklagten betrieblich eingegliedert war und den Weisungen der Beklagten unterstanden habe. Tatsächlich sei der Kläger im Rahmen einer Arbeitnehmerüberlassung beschäftigt worden. Die Überlassungen seien zum Einen schon wegen Verstoß gegen § 12 AÜG formnichtig, im Übrigen aber auch deshalb unwirksam, weil sie nicht nur vorübergehend, sondern auf Dauer angelegt gewesen seien. Im Übrigen sei die Arbeitnehmerüberlassung bewusst verdeckt erfolgt, um den über das AÜG vermittelten Sozialschutz der Fremdarbeitskräfte zu umgehen. Die Berufung auf die bestehenden Arbeitnehmerüberlassungserlaubnisse sei unzulässig. Die Beklagte betreibe institutionellen Rechtsmissbrauch. Der Kläger stehe bei der Beklagten entweder schon kraft betrieblicher Einglie-derung in einem Arbeitsverhältnis, jedenfalls aber über die Regelungen der §§ 9 Nr. 1, 10 Abs. 1 Satz 1 AÜG, direkt oder analog.
Der Kläger hat beantragt:
1. Es wird festgestellt, dass zwischen den Parteien ein Arbeitsverhältnis seit dem 20. Mai 2011 besteht.
- 8 -
2. Hilfsweise: Es wird festgestellt, dass zwischen den Parteien ein Arbeitsverhältnis besteht.
Die Beklagte hat beantragt,
die Klage abzuweisen.
Sie meinte, es läge keine Arbeitnehmerüberlassung vor. Von einer Eingliederung oder Weisungs-abhängigkeit könne keine Rede sein.
Den Mitarbeitern der Beklagten und des Teams sei die Zuordnung des Klägers zu einem Fremdunternehmen stets bewusst gewesen. Soweit überhaupt von einem Team die Rede sein könne, habe es sich allenfalls um eine räumliche Zuordnung gehandelt. So sei auch das Organigramm (Anlage K6) zu verstehen. Dieses habe lediglich einen Überblick verschaffen sollen, wer an welchen Kundensonderwünschen in welchem Abschnitt gearbeitet habe. Die Beklagte habe insbe-sondere keinen Einfluss auf die Personalauswahl der Werkvertragspartner gehabt. Deshalb habe es auch keine „Zuweisungen“ gegeben. Lediglich die speziellen Fachkenntnisse der eingesetzten Mitarbeiter hätten die längeren Einsatzdauern ohne Wechsel bedingt.
Die Einbindung in die Kommunikations- und EDV-Systeme sei nur im Rahmen der vertraglichen Aufgabenerfüllung erfolgt. Selbiges gelte für die Nutzung der Betriebsmittel der Beklagten überhaupt. Denn ohne Dokumentation und Kommunikation mit projektbeteiligten Mitarbeitern der Beklagten sei eine Leistungserbringung für die Beklagte nicht möglich. Die Beklagte könne die Ergebnisse der Fremdarbeitskräfte auch nur weiterverarbeiten, wenn sie über ihre Systeme erbracht und erklärt würden. Daraus erkläre sich auch die Notwendigkeit der Schulungsmaßnahmen. Die Beklagte arbeite überwiegend mit standardisierten hauseigenen Programmen. Andere Möglichkeiten, die spezifischen Besonderheiten zu erlernen, gebe es nicht. Ohne diese Systemkenntnisse sei eine Leistungserbringung nicht möglich. Im Übrigen hätten die jeweiligen Vertragsarbeitgeber die Kosten der Schulungen übernommen. Die Namensnennungen bei den Dokumentationen der Auftragserledigungen seien erforderlich gewesen für die Zuordnung der Zuständigkeiten in Fällen von notwendigen Rückfragen.
- 9 -
Die Auftragsvergaben seien unter Zuordnung zu den Rahmenverträgen erfolgt. Die Beklagte habe keinen Einfluss darauf gehabt, welche Personen die Leistungen erbracht haben. Die Namensnennungen bei den Aufträgen lägen im System begründet. Im SAP-System könne ein Auftragszugang nur über einen namentlich zugeordneten Account erfolgen. Dies sei jedoch keine willentliche und wissentliche persönliche Auftragszuweisung an bestimmte Fremdarbeitskräfte. Die technische Leistungsbeschreibung sei Gegenstand der Rahmenvereinbarungen.
Die Führung eines Urlaubskalenders sei nicht Ausdruck von Weisungen gewesen. Die Erbringung von Werkleistungen durch Ingenieure sei eben geprägt von Termineinhaltungen. Dies bedürfe einer Abstimmung von Urlaubszeiten, um Probleme zu verhindern. In Zeiten der Betriebsruhe haben externe Dienstleister keinen Zugang zu den Betriebsräumlichkeiten der Beklagten. Diese müssten dann eben auch Urlaub nehmen.
In rechtlicher Hinsicht berief sich die Beklagte hauptsächlich darauf, dass die Vertragsarbeitgeber des Klägers jedenfalls über eine Arbeitnehmerüberlassungserlaubnis verfügt hätten, was eine Anwendung von §§ 9 Nr. 1, 10 Abs. 1 Satz 1 AÜG verhindere.
Das Arbeitsgericht hat die Klage mit Urteil vom 08.04.2014 abgewiesen. Das Arbeitsgericht ließ die Frage, ob der Kläger tatsächlich im Rahmen einer Arbeitnehmerüberlassung tätig wurde, dahinstehen. Es führte zur Begründung aus, ein Arbeitsverhältnis zwischen den Parteien sei nicht durch Vertrag begründet worden, auch nicht konkludent. Der Vertragswille sei von Anfang an auf ein Dreiecksverhältnis angelegt gewesen. Ein Arbeitsverhältnis sei auch nicht über §§ 9 Nr. 1, 10 Abs. 1 Satz 1 AÜG begründet worden, da die Vertragsarbeitgeber über eine Arbeitnehmerüberlassungserlaubnis verfügt hätten, die weder auf eine nur vorübergehende Überlassung, noch auf eine nur offene Arbeitnehmerüberlassung beschränkt gewesen sei. Auch eine verdeckte Arbeit-nehmerüberlassung werde entsprechend dem Rechtsgedanken des § 117 Abs. 2 BGB von der Erlaubnis erfasst. Eine analoge Anwendung von §§ 9 Nr. 1, 10 Abs. 1 Satz 1 AÜG käme mangels planwidriger Regelungslücke nicht in Betracht. Es bestehe im Übrigen auch keine Vergleichbarkeit zwischen dem nicht nur vorübergehend überlassenen Arbeitnehmer und dem ohne Erlaubnis überlassenen Arbeitnehmer. Eine Begründung eines Arbeitsverhältnisses zur Beklagten komme auch über eine unionsrechtskonforme Auslegung der §§ 9 Nr. 1, 10 Abs. 1 Satz 1 AÜG nicht in Betracht. Artikel 10 Abs. 2 Satz 2 der RL 2008/104/EG sehe keine eigenen Sanktionen vor, son-
- 10 -
dern überlasse die Auswahl den Mitgliedsstaaten. Es kämen neben der Begründung eines Arbeitsverhältnisses auch noch diverse andere Sanktionen für einen Richtlinienverstoß in Betracht. Die Auswahl müsse dem Gesetzgeber überlassen bleiben. Das Vorgehen der Beklagten stelle auch keinen institutionellen Rechtsmissbrauch dar. Es handele sich nicht um eine treuwidrige Ausnützung an sich Erlaubten. Der Kläger möchte vielmehr an sich Verbotenes sanktioniert wissen, obwohl der Gesetzgeber eine solche Sanktion nicht vorgesehen habe. Dies sei unzulässig. Das gelte auch für die verdeckte Arbeitnehmerüberlassung.
Dieses Urteil wurde der Klägerseite am 22.04.2014 zugestellt. Hiergegen richtet sich die vorlie-gende Berufung des Klägers, die am 22.05.2014 beim Landesarbeitsgericht einging und die in-nerhalb der bis 18.07.2014 verlängerten Begründungsfrist am 18.07.2014 begründet wurde.
Der Kläger rügt im Wesentlichen eine Verletzung materiellen Rechts.
Er meint, das Arbeitsgericht habe übersehen, dass die Überlassungsverträge wegen Verstoßes gegen das Schriftformerfordernis des § 12 AÜG nichtig seien. Die Eingliederung des Klägers bei der Beklagten habe somit keine rechtliche Grundlage gehabt. Deshalb müsse alleine schon die Eingliederung bei weisungsabhängiger Tätigkeit zur Begründung eines Arbeitsverhältnisses bei der Beklagten führen.
Außerdem meint der Kläger, sein Einsatz bei der Beklagten sei nicht durch die Arbeitnehmerüberlassungserlaubnis seiner Vertragsarbeitgeber gedeckt gewesen. Denn die Erlaubnisse deckten nur Überlassungen, in denen die Vertragspartner eine Arbeitnehmerüberlassung auch haben durchführen wollen. Dies ergebe sich bereits aus dem Wortlaut des § 1 Abs. 1 AÜG. Damit der Entleiher sich auf die Erlaubnis des Verleihers berufen könne, bedürfe es erst einmal eines Vertrages, der den Regelungen des AÜG folgt nach § 12 AÜG. Daraus folge, dass zu überprüfen sei, ob die generelle Erlaubnis überhaupt eine konkrete Überlassung erfasse oder ob diese evident außerhalb des Regelungskonzepts des AÜG durchgeführt worden sei. Gebe es weder einen Leiharbeitsvertrag, noch einen Überlassungsvertrag, so liege ein Rechtsverhältnis vor, das außerhalb des AÜG gestaltet worden sei und auch so hat gestaltet werden sollen.
Der Kläger sieht auch einen institutionellen Rechtsmissbrauch. Der Fall läge anders als der, über den das BAG mit Urteil vom 10.12.2013 (BAG 10. Dezember 2013 - 9 AZR 51/13 - AP AÜG § 1 Nr.
- 11 -
34) entschieden habe. Im BAG-Fall habe der Verleiher offen von der Erlaubnis Gebrauch gemacht. Vorliegend sei jedoch die Überlassung verdeckt erfolgt mit dem Ziel, sich Vorteile bei betriebsverfassungsrechtlichen Regelungen zu verschaffen und die Grundsätze des equal pay/equal treatment zu umgehen. Dies sei ein gezielter Rechtsmissbrauch, dessen Ahndung über Art. 5 Abs. 5 RL 2008/104/EG zu ahnden sei. Gegebenenfalls sei über § 242 BGB eine analoge Anwendung von § 10 Abs. 1 Satz 1 AÜG in Betracht zu ziehen.
Klageerweiternd macht der Kläger in der Berufungsinstanz hilfsweise noch einen Einstellungsanspruch nach § 4.1 des Tarifvertrags Leih-/Zeitarbeit geltend. Er trägt vor, die Beklagte habe durch seine betriebliche Ausgliederung zum 16.05.2014, somit vier Tage vor Anspruchsentstehung, bewusst den Eintritt der Anspruchsvoraussetzungen für einen tariflichen Einstellungsanspruch treu-widrig vereitelt, zumal der Rahmenvertrag mit der E.E. noch eine Laufzeit bis 31.12.2014 gehabt habe. Die Aufträge würden auch noch weiterbearbeitet, nur eben von einer anderen Fremdarbeitskraft.
Der Kläger beantragt:
Das Urteil des Arbeitsgerichts Stuttgart vom 8. April 2014 - 16 Ca 8713/13 - wird abgeändert.
1. Es wird festgestellt, dass zwischen den Parteien ein Arbeitsverhältnis seit dem 20. Mai 2011 besteht.
2. Hilfsweise:
Es wird festgestellt, dass zwischen den Parteien ein Arbeitsverhältnis besteht.3. Hilfsweise:
Die Beklagte wird verurteilt, dem Kläger den Abschluss eines unbefristeten Arbeitsvertrages anzubieten, aufgrund dessen der Kläger als Konstruktionsingenieur bei der Beklagten beschäftigt wird.
- 12 -
Die Beklagte beantragt,
die Berufung zurückzuweisen.
Sie verteidigt das arbeitsgerichtliche Urteil unter Wiederholung und Vertiefung ihres erstinstanzlichen Vorbringens.
In die (hilfsweise) Klageerweiterung erteilt sie keine Einwilligung, hält diese auch nicht für sachdienlich. Im Übrigen behauptet sie, der Kläger sei deshalb „abbestellt“ worden, da das Auftragsvolumen aus dem Werkvertrag mit der Firma E.E. vollständig abgerufen gewesen sei, der Vertrag somit beendet gewesen sei.
Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird gemäß § 64 Abs. 7 ArbGG iVm. § 313 Abs. 2 Satz 2 ZPO auf den Inhalt der zwischen den Parteien gewechselten Schriftsätze nebst Anlagen, sowie auf die Protokolle der mündlichen Verhandlungen verwiesen.
Es wurde Beweis erhoben durch Vernehmung des Zeugen Herr U.. Hinsichtlich des Inhalts dessen Zeugenaussage wird Bezug genommen auf das Protokoll der mündlichen Verhandlung vom 03.12.2014.
Entscheidungsgründe
Die statthafte, form- und fristgerecht eingelegte und auch im Übrigen zulässige Berufung ist begründet.
I.
Zwischen den Parteien gilt gemäß § 10 Abs. 1 Satz 1 AÜG ein Arbeitsverhältnis seit 20.05.2011 als zustande gekommen.
- 13 -
1. Der Kläger war bei der Beklagten seit 20.05.2011 entgegen den vertraglichen Bezeichnungen im Rahmen einer Arbeitnehmerüberlassung tätig.
a) Eine Überlassung zur Arbeitsleistung gem. § 1 Abs. 1 AÜG liegt vor, wenn einem Entleiher Arbeitskräfte zur Verfügung gestellt werden, die in dessen Betrieb eingegliedert sind und ihre Arbeit allein nach Weisungen des Entleihers und in dessen Interesse ausführen. Nach ständiger Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts ist nicht jeder drittbezogene Arbeitseinsatz eine Arbeitnehmerüberlassung im Sinne des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes. Diese ist vielmehr durch eine spezifische Ausgestaltung der Vertragsbeziehungen zwischen Verleiher und Entleiher einerseits (dem Arbeitnehmerüberlassungsvertrag) und zwischen Verleiher und Arbeitnehmer andererseits (dem Leiharbeitsvertrag) sowie durch das Fehlen einer arbeitsvertraglichen Beziehung zwischen Arbeitnehmer und Entleiher gekennzeichnet. Notwendiger Inhalt eines Arbeitnehmerüberlassungsvertrags ist die Verpflichtung des Verleihers gegenüber dem Entleiher, diesem zur Förderung von dessen Betriebszwecken Arbeitnehmer zur Verfügung zu stellen. Die Vertragspflicht des Verleihers gegenüber dem Entleiher endet, wenn er den Arbeitnehmer ausgewählt und ihn dem Entleiher zur Verfügung gestellt hat. Von der Arbeitnehmerüberlassung zu unterscheiden ist die Tätigkeit eines Arbeitnehmers bei einem Dritten aufgrund eines Werk- oder Dienstvertrags. In diesen Fällen wird der Arbeitnehmer für einen anderen tätig. Er organisiert die zur Erreichung eines wirtschaftlichen Erfolgs notwendigen Handlungen nach eigenen betrieblichen Voraussetzungen und bleibt für die Erfüllung der in dem Vertrag vorgesehenen Dienste oder für die Herstellung des geschuldeten Werks gegenüber dem Drittunternehmen ver-antwortlich. Die zur Ausführung des Dienst- oder Werkvertrags eingesetzten Arbeit-nehmer unterliegen den Weisungen des Unternehmers und sind dessen Erfüllungsgehilfen. Der Werkbesteller kann jedoch, wie sich aus § 645 Abs. 1 Satz 1 BGB ergibt, dem Werkunternehmer selbst oder dessen Erfüllungsgehilfen Anweisungen für die Ausführung des Werkes erteilen. Entsprechendes gilt für Dienstverträge. Solche Dienst- oder Werkverträge werden vom Arbeitnehmerüberlassungsgesetz nicht er-fasst. Über die rechtliche Einordnung des Vertrags zwischen dem Dritten und dem Arbeitgeber entscheidet der Geschäftsinhalt und nicht die von den Parteien gewünschte Rechtsfolge oder eine Bezeichnung, die dem tatsächlichen Geschäftsinhalt nicht ent-
- 14 -
spricht. Die Vertragsschließenden können das Eingreifen zwingender Schutzvorschriften des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes nicht dadurch vermeiden, dass sie einen vom Geschäftsinhalt abweichenden Vertragstyp wählen. Der Geschäftsinhalt kann sich sowohl aus den ausdrücklichen Vereinbarungen der Vertragsparteien als auch aus der praktischen Durchführung des Vertrages ergeben. Widersprechen sich beide, so ist die tatsächliche Durchführung des Vertrags maßgebend, weil sich aus der praktischen Handhabung der Vertragsbeziehungen am ehesten Rückschlüsse darauf ziehen lassen, von welchen Rechten und Pflichten die Vertragsparteien ausgegangen sind, was sie also wirklich gewollt haben. Der so ermittelte wirkliche Wille der Vertragsparteien bestimmt den Geschäftsinhalt und damit den Vertragstyp. Dies gilt allerdings nur dann, wenn die tatsächliche Durchführung von dem Willen der am Abschluss der vertraglichen Vereinbarung beteiligten Arbeitgeber umfasst war. Es kann daher auf die Kenntnis und zumindest die Billigung der auf beiden Seiten zum Vertragsabschluss berechtigten Person hinsichtlich einer vom schriftlichen Inhalt der Verträge abweichenden Vertragspraxis nicht verzichtet werden. Die Berücksichtigung der praktischen Vertragsdurchführung dient der Ermittlung des wirklichen Geschäftsinhalts, also dessen, was die Vertragsparteien wirklich gewollt haben. Die Vertragspraxis lässt aber nur dann Rückschlüsse auf den wirklichen Geschäftswillen der Vertragspartner zu, wenn die zum Vertragsabschluss berechtigten Personen die vom Vertragswortlaut abweichende Vertragspraxis kennen und sie zumindest billigen (BAG 15. April 2014 - 3 AZR 395/11 - juris; BAG 13. August 2008 - 7 AZR 269/07 - juris; LAG Baden-Württemberg 1. August 2013 - 2 Sa 6/13 - NZA 2013, 1017).
Die Darlegungs- und Beweislast für die Umstände, aus denen sich ergeben soll, dass es sich bei dem drittbezogenen Personalansatz um eine Arbeitnehmerüberlassung handelt, trägt diejenige Partei, die daraus für sich günstige Rechtsfolgen herleiten will, also der klagende Arbeitnehmer (LAG Baden-Württemberg 1. August 2013 aaO).
Ein Arbeitnehmer, der die vertraglichen Vereinbarungen zwischen seinem Vertragsarbeitgeber und dem Dritten nicht kennt, muss Tatsachen vortragen, die eine Würdigung rechtfertigen, wonach der Arbeitnehmer einem Entleiher zur Arbeitsleistung überlassen ist. Es ist dann Aufgabe des Entleihers, die Tatsachen darzulegen, die gegen das Vorliegen des Tatbestands aus § 1 Abs. 1 AÜG sprechen. Er genügt seiner Darle-
- 15 -
gungslast, wenn er die eine vertragliche Vereinbarung begründenden Tatsachen vorträgt. In diesem Fall ist es nunmehr Sache des Arbeitnehmers, die Kenntnis der auf Seiten der beteiligten Arbeitgeber handelnden und zum Vertragsabschluss berechtigten Personen von der tatsächlichen Vertragsdurchführung vorzutragen (BAG 15. April 2014 aaO; BAG 13. August 2008 aaO).
b) Vorliegend ergibt sich die betriebliche Eingliederung des Klägers in den Betrieb der Beklagten und dessen Weisungsgebundenheit bereits größtenteils aus dem unstreitigen Sachverhalt. Daran vermögen die anderweitigen Erklärungsversuche der Beklagten nichts zu ändern.
aa) Dies wird schon ersichtlich aus dem Arbeitsvertrag mit dem zweiten Überlasser, der Firma B.. Darin ist unter § 14 nämlich ausdrücklich ausgeführt, dass eine „Kompetenzübertragung“ stattfinde, die sich dadurch auszeichne, dass das Di-rektionsrecht des Arbeitgebers (B.) auf dessen Auftraggeber (die Beklagte) übertragen werde und diese „Kompetenzübertragung“ auf der Grundlage des AÜG stattfinde. Der Kläger wurde gemäß § 1.1 des Vertrags als Konstruktionsingenieur Omnibus eingestellt, wobei die Vertragsparteien unter § 2.5 regelten, dass bei einem Einsatz am Sitz des Auftraggebers, wie dies beim Kläger der Fall war, dieser Einsatz „stets dauerhaft“ sei. Aus diesen Vertragsregelungen ergibt sich, was letztlich auch tatsächlich gegenüber der Beklagten und durch die Beklagte praktiziert wurde, nämlich eine dauerhafte Überlassung des Klägers an die Beklagte und eine dauerhafte Unterstellung des Klägers unter das Direktionsrecht der Beklagten. Der Kläger wurde schlicht für einen dauerhaften betrieblichen Einsatz bei der Beklagten eingestellt.
bb) Diese Einstellung nur für die Beklagte ergibt sich auch aus dem erstmaligen Einstellungsvorgang bei der Firma E.. Der Kläger erschien mit dem Vertreter der Firma E., Herrn F., im Betrieb der Beklagten und hatte sich dort bei Herrn U., dem künftigen Vorgesetzen des Klägers bei der Beklagten, vorzustellen. Das Vorstellungsgespräch dauerte circa 45 Minuten. Nachdem der Kläger von Herrn U. für die Aufgaben bei der Beklagten als geeignet befunden wurde, wurde noch in der Kantine der Beklagten der Arbeitsvertrag zwischen dem Kläger und der Firma
- 16 -
E. unterschrieben. Herr U. räumte auch im Rahmen seiner Zeugenvernehmung ein, dass bei ihm grundsätzlich Vorstellungsgespräche mit Fremdarbeitskräften geführt würden, auch wenn er selbst sich an ein Vorstellungsgespräch mit dem Kläger nicht zu erinnern vermochte. Er wies zwar darauf hin, dass es sich hierbei nicht um klassische Vorstellungsgespräche für eine Einstellung bei der Beklagten gehandelt habe. Diese würden nämlich nur mit der Personalabteilung der Beklagten geführt werden. Jedoch würden Aufträge nur an solche Werkvertragspartner vergeben werden, bei denen man die Meinung habe, dass sie die Anforderungen auch bewerkstelligen könnten. Dafür würden die Werkvertragspartner ihre „Mannschaft“ auch mal vorstellen, um ihre Qualifikation für die Aufgabenstellungen nachweisen zu können. Erfolgt aber der Qualifikationsnachweis durch Vorstellung der einzustellenden „Mannschaft“ beim zuständigen Abteilungsleiter und Vorgesetzten, so wird daraus ersichtlich, dass es der Beklagten weniger auf den Werkvertragspartner ankam, sondern auf den Qualifikationsträger, nämlich den einzustellenden Arbeitnehmer, der die Aufgaben dann für die Beklagte erledigen sollte. Die einzustellenden Arbeitnehmer, hier der Kläger, wurden auf ihre Qualifikation für den Einsatz bei der Beklagten überprüft.
cc) Der Kläger war auch bei der Beklagten eingegliedert. Er arbeitete über drei Jahre immer in derselben Abteilung Innenausstattung. Er wurde ohne räumliche Trennung untergebracht im Großraumbüro des Team Innenausstattung, welches sich zusammensetzte aus etwa zur Hälfte eigenen Mitarbeitern der Beklagten und zur anderen Hälfte aus Fremdarbeitskräften. Die einzige Trennung, die erfolgte, bestand aus Schildern auf den Tischen, die auf den Status der Fremdarbeitskräfte hinwiesen. Jedoch wurde der Kläger voll in das betriebliche Kommunikationssystem der Beklagten eingebunden. Der Kläger hatte eine interne Telefonnummer und eine interne E-mail-Adresse. Dies alles vor dem Hintergrund, damit bei Rückfragen und bei Auftragsvergaben direkt mit dem Kläger kommuniziert werden konnte. Im Abteilungsorganigramm (Anlage K6) wurde ebenfalls keine Trennung zwischen eigenen Kräften und Fremdarbeitskräften vorgenommen. Die Fremdarbeitskräfte wurden darin namentlich benannt und nicht etwa neutral als Fremdarbeitskräfte eines bestimmten Werkvertragspartners. Der Er-
- 17 -
klärungsversuch der Beklagten hierzu, dass die namentliche Benennung haupt-sächlich Praktikabilitätsgründe gehabt habe, um die Zuständigkeiten, vor allem auch bei Rückfragen, erkennen zu können, bestätigt vielmehr die Eingliederung. Denn in einem klassischen Werkvertrag/Dienstvertrag erfolgen Rückfragen und Weisungen eben üblicherweise nicht über den Arbeitnehmer direkt, sondern über den Vertragspartner.
dd) Die Weisungsabhängigkeit des Klägers wird am deutlichsten ersichtlich aus der Art der Aufgabenzuweisung an den Kläger. Es ist gerade nicht so, dass die Beklagte ihren Werkvertragspartnern mitgeteilt hätte, welche Aufträge wann erledigt werden sollten und diesen die Organisation der Aufgabenerfüllung überlassen worden wäre. Vielmehr war der Kläger vollständig in das SAP-System der Beklagten eingegliedert. Er hatte die dafür erforderlichen Zugangsberechtigungen und Kennungen. Der Kläger war in diesem System namentlich erfasst. Die täglichen Aufgabenstellungen wurden jeweils direkt über das SAP-System dem Kläger zugeleitet, der diese auf seinem von der Beklagten gestellten PC abrief. Bei Aufgabenerledigungen waren diese wiederum vom Kläger direkt im SAP-System zu dokumentieren. Die Aufgabenzuweisung und -erfüllung wurde na-mentlich dokumentiert, um auch hier wieder die Zuständigkeit ausmachen zu können, vor allem für Rückfragen. Der Kläger erhielt seine Aufgabenzuweisung nicht zum Beispiel über ein Ticketsystem, bei dem über den Werkvertragspartner eine bestimmte Konstruktionszeichnung beauftragt wurde. Vielmehr erfolgten die Aufgabenzuweisungen terminlich eingetaktet im Produktionsprozess. Die Beklagte kann sich auch nicht darauf zurückziehen, dass die namentliche Einbindung des Klägers in das SAP-System systembedingt gewesen sei. Selbstverständlich ist ein EDV-System bei entsprechender Programmierung auch in der Lage fremdeingekaufte Dienstleistungen entsprechend abzubilden. Schwierig wird dies allenfalls dann, wenn - wie vorliegend - die Leistung vollständig eingetaktet in dem Produktionsprozess der Beklagten selbst erfolgen soll. Bloß liegt dann aber keine Weisungsfreiheit mehr vor.
ee) Nachvollziehbar ist, wenn die Beklagte vorträgt, dass die Arbeitsergebnisse für sie nur verwertbar seien, wenn sie über ihre hauseigenen Programme erstellt
- 18 -
werden, auch wenn das wiederum ein Indiz dafür ist, dass die vom Kläger abgeforderten Konstruktionsleistungen in einem von der Beklagten vorgegebenen vertakteten Produktionsprozess erfolgten. Dies bedingte dann auch den gebotenen Schulungsbedarf. Wie zu arbeiten ist bei der Beklagten, wurde dem Kläger insbesondere in einem „Arbeitsweisenkurs“ beigebracht, an dem der Kläger auf Anmeldung des Vorgesetzten der Beklagten Herrn U. teilzunehmen hatte. Unerheblich ist, ob die Beklagte sich die Kurskosten von den Werkvertragspartnern hat erstatten lassen. Es ist jedenfalls so, dass die Arbeitsprozesse nicht schon vertraglich „durchprogrammiert“ waren (siehe hierzu: Maschmann NZA 2013, 1305, 1309), sondern dass die Art, wie die Arbeitsabläufe stattzufinden hatten, von der Beklagten geschult wurde und vorgegeben wurde.
ff) In der Abteilung Innenausbau wurde ein Urlaubskalender geführt, in dem auch der Kläger und die anderen Fremdarbeitskräfte gelistet wurden. Zur Sicherung der Schichteinsatzplanungen forderte der Vorgesetzte Herr U. zum Beispiel den Kläger und die übrigen Fremdarbeitskräfte auch auf, Resturlaubstage und Gleitzeitstunden mitzuteilen. Es mag ja sein, wie die Beklagte einwandte, dass Ingenieurleistungen von Termineinhaltungen geprägt sind, die deshalb einer Abstimmung bedürfen. Letztlich ging es der Beklagten aber um nichts anderes als um eine Sicherstellung einer ausreichenden Personaldeckung auch während Urlaubszeiten. Aus Anlage K14 ergibt sich, dass der Kläger täglich zumeist mehrere Arbeitsaufträge erhalten hatte. Die „Terminseinhaltungen“ beschränkten sich somit in der Aufrechterhaltung der Eintaktung in den Produktionsprozess.
gg) Auch mag es sein, dass externe Kräfte während Zeiten der Betriebsruhe kein Zugangsrecht zum Betriebsgelände der Beklagten haben. Dies bedingt aber noch nicht das Recht der Beklagten, gegenüber dem Kläger anzuordnen, dass er für diese Tage Urlaub zu nehmen habe, wie über Herrn U. geschehen.
2. Die Folgen dieses „Scheinwerkvertragsverhältnisses“ hat das Arbeitsgericht im Wesentlichen zutreffend erkannt.
- 19 -
Das Arbeitsgericht führte zutreffend aus, dass zwischen den Parteien weder ausdrücklich, noch konkludent ein Arbeitsvertrag zustande gekommen ist. Es führte in Anlehnung an die Entscheidung des BAG vom 10.12.2013 (BAG 10. Dezember 2013 - 9 AZR 51/13 - AP AÜG § 1 Nr. 34) zutreffend aus, dass die Vertragsarbeitgeber des Klägers über Arbeitnehmerüberlassungserlaubnisse aus einer Zeit noch vor dem 01.12.2011 verfügten, die auch Dauerüberlassungen deckten, und die nicht auf offene Arbeitnehmerüberlassungen beschränkt waren. Eine analoge Anwendung der §§ 9 Nr. 1, 10 Abs. 1 Satz 1 AÜG, auch in gegebenen-falls europarechtskonformer Auslegung, scheidet schon deshalb aus, weil es an einer planwidrigen Regelungslücke fehlt und es vielmehr Aufgabe des Gesetzgebers und nicht der Rechtsprechung ist, ob und wie eine dauerhafte oder verdeckte Arbeitnehmerüberlassung sanktioniert werden soll. Ebenfalls zutreffend erkannt hat das Arbeitsgericht, dass ein institutioneller Rechtsmissbrauch nicht vorliegt, im Übrigen über diese Grundsätze Sanktionen auch nicht begründet werden könnten, die der Gesetzgeber bislang noch nicht vorgesehen hat. Insoweit wird zur Vermeidung von Wiederholungen auf die Ausführungen des Arbeitsgerichts unter Ziffer 2 der Entscheidungsgründe des arbeitsgerichtlichen Urteils Bezug genommen. Die Kammer macht sich diese Ausführungen gemäß § 69 Abs. 2 ArbGG ausdrücklich zu Eigen.
Nachfolgend soll deshalb nur auf die Angriffe der Berufung eingegangen werden und be-gründet werden, weshalb vorliegend trotz der Richtigkeit der oben benannten Grundsätze zwischen den Parteien ausnahmsweise dennoch ein Arbeitsverhältnis begründet wurde, weil sich die Beklagte und ihre Vertragspartner nach Treu und Glauben nicht auf die Arbeit-nehmerüberlassungserlaubnis der Vertragspartner berufen dürfen.
3. Entgegen der Auffassung des Klägers in der Berufung ist zwischen den Parteien ein Ar-beitsverhältnis durch Vertragsschluss nicht begründet worden.
a) Es gibt keinen ausdrücklichen Arbeitsvertragsschluss durch Abgabe korrespondieren-der Willenserklärungen. Ein solcher Vertragsschluss ist auch nicht durch Vertreter-handeln erfolgt. Es waren ausdrücklich nur Vertragsbeziehungen über das Dreieck begründet worden. Die Vertragsarbeitgeber des Klägers haben mit dem Kläger Arbeitsverträge im eigenen Namen und nicht namens der Beklagten schließen wollen.
- 20 -
b) Auch ein konkludenter Vertragsschluss liegt nicht vor.
Eine bloße Eingliederung ohne Vertrag führt nicht zu einem Arbeitsverhältnis (Deinert in Kittner/Zwanziger Arbeitsrecht 5. Aufl. § 2 Rn. 2).
Die Eingliederung selbst ist auch nicht Ausdruck eines konkludenten Vertragsbindungswillens der Beklagten. Die Beklagte wünschte vielmehr - auch für den Kläger erkennbar - eine Dreiecksbeziehung mit dem Dienstleistungsunternehmen als ihrem Vertragspartner. Vielmehr führt die Eingliederung der Arbeitnehmer in solchen Dreiecksbeziehungen gerade klassisch zur (verdeckten) Arbeitnehmerüberlassung und somit zum Anwendungsbereich des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes (LAG Baden-Württemberg 10. Oktober 2014 - 17 Sa 22/14).
4. Ein Arbeitsverhältnis zwischen den Parteien wurde entgegen der Auffassung des Klägers auch über §§ 9 Nr. 1, 10 Abs. 1 Satz 1 AÜG nicht deshalb begründet, weil ein wirksames Überlassungsverhältnis zwischen der Beklagten und ihren Vertragspartnern nicht vorlag.
Handelte es sich beim Einsatz des Klägers - wie vorliegend angenommen - tatsächlich um eine Arbeitnehmerüberlassung, so hätte das dieser Überlassung zugrundeliegende Vertragsverhältnis zwischen der Beklagten und ihren Vertragspartnern gemäß § 12 Abs. 1 Satz 1 AÜG der Schriftform bedurft. In der Vertragsurkunde wäre anzugeben gewesen, ob der Vertragspartner eine Arbeitnehmerüberlassungserlaubnis besitzt. Die Beklagte hätte die vorgesehenen Tätigkeiten beschreiben müssen und die dafür erforderlichen Qualifikationen, sowie die wesentlichen Arbeitsbedingungen der vergleichbaren Arbeitnehmer im Entleiherbetrieb. Eine solche Vertragsurkunde mit einem solchen Inhalt gibt es vorliegend nicht. Der Kläger hat deshalb Recht mit seinem Hinweis, dass die Vertragsverhältnisse zwischen der Beklagten und ihren sogenannten Werkvertragspartnern gemäß § 125 Satz 1 BGB nichtig sind.
Die Nichtigkeit erfasst nach dem Sinn und Zweck des Schriftformerfordernisses den gesam-ten Vertrag, einschließlich Nebenabreden. Folge dieser Nichtigkeit ist, dass keine Leistungspflichten im Verhältnis zwischen Verleiher und Entleiher entstanden sind. Erbrachte Leistungen wären nach Bereicherungsrecht rückabzuwickeln (Brors in Schürren/Hamann
- 21 -
AÜG 4. Aufl. § 12 Rn. 12; Ulber AÜG 4. Aufl. § 12 Rn. 36, 40). Die Leistungen des Arbeitnehmers selbst sind aber deswegen nicht rechtsgrundlos erbracht worden, sondern aufgrund der Verpflichtungen aus dem Arbeitsvertrag zwischen dem Arbeitnehmer und dem Verleiher. Die Nichtigkeit des Arbeitnehmerüberlassungsvertrags schlägt daher nicht auf den Arbeitsvertrag zwischen dem überlassenen Arbeitnehmer und dem Verleiher durch. Die Unwirksamkeit des Arbeitnehmerüberlassungsvertrages hat keine Auswirkungen auf den Arbeitsvertrag (Ulber AÜG 4. Aufl. § 12 Rn. 43).
Die Fiktion der Begründung eines Arbeitsverhältnisses gemäß § 10 Abs. 1 Satz 1 AÜG kann hier nicht angewendet werden. Sie greift nämlich nur, wenn der Verleiher keine Arbeitnehmerüberlassungserlaubnis hat, § 9 Nr. 1 AÜG, nicht aber schon, wenn der Arbeitnehmerüberlassungsvertrag aus sonstigen Gründen unwirksam ist. Es besteht auch keine vergleichbare Interessenslage zwischen dem Fall eines unwirksamen Arbeitnehmerüberlassungsvertrages mit dem Fall der Überlassung ohne Arbeitnehmerüberlassungserlaubnis. Denn im Falle der fehlenden Arbeitnehmerüberlassungserlaubnis ist schon kraft gesetzlicher Anordnung der Arbeitsvertrag gemäß § 9 Nr. 1 AÜG unwirksam. Es bedarf deshalb der gesetzlichen Fiktion des § 10 Abs. 1 Satz 1 AÜG, damit der betroffene Arbeitnehmer überhaupt in einem Arbeitsverhältnis steht. Ist aber der Arbeitsvertrag gar nicht von einer Un-wirksamkeit betroffen, bedarf es auch keines weiteren Schutzes des Arbeitnehmers durch fiktive Begründung eines (weiteren) Arbeitsverhältnisses (LAG Baden-Württemberg 10. Ok-tober 2014 - 17 Sa 22/14). Überlegenswert wäre diese Rechtsfolge allenfalls dann, wenn § 11 AÜG entsprechende Pflichten festlegen würde wie § 12 AÜG. Anders als § 12 AÜG für den Überlassungsvertrag begründet § 11 AÜG für den Leiharbeitsvertrag aber kein Schriftformerfordernis, sondern nur eine Nachweispflicht, wobei ein Verstoß gegen diese Nachweispflicht keine Unwirksamkeit des Arbeitsvertrages begründet.
5. Dem Arbeitsgericht ist insbesondere auch zuzustimmen, dass selbst über die Grundsätze des sogenannten institutionellen Rechtsmissbrauchs über § 242 BGB eine fiktive Begründung eines Arbeitsverhältnisses zwischen den Parteien nicht hergeleitet werden kann.
a) Ein solcher institutioneller Rechtsmissbrauch setzt voraus, dass ein Vertragspartner ein an sich zulässiges Gestaltungsmittel in einer mit Treu und Glauben unvereinbaren Weise nur dazu verwendet, sich zum Nachteil des anderen Vertragspartners Vorteile
- 22 -
zu verschaffen, die nach dem Zweck der Normen oder des Rechtsinstituts nicht vorgesehen sind (BAG 10. Dezember 2013 aaO; BAG 18. Juli 2012 - 7 AZR 443/09 - BAGE 142, 308).
b) Vorliegend geht es aber gar nicht um eine grundsätzlich zulässige Ausnutzung durch das Arbeitnehmerüberlassungsgesetz vorgesehene Rechte, sondern vielmehr um deren Verschleierung.
Hinzu kommt, dass selbst wenn man die Arbeitnehmerüberlassung wie eine unverschleierte, also offene Arbeitnehmerüberlassung behandeln müsste, entsprechend dem gesetzlichen Zweck des AÜG die Rechtsfolge jedenfalls nicht die fiktive Begründung eines Arbeitsverhältnisses zur Beklagten wäre. Denn bei einer offenen Arbeitnehmerüberlassung hätte der Kläger Ansprüche aus §§ 9 Nr. 1, 10 Abs. 1 Satz 1 AÜG auch nicht gehabt (LAG Baden-Württemberg 10. Oktober 2014 - 17 Sa 22/14). Dem Kläger wären allenfalls die Rechte auf equal pay/equal treatment einzuräumen gewesen. Der Betriebsrat der Beklagten wäre bei der Einstellung über § 99 Abs. 1 BetrVG zu beteiligen gewesen. Dafür bedürfte es aber des Umwegs über § 242 BGB nicht.
6. Das verschleiernde Verhalten der Vertragspartner der Überlassungsverträge stellt sich jedoch gegenüber dem Kläger dennoch als treuwidrig dar, weshalb es beiden Vertragspartnern der Überlassungsverträge wegen widersprüchlichen Verhaltens verwehrt sein muss, sich auf das Bestehen einer Arbeitnehmerüberlassungserlaubnis der Verleihunternehmen zu berufen, § 242 BGB. Dies hat das Arbeitsgericht nicht bedacht. Dies ist der Grund, weshalb das arbeitsgerichtliche Urteil abgeändert werden musste. Dürfen sich die Vertragsarbeitgeber des Klägers und die Beklagte trotz bestehender Arbeitnehmerüberlassungserlaubnisse der verleihenden Vertragsarbeitgebers nicht auf diese berufen, so erfolgte jedenfalls der konkrete als dauerhaft geplante Einsatz des Klägers bei der Beklagten ohne Vorliegen einer Arbeitnehmerüberlassungserlaubnis. Hatte aber der Verleiher im konkreten Verhältnis zum Kläger kein Recht zur Berufung auf die Arbeitnehmerüberlassungserlaubnis, so stellt sich der Arbeitsvertrag zwischen diesem und dem Kläger gemäß § 9 Nr. 1 AÜG als unwirksam dar. Folge ist dann die Fiktion der Begründung eines Arbeitsverhältnisses zur Beklagten als Entleiherin gemäß § 10 Abs. 1 Satz 1 AÜG.
- 23 -
a) Eine Rechtsausübung ist unzulässig, wenn sich der Ausübende in Widerspruch zu seinem früheren Verhalten setzt (venire contra factum proprium).
aa) Hierbei handelt es sich um eine Ausprägung des Vertrauensschutzes und des Gebots zur gegenseitigen Rücksichtnahme. Das Gebot zur gegenseitigen Rücksichtnahme verlangt, dass man die Folgen eines gesetzten Rechtsscheins zu tragen hat, wenn sich die Gegenseite darauf eingelassen hat (Staudinger BGB (2009) § 242 Rn. 288). Wann die Geltendmachung einer Rechtsposition als widersprüchlich zu bewerten ist, lässt sich nur durch eine Interessenabwägung im Einzelfall beurteilen (Staudinger BGB (2009) § 242 Rn. 291). Ein treuwidriges widersprüchliches Verhalten liegt vor allem dann vor, wenn sich eine Partei auf Rechtsvorschriften beruft, die sie selber zuvor missachtet hat (Staudinger BGB (2009) § 242 Rn. 300).
Zum Beispiel hat der BGH in einem Fall aus dem Kaufrecht einem Käufer die Berufung auf die ihn begünstigenden Vorschriften über den Verbrauchsgüterkauf verwehrt, da er, obwohl er Verbraucher war, sich den Kaufvertrag vom verkau-fenden Unternehmer, der zu einem Geschäftsabschluss mit einem Verbraucher nicht bereit war, dadurch erschlichen hat, dass er sich als Händler ausgegeben hatte. Der Käufer hatte sich als entgegen der tatsächlichen Rechtslage an der nicht vorliegenden erschlichenen Rechtslage festhalten zu lassen (BGH 22. De-zember 2004 - VIII ZR 91/04 - NJW 2005, 1045).
bb) Diese Grundsätze können auch auf die verdeckte Arbeitnehmerüberlassung übertragen werden.
Die gesetzliche Grundkonzeption des AÜG geht von einer offenen Arbeitnehmerüberlassung aus. Dies ist insbesondere den Nachweispflichten in § 11 AÜG zu entnehmen als auch dem Schriftformerfordernis und den Dokumentationspflichten in § 12 AÜG. Der Gesetzgeber geht auch davon aus, dass nur derjenige einer Arbeitnehmerüberlassungserlaubnis bedarf, der überhaupt einen Nut-zungswillen hat gemäß § 1 Abs. 1 AÜG. Ohne Nutzungswille kann eine Verlängerung befristet erteilter Erlaubnisse versagt werden gemäß § 2 Abs. 4 AÜG.
- 24 -
Eine unbefristete Erlaubnis erlischt, wenn sie drei Jahre nicht genutzt wurde gemäß § 2 Abs. 5 AÜG. Auch § 613 Satz 2 BGB geht davon aus, dass ein Anspruch auf Dienstleistungserbringung grundsätzlich personengebunden und nicht übertragbar ist. Daraus folgt, dass eine Übertragung des Direktionsrechts auf einen anderen jedenfalls der Zustimmung des Arbeitnehmers bedarf, somit auch der Offenlegung der Direktionsrechtsübertragung. Dem Regelungsregime des AÜG will sich somit nur derjenige unterstellen, der dies offenlegt. Das Recht der Arbeitnehmerüberlassung ist also durchgängig auf Transparenz angelegt. Transparent ist es nicht, wenn ein Unternehmen eine Erlaubnis einholt, aber noch nicht bei dem jeweiligen Fremdpersonaleinsatz klarstellt, ob er sie nutzen will oder nicht (Brose DB 2014, 1739, 1742). Wer eine Erlaubnis besitzt, sie aber bewusst zunächst nicht einsetzt und so die wirkliche Natur des Fremdpersonaleinsatzes nicht transparent macht, kann sich nicht auf die Erlaubnis berufen. Denn es ist widersprüchlich, einerseits aufgrund der besonderen Schutzzwecke des AÜG und des Typenzwangs bei der Einordnung des Rechtsverhältnisses auf die tatsächliche Durchführung abzustellen und andererseits bei der Frage, ob eine vorsorgliche Erlaubnis ausreicht, einen rein formalistischen Standpunkt einzunehmen (Brose DB 2014, 1739, 1742).
Genauso wie beim oben dargestellten Fall aus dem Kaufrecht sich der Käufer nicht darauf berufen durfte, Verbraucher zu sein, obwohl er dies verdeckt war, genauso darf sich der Verleiharbeitgeber nicht auf ein Verleiharbeitsverhältnis und der Entleiher sich nicht auf ein Arbeitnehmerüberlassungsverhältnis berufen, wenn sie das Regelungsregime des AÜG gegenüber dem überlassenen Arbeitnehmer bewusst nicht haben zur Anwendung bringen wollen, also nach außen gegenüber dem Arbeitnehmer einen Rechtsschein erschlichen haben, dass das Regelungsregime des AÜG nicht anwendbar sei.
Anders als im benannten Fall aus dem Kaufrecht ist aber zu berücksichtigen, dass es vorliegend nicht nur um eine Treuwidrigkeit zwischen den beiden Arbeitsvertragsparteien gehen kann, sondern dass die Treuwidrigkeit auch auf das Überlassungsverhältnis durchschlagen muss. Denn die Rechtsfolge der §§ 9 Nr. 1, 10 Abs. 1 Satz 1 AÜG könnte gegenüber dem Entleiher nicht gerechtfertigt
- 25 -
werden, wenn dieser von dem widersprüchlichen Verhalten nichts wusste, ihm gegenüber vielmehr der Rechtsschein einer ordnungsgemäßen Arbeitnehmerüberlassung gesetzt wurde. Denn in diesem Fall würde die Bindungswirkung des Erlaubnisverwaltungsaktes gemäß § 43 VwVfG auch zu Gunsten des Entleihers gelten. Dem Entleiher muss also gleichermaßen ein widersprüchliches Verhalten vorgeworfen werden können. Dieser muss gleichermaßen wie der Verleiher gegenüber dem Arbeitnehmer den Rechtsschein eines Vertragsverhältnisses außerhalb des Regelungsregimes des AÜG gesetzt haben. Das heißt, sowohl der Verleiharbeitgeber als auch der Entleiher müssen positive Kenntnis davon gehabt haben, dass die Überlassung des Arbeitnehmers von einer Eingliederung und einer Weisungsgebundenheit des Arbeitnehmers geprägt sein sollte, obwohl das Vertragsverhältnis anders benannt und nach außen anders abgewickelt werden sollte.
b) Diese Voraussetzungen sind vorliegend gegeben.
aa) Ein Tätigwerden im Rahmen der Arbeitnehmerüberlassung bei der Beklagten wurde dem Kläger von Seiten seiner Vertragsarbeitgeber jedenfalls nicht durchgehend transparent gemacht.
Zwar ist festzustellen, dass jedenfalls der Firma B. der Vorwurf mangelnder Transparenz nicht gemacht werden kann. Diese wies in § 14 ihres Arbeitsvertrages ausdrücklich darauf hin, dass das Direktionsrecht auf den Auftraggeber übertragen werden sollte und dies auf der Grundlage des AÜG erfolgen sollte.
Eine solche Offenlegung und Transparenz war aber im Arbeitsvertrag des Klägers mit der Firma E. nicht vorhanden. Der Kläger wurde ausweislich Ziffer 2 des Arbeitsvertrages mit der Firma E. lediglich als Konstrukteur für den Standort M. eingestellt. Das Arbeitsverhältnis bezog sich auf eine Tätigkeit in M.. In M. lag der Einsatzbetrieb der Beklagten. Der Kläger wurde eingestellt, nachdem er in einem Vorstellungsgespräch bei Herrn U. von diesem als geeignet angesehen wurde. Zwar wurde in Ziffer 10 des Arbeitsvertrages darauf hingewiesen, dass die Firma E. über eine unbefristet gültige Arbeitnehmerüberlassungserlaubnis
- 26 -
verfügte. Jedoch hieß es darin zugleich, dass lediglich im Falle einer Arbeitnehmerüberlassung der Kläger seine Ansprüche aus dem Arbeitsvertrag behalten solle und dass dann auf den Tarifvertrag zwischen dem Bundesverband Personaldienstleistungen e.V. (BZA) und den Mitgliedsgewerkschaften des DGB Be-zug genommen werde. Außerdem dürfe der Kläger an verschiedenen Orten ein-gesetzt werden und an andere Firmen überlassen werden. Diese Vertragsklausel ist in ihrem Zusammenhang auszulegen. Entweder ergibt sich im Umkehrschluss, dass die eigentliche Einstellung als Konstrukteur in M. gerade kein Fall der Arbeitnehmerüberlassung hat sein sollen, sondern dass lediglich offengehalten werden sollte, dass andere Einsatzmöglichkeiten (außer in M.) auch einmal im Rahmen einer Arbeitnehmerüberlassung erfolgen dürften. Oder aber die Klausel war als schlichter „Rettungsanker“ gemeint gewesen, der besagen sollte, dass die E. zwar nicht von einer Arbeitnehmerüberlassung ausging, für den Fall, dass der vorgesehene Einsatz aber dennoch eine solche darstellen sollte eine Erlaubnis zur Überlassung vorläge. In beiden Auslegungsvarianten wurde dem Kläger aber nicht deutlich gemacht, dass gerade die eigentliche Einsatzbe-stimmung, für die er eingestellt wurde, im Rahmen einer Arbeitnehmerüberlas-sung hätte abgewickelt werden sollen.
Ähnliches ergibt sich in Auslegung des Vertrages des Klägers mit der Firma E.E.. Dieser Vertrag begann mit einer Präambel, in welcher schlicht der Geschäftszweck der E.E. dargestellt wurde als Ingenieurgesellschaft, welche für Kundenunternehmen Projekte aus allen technischen Fachbereichen erledigt. Sodann wurde unter Ziffer 1 des Arbeitsvertrages zwar unter der Überschrift „Tätigkeit“ zuerst auf die Anwendbarkeit der zwischen dem Bundesverband Zeitarbeit Personaldienstleistungen e.V. (BZA) und der Tarifgemeinschaft des DGB abgeschlossenen Tarifverträge Bezug genommen, bevor die geschuldete Tätigkeit als Entwicklungsingenieur beschrieben wurde, die kryptisch auf das in der Präambel beschriebene Leistungsspektrum der E.E. rückverwies. Trotz der eingangs erfolgten Bezugnahme auf die Tarifverträge der Zeitarbeitsbranche wurde noch unter derselben Ziffer 1 aber ausgeführt, dass der Kläger den Weisungen der E.E. unterliegen sollte im Hinblick auf Inhalt, Umfang und Einteilung auch der in Geschäftsräumen von Kunden zu verrichtenden Tätigkeiten. Anders als
- 27 -
bei einer Arbeitnehmerüberlassung behielt sich E.E. somit das Direktionsrecht auch bei einem Fremdpersonaleinsatz vor. Zwar verwies auch die E.E. in ihrem Arbeitsvertrag unter Ziffer 8 darauf hin, dass sie in Besitz einer Arbeitnehmerüberlassungserlaubnis sei. Dies aber lediglich im Zusammenhang mit der Regelung einer zusätzlichen vertraglichen Verpflichtung des Klägers, soweit wegen betrieblicher Erfordernisse eine Projektbearbeitung im Kundenbetrieb im Rahmen des AÜG erfolgen müsse, sich der Kläger der fachlichen Aufsicht und der fachlichen Weisung des Kunden zu unterstellen habe. Diese Klausel bezog sich somit ausdrücklich nur auf Projektbearbeitungen. Diese fielen bei der Beklagten aber gar nicht an. Der Kläger war im Wesentlichen in dem Produktionsprozess der Beklagten eingetaktet mit der regelmäßigen Bearbeitung von Kundensonderwünschen.
bb) Trotz der fehlenden transparenten Ausweisung des Arbeitnehmerüberlassungswillens war den verleihenden Vertragsarbeitgebern aber bekannt, dass der Einsatz des Klägers bei der Beklagten unter betrieblicher Eingliederung bei der Beklagten und in Weisungsgebundenheit erfolgen sollte.
Die Firma B. schrieb dies sogar in den Arbeitsvertrag, siehe oben.
Aber auch der ersteinstellenden E. musste der Charakter der Arbeitnehmerüber-lassung bekannt gewesen sein. Schließlich stellte Herr F. der Firma E. den Kläger zuerst bei Herr U. vor und hatte abzuklären, ob der Kläger für die Aufgabenerbringung bei der Beklagten für geeignet gehalten wird, bevor der Kläger überhaupt eingestellt wurde. Gleich zu Beginn des Arbeitsverhältnisses im Jahre 2011 wurde der Kläger auf einen Arbeitsweisenkurs geschickt seitens der Beklagten, welcher nach eigener Behauptung der Beklagten von der E. gezahlt worden sei. Der E. muss bekannt gewesen sein, dass die Arbeitsaufträge dem Kläger direkt über das SAP-System zugeleitet wurden. Denn wenn die Prozesseintaktung so erfolgte, dass nur namentliche Auftragszuordnungen erfolgten, so ergibt sich umgekehrt, dass die einzelnen Arbeitsaufträge gerade nicht bei der Firma E. abgerufen wurden.
- 28 -
Selbiges ergibt sich auch für die Firma E.E.. Das Vertragsverhältnis zwischen dem Kläger und der Firma E.E. kam nach Überzeugung der Kammer gewissermaßen schon durch „Zuweisung“ seitens der Beklagten, beziehungsweise Herrn U. zustande. Der Zeuge Herr U. räumte zumindest ein, beim Abrufen der Werkvertragsvolumina gern einmal zwischen den Unternehmen gestreut zu haben und die Unternehmen gern einmal gewechselt zu haben. So sei das schon beim Wechsel von der Firma E. auf die Firma B. erfolgt. Dort habe er einen Wechsel vorgenommen, weil die Firma B. bei der Beklagten mit mehr Dienstleistungen habe ins Geschäft kommen wollen und Leistungen habe anbieten wollen. Ähnlich sei es nach Bekunden des Zeugen auch beim Wechsel von B. zur Firma E.E. erfolgt. Auch wenn der Zeuge abstritt, die Übernahme einzelner Arbeitnehmer durch die jeweiligen Dienstleistungsunternehmen angeregt zu haben oder hierauf Einfluss genommen zu haben, so bekundete er aber auch, dass die Beauftragung der Dienstleistungsunternehmen nach den Qualifikationen erfolgte bezogen auf die bei der Beklagten zu erbringenden Aufgabenerfüllungen. Der Zeuge beklagte zugleich den „Kannibalismus“ unter den Fremdfirmen, die sich gegenseitig die Leute wegnehmen würden. Geht man aber davon aus, dass die Qualifikationen vor allem auch durch die Kenntnisse der unternehmenspezifischen Software und Systeme der Beklagten begründet wurden und durch bei der Beklagten erworbenen Erfahrungswerte, was nach Behauptung der Beklagten auch der Grund für die längeren Einsatzdauern der Fremdarbeitskräfte gewesen sein soll, so wird verständlich, dass eine Neuauftragsvergabe bei gewünschter Streuung der Dienstleistungsunternehmen nur erfolgen konnte, wenn das neue Dienstleistungsunternehmen die Qualifikation, somit das Personal von einem anderen Unternehmen „abwerben“ konnte. Anders ausgedrückt: Die Beklagte hat den „Kannibalismus“ unter den Dienstleistern letztlich selbst gefördert. Es ist deshalb für die Kammer die vom Kläger auf informatorische Befragung erfolgte Aussage auch glaubwürdig, dass Herr U. mitgeteilt habe, er wolle die Auf-tragsvergaben zwischen mehreren Vertragspartnern streuen. Er - der Kläger - solle sich einen Dienstleister suchen, der zumindest zwei bei der Beklagten ein-gesetzte Arbeitnehmer habe.
- 29 -
cc) Auch im Überlassungsverhältnis zwischen der Beklagten und den Verleihunternehmen wurde der eigentliche Rechtscharakter der Arbeitnehmerüberlassung nicht transparent gemacht, sondern verschleiert.
Trotz gesetzlicher Verpflichtung gemäß § 12 AÜG wurde in die Rahmenverträge nicht aufgenommen, dass die Dienstleistungsunternehmen über eine Arbeitnehmerüberlassungserlaubnis verfügten. Auch die weiteren gemäß § 12 AÜG erforderlichen Angaben wurden nicht getätigt. Im Gegenteil: Die Vertragsverhältnisse wurden als „Einkaufsabschlüsse“ bezeichnet. Geregelt wurde, dass die Dienstleistungen „im Werkvertrag“ zu erbringen seien.
dd) Alleine die Bezeichnung als „Werkvertrag“ wäre jedoch nicht ausreichend für die Begründung einer Treuwidrigkeit gewesen, genausowenig wie der bloße Verstoß gegen das Schriftformerfordernis gemäß § 12 AÜG, siehe oben. Es handelte sich vorliegend jedoch nicht nur um eine bloße rechtsirrige oder versehentliche Falschbezeichnung, sondern um eine bewusst verschleiernde Falschbezeichnung, die so bewusst verschleiernd auch gegenüber dem Kläger als überlassenen Arbeitnehmer gelebt und kommuniziert wurde.
Die Beklagte achtete mit Bedacht darauf, dass der Kläger und die übrigen Fremdarbeitskräfte jedenfalls als Fremdarbeitskräfte bezeichnet wurden. So hatten die Fremdarbeitskräfte auf ihren Schreibtischen Schilder, die diese als Fremdarbeitskräfte auswiesen. In den Protokollen zu den Teamsitzungen wurden auf den Anwesenheitslisten zwischen Festangestellten und Fremdkräften differenziert. Auch bei den Weisungen betreffend die Urlaubsnahmeverpflichtungen wurden die Fremdarbeitskräfte als solche angesprochen. Das heißt, im kommunizierten Sprachgebrauch wurde den Fremdarbeitskräften deutlich gemacht, dass sie etwas anderes seien und deshalb auch anders zu behandeln seien als die eigenen Kräfte.
Auf der anderen Seite wurde dem Kläger aber zugleich deutlich gemacht, dass er sich trotz kommuniziertem Fremdarbeitskraftstatus an die Vorgaben und Regeln der Beklagten zu halten hatte. Dem Kläger wurde vermittelt, dass das
- 30 -
„Wohl und Wehe“ seiner Beschäftigung eigentlich nicht von seinen Vertragsar-beitgebern, sondern von der Beklagten abhing. Die Diskrepanz zwischen Sprachgebrauch und tatsächlicher Handhabung ist so deutlich, dass hieraus ein Verschleierungsvorsatz abgeleitet werden muss. Der Beklagten muss bewusst gewesen sein, dass sie über ihren Sprachgebrauch eine Geltendmachung des durch das AÜG vermittelten Sozialschutzes durch den Kläger zumindest erschwerte, wenn nicht sogar vereitelte.
Dies wird insbesondere deutlich an der „Personalrekrutierungspraxis“ der Be-klagten, wie sie die Kammer unter anderem aufgrund der Vernehmung des Zeugen Herrn U. festgestellt hat. Die Zeugenaussage des Herrn U. war zwar von größter Vorsicht und Zurückhaltung geprägt („ich muss mal vorsichtig formulieren“) und glich teilweise, wie der Klägervertreter treffend formulierte, „einem Tanz auf rohen Eiern“. Dennoch konnten aus der Aussage wesentliche Erkennt-nisse gewonnen werden. Herr U. führte die Abteilung Interieur. Für die Aufga-benerfüllung in dieser Abteilung waren ihm acht eigene Mitarbeiter zugeordnet, sowie ein weiteres Stundenvolumen von nochmals 100 %, das ihm über den Einkauf zur Verfügung gestellt wurden. Insgesamt waren ihm nach dessen Bekundung circa 30.000 Stunden pro Jahr zugeordnet, was circa 16 Mitarbeitern (bei personellen Schwankungen) entsprach. Das heißt, etwa 50 % der anfallenden Arbeiten hatte über Abrufe aus Werkverträgen abgedeckt zu werden, wobei spezifische Beschreibungen der jeweils genau zu erfüllenden Arbeiten in den Rahmenverträgen nicht enthalten waren. Die Rahmenverträge beinhalteten, soweit sie vorliegen, noch nicht einmal konkrete vereinbarte Abrufmengen. Diese wurden vielmehr als „Ges./nach Bedarf“ bezeichnet. In den Rahmenverträgen wurde lediglich der Stundensatz für einen Rahmenzeitraum festgelegt. Soweit der Zeuge bekundete, die Verträge hätten Stundenvolumen beinhaltet oder seien geldmengenmäßig definiert gewesen, muss es sich um interne Vorgaben und Zuweisungen gehandelt haben. Der Zeuge räumte schließlich ein, die Vertragsschlüsse selbst nicht ausgehandelt und abgeschlossen zu haben. Wie bereits oben dargelegt, gab es jedoch ein Bestreben, die Dienstleister zu streuen und ab und wann auch auszuwechseln. Wichtig war aber, die Qualität der eingekauften Leistungen zu halten. Die Qualität wurde aber letztlich verkörpert durch die
- 31 -
bekannten oder bekannt gemachten Mitarbeiter der Fremdfirmen. Der Zeuge formulierte dies so, die Firmen müssten halt schauen, dass sie die Mitarbeiter haben, um die geforderten Leistungen erbringen zu können. Dies führte zu einem vom Zeugen bedauerten „Kannibalismus“ unter den Fremdfirmen, die sich gegenseitig die Arbeitskräfte abwarben. Die Drittfirmen wurden bewusst in einen Wettbewerb gesetzt. Der Kläger musste erkennen, in diesem Wettbewerb der Spielball zu sein, um den sich die Drittfirmen bemühen mussten, um im Spiel zu bleiben. Auf diese Art und Weise hat die Beklagte zumindest mittelbar gesteuert, wer bei ihr eingesetzt wird. Letztlich war auch für den Kläger erkennbar, dass es der Beklagten im Wesentlichen darauf ankam, wer bei ihr eingesetzt wird und nicht darum, bei wem dieser Arbeitnehmer unter Vertrag steht. Das Anforderungsprofil wurde über die Einbindungsfähigkeit der überlassenen Mitarbeiter in ihre Abläufe beurteilt.
In dieses Bild passt dann auch der Vorgang der Ersteinstellung bei der Firma E., bei der der Kläger vor Vertragsschluss Herrn U. präsentiert wurde zur Eignungsbeurteilung.
Mit kurzen Worten zusammengefasst: Die Beklagte wollte Mitarbeiter nach eige-nem Wunsch. Nur die „Zahlstelle“ sollte eine andere sein.
II.
Der Hilfsantrag Ziffer 2 und der Hilfsantrag Ziffer 3 fielen wegen des Obsiegens des Klägers mit seinem Hauptantrag nicht zur Entscheidung an.
III. Nebenentscheidungen
1. Die Kostenentscheidung folgt aus § 91 Abs. 1 ZPO.
2. Die Zulassung der Revision beruht auf § 72 Abs. 2 Satz 1 ArbGG.
- 32 -
Rechtsmittelbelehrung
1. Gegen dieses Urteil kann d. Bekl. schriftlich Revision einlegen. Die Revision muss innerhalb einer Frist von einem Monat, die Revisionsbegründung innerhalb einer Frist von zwei Monaten bei dem
Bundesarbeitsgericht
Hugo-Preuß-Platz 1
99084 Erfurt
eingehen.
Beide Fristen beginnen mit der Zustellung des in vollständiger Form abgefassten Urteils, spätestens aber mit Ablauf von fünf Monaten nach der Verkündung.
Die Revision und die Revisionsbegründung müssen von einem Prozessbevollmächtigten unterzeichnet sein. Als Prozessbevollmächtigte sind nur zugelassen:
a. Rechtsanwälte,
b. Gewerkschaften und Vereinigungen von Arbeitgebern sowie Zusammenschlüsse solcher Verbände für ihre Mitglieder oder für andere Verbände oder Zusammenschlüsse mit vergleichbarer Ausrichtung und deren Mitglieder,
c. juristische Personen, die die Voraussetzungen des § 11 Abs. 2 Satz 2 Nr. 5 ArbGG erfüllen.
In den Fällen der lit. b und c müssen die handelnden Personen die Befähigung zum Richteramt haben.
2. Für d. Kläg. ist gegen dieses Urteil ein Rechtsmittel nicht gegeben. Auf § 72a ArbGG wird hingewiesen.
Stöbe
Dick
Lux
Hinweis:
Die Geschäftsstelle des Bundesarbeitsgerichts wünscht die Vorlage der Schriftsätze in siebenfacher Fertigung, für jeden weiteren Beteiligten eine weitere Mehrfertigung.
Weitere Auskünfte erteilen Ihnen gern:
 |
Dr. Martin Hensche Rechtsanwalt Fachanwalt für Arbeitsrecht Kontakt: 030 / 26 39 620 hensche@hensche.de |
 |
Christoph Hildebrandt Rechtsanwalt Fachanwalt für Arbeitsrecht Kontakt: 030 / 26 39 620 hildebrandt@hensche.de |
 |
Nina Wesemann Rechtsanwältin Fachanwältin für Arbeitsrecht Kontakt: 040 / 69 20 68 04 wesemann@hensche.de |