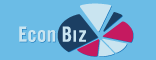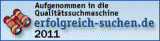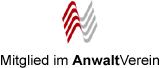- -> zur Mobil-Ansicht
- Arbeitsrecht aktuell
- Tipps und Tricks
- Handbuch Arbeitsrecht
- Gesetze zum Arbeitsrecht
- Urteile zum Arbeitsrecht
- Urteile 2023
- Urteile 2021
- Urteile 2020
- Urteile 2019
- Urteile 2018
- Urteile 2017
- Urteile 2016
- Urteile 2015
- Urteile 2014
- Urteile 2013
- Urteile 2012
- Urteile 2011
- Urteile 2010
- Urteile 2009
- Urteile 2008
- Urteile 2007
- Urteile 2006
- Urteile 2005
- Urteile 2004
- Urteile 2003
- Urteile 2002
- Urteile 2001
- Urteile 2000
- Urteile 1999
- Urteile 1998
- Urteile 1997
- Urteile 1996
- Urteile 1995
- Urteile 1994
- Urteile 1993
- Urteile 1992
- Urteile 1991
- Urteile bis 1990
- Arbeitsrecht Muster
- Videos
- Impressum-Generator
- Webinare zum Arbeitsrecht
-
Kanzlei Berlin
 030 - 26 39 62 0
030 - 26 39 62 0
 berlin@hensche.de
berlin@hensche.de
AnfahrtDetails -
Kanzlei Frankfurt
 069 - 71 03 30 04
069 - 71 03 30 04
 frankfurt@hensche.de
frankfurt@hensche.de
AnfahrtDetails -
Kanzlei Hamburg
 040 - 69 20 68 04
040 - 69 20 68 04
 hamburg@hensche.de
hamburg@hensche.de
AnfahrtDetails -
Kanzlei Hannover
 0511 - 89 97 701
0511 - 89 97 701
 hannover@hensche.de
hannover@hensche.de
AnfahrtDetails -
Kanzlei Köln
 0221 - 70 90 718
0221 - 70 90 718
 koeln@hensche.de
koeln@hensche.de
AnfahrtDetails -
Kanzlei München
 089 - 21 56 88 63
089 - 21 56 88 63
 muenchen@hensche.de
muenchen@hensche.de
AnfahrtDetails -
Kanzlei Nürnberg
 0911 - 95 33 207
0911 - 95 33 207
 nuernberg@hensche.de
nuernberg@hensche.de
AnfahrtDetails -
Kanzlei Stuttgart
 0711 - 47 09 710
0711 - 47 09 710
 stuttgart@hensche.de
stuttgart@hensche.de
AnfahrtDetails
BAG, Urteil vom 19.02.2013, 9 AZR 461/11
| Schlagworte: | Teilzeit, Arbeitszeitverringerung, Elternzeit | |
| Gericht: | Bundesarbeitsgericht | |
| Aktenzeichen: | 9 AZR 461/11 | |
| Typ: | Urteil | |
| Entscheidungsdatum: | 19.02.2013 | |
| Leitsätze: | 1. § 15 BEEG unterscheidet zwischen dem Konsensverfahren gemäß § 15 Abs. 5 Satz 1 und Satz 2 BEEG und dem Anspruchsverfahren nach § 15 Abs. 6 iVm. Abs. 7 BEEG. Im Konsensverfahren sollen sich der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer oder die Arbeitnehmerin über den Antrag auf Verringerung der Arbeitszeit während der Elternzeit einigen (§ 15 Abs. 5 Satz 2 BEEG). Ist eine Einigung nicht möglich, hat der Arbeitnehmer oder die Arbeitnehmerin gemäß § 15 Abs. 6 BEEG zweimal Anspruch auf Verringerung der Arbeitszeit (Anspruchsverfahren). 2. Im Konsensverfahren nach § 15 Abs. 5 Satz 1 und Satz 2 BEEG getroffene einvernehmliche Elternteilzeitregelungen sind nicht auf den Anspruch gemäß § 15 Abs. 6 iVm. Abs. 7 BEEG auf zweimalige Verringerung der Arbeitszeit anzurechnen. 3. Der Anspruch auf Vertragsänderung aus § 15 Abs. 6 iVm. Abs. 7 BEEG erstreckt sich auch auf die Verteilung der verringerten Arbeitszeit. |
|
| Vorinstanzen: | Arbeitsgericht Hamburg, Urteil vom 9.9.2010 - 7 Ca 203/10 Landesarbeitsgericht Hamburg, Urteil vom 18.5.2011 - 5 Sa 93/10 |
|
BUNDESARBEITSGERICHT
9 AZR 461/11
5 Sa 93/10
Landesarbeitsgericht
Hamburg
Im Namen des Volkes!
Verkündet am
19. Februar 2013
URTEIL
Brüne, Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle
In Sachen
Klägerin, Berufungsbeklagte und Revisionsklägerin,
pp.
Beklagte, Berufungsklägerin und Revisionsbeklagte,
hat der Neunte Senat des Bundesarbeitsgerichts aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 19. Februar 2013 durch den Vorsitzenden Richter am Bundesarbeitsgericht Dr. Brühler, die Richter am Bundesarbeitsgericht Krasshöfer und Klose sowie die ehrenamtlichen Richter Kranzusch und Lücke für Recht erkannt:
- 2 -
1. Auf die Revision der Klägerin wird das Urteil des Landesarbeitsgerichts Hamburg vom 18. Mai 2011 - 5 Sa 93/10 - aufgehoben.
2. Die Berufung der Beklagten gegen das Urteil des Arbeitsgerichts Hamburg vom 9. September 2010 - 7 Ca 203/10 - wird zurückgewiesen.
3. Die Beklagte hat die Kosten der Berufung zu tragen. Von den Kosten der Revision trägt die Beklagte 80 %, die Klägerin 20 %.
Von Rechts wegen!
Tatbestand
Die Parteien streiten über einen Anspruch der Klägerin auf Verringerung und Verteilung der Arbeitszeit während ihrer Elternzeit.
Die Klägerin ist seit dem 1. April 2006 bei der Beklagten als Personalreferentin in Vollzeit beschäftigt. Nach der Geburt ihres Kindes am 5. Juni 2008 nahm sie Elternzeit bis zum 4. Juni 2010 in Anspruch. Mit Schreiben vom 6. November 2008 beantragte sie die Verringerung ihrer Arbeitszeit für die Zeit vom 1. Januar 2009 bis zum 31. Mai 2009 auf 15 Stunden pro Woche und für die Zeit ab 1. Juni 2009 auf wöchentlich 20 Stunden. Für den Fall, teilweise zu Hause arbeiten zu können, bot sie ein höheres Stundenmaß an. Am 3. Dezember 2008 vereinbarten die Parteien daraufhin schriftlich eine Teilzeitbeschäftigung für die Zeit vom 1. Januar 2009 bis zum 31. Mai 2009 mit einer wöchentlichen Arbeitszeit von 15 Stunden und für die Zeit vom 1. Juni 2009 bis zum 4. Juni 2010 von 20 Stunden.
Mit Schreiben vom 7. April 2010 nahm die Klägerin bis zum 4. Juni 2011 Elternzeit in Anspruch und beantragte gleichzeitig die Beibehaltung der wöchentlichen Arbeitszeit von 20 Stunden und deren Verteilung auf montags von 7:30 Uhr bis 14:45 Uhr sowie mittwochs und donnerstags von 7:30 Uhr bis
- 3 -
15:00 Uhr. Per E-Mail vom 12. Mai 2010 lehnte die Beklagte eine weitere Teilzeitbeschäftigung der Klägerin ab.
Die Klägerin ist der Auffassung, sie habe gemäß § 15 Abs. 6 BEEG Anspruch auf die beantragte Elternteilzeit. Dieser stehe nicht entgegen, dass § 15 Abs. 6 BEEG nur einen Anspruch auf zweimalige Verringerung der Arbeitszeit gewähre. Ihr Anspruch entstehe erst, wenn die Parteien eine einvernehmliche Regelung nicht erzielt hätten. Der im konsensualen Teil des Verfahrens noch nicht entstandene Anspruch könne somit durch eine einvernehmliche Regelung nicht erfüllt werden. Jedenfalls habe sie mit ihrem Schreiben vom 6. November 2008 nicht zweimal, sondern nur einmal die Verringerung ihrer Arbeitszeit erbeten.
Die Klägerin hat - soweit für die Revision maßgeblich - beantragt,
die Beklagte zu verurteilen, ihrem Antrag, in der Zeit vom 5. Juni 2010 bis zum 4. Juni 2011 ihre vertragliche Arbeitszeit weiterhin auf 20 Stunden pro Woche festzulegen, verteilt auf montags von 7:30 Uhr bis 14:45 Uhr sowie mittwochs und donnerstags von 7:30 Uhr bis 15:00 Uhr, zuzustimmen.
Die Beklagte hat beantragt, die Klage abzuweisen. Sie meint, die Arbeitszeit der Klägerin sei mit der Vereinbarung vom 3. Dezember 2008 bereits zweimal verringert worden. Ein weiterer Verringerungsanspruch stehe der Klägerin deshalb nicht zu.
Das Arbeitsgericht hat der Klage, soweit für die Revision maßgeblich, stattgegeben. Das Landesarbeitsgericht hat sie abgewiesen. Mit der Revision verfolgt die Klägerin die Wiederherstellung des Urteils des Arbeitsgerichts und hat darüber hinaus beantragt
festzustellen, dass die Beklagte verpflichtet war, ihrem Antrag, in der Zeit vom 5. Juni 2010 bis zum 4. Juni 2011 ihre vertragliche Arbeitszeit weithin auf 20 Stunden pro Woche festzulegen, zuzustimmen.
In der Revisionsverhandlung hat die Klägerin diesen weiteren Antrag zurückgenommen.
- 4 -
Entscheidungsgründe
Die zulässige Revision der Klägerin ist begründet. Sie führt zur Wiederherstellung der klagestattgebenden Entscheidung des Arbeitsgerichts. Das Landesarbeitsgericht hat die Klage zu Unrecht abgewiesen.
I. Die Klage ist zulässig. Die auf Vertragsänderung gerichtete Leistungsklage genügt dem Bestimmtheitsgebot des § 253 Abs. 2 Nr. 2 ZPO und ist nicht infolge Zeitablaufs unzulässig geworden. Ihr fehlt nicht deshalb das Rechtsschutzbedürfnis, weil die Elternzeit inzwischen beendet ist (vgl. BAG 15. Dezember 2009 - 9 AZR 72/09 - Rn. 25 mwN).
II. Die Klage ist begründet. Der Anspruch der Klägerin auf die Verringerung und die von ihr gewünschte Verteilung ihrer Arbeitszeit folgt aus § 15 Abs. 6 iVm. Abs. 7 BEEG.
1. Darüber, dass die für den Anspruch auf Verringerung der Arbeitszeit in § 15 Abs. 7 Satz 1 Nr. 1, 2, 3 und 5 sowie Abs. 2 Satz 1 BEEG genannten Voraussetzungen erfüllt sind, besteht kein Streit. Die Ausführungen des Landesarbeitsgerichts, wonach dem Verringerungsanspruch keine dringenden betrieblichen Gründe entgegenstehen (§ 15 Abs. 7 Satz 1 Nr. 4 BEEG), hat die Beklagte nicht mit Gegenrügen angegriffen und in der Revisionsverhandlung ausdrücklich erklärt, die Würdigung des Landesarbeitsgerichts nicht zu rügen. Ihren Verringerungsanspruch konnte die Klägerin gleichzeitig mit der Inanspruchnahme der weiteren Elternzeit geltend machen (BAG 12. Mai 2011 - 2 AZR 384/10 - Rn. 27; 15. April 2008 - 9 AZR 380/07 - Rn. 21 f., BAGE 126, 276).
2. Die Regelung in § 15 Abs. 6 BEEG hindert den Anspruch der Klägerin 13 auf Verringerung ihrer Arbeitszeit nicht. Danach kann während der Gesamtdauer der Elternzeit nur zweimal eine Verringerung der Arbeitszeit beansprucht werden, soweit eine Einigung nach Abs. 5 nicht möglich ist. Die Teilzeittätigkeit
- 5 -
der Klägerin im Zeitraum vom 1. Januar 2009 bis zum 4. Juni 2010 beruhte nicht auf einer Inanspruchnahme iSv. § 15 Abs. 6 iVm. Abs. 7 BEEG, sondern auf einer Einigung der Parteien gemäß § 15 Abs. 5 Satz 2 BEEG.
a) Entgegen der Auffassung des Landesarbeitsgerichts führt der Umstand, dass die Parteien für die Zeiträume vom 1. Januar 2009 bis zum 31. Mai 2009 und vom 1. Juni 2009 bis 4. Juni 2010 die Verringerung der Arbeitszeit und deren Ausgestaltung im Konsensverfahren gemäß § 15 Abs. 5 BEEG vereinbarten, nicht zu einer Erfüllung des Anspruchs auf zweimalige Verringerung der Arbeitszeit während der Gesamtdauer der Elternzeit.
aa) Die Regelung der Elternteilzeit in § 15 BEEG unterscheidet zwischen dem Verringerungsantrag nach § 15 Abs. 5 BEEG und dem Verringerungsanspruch gemäß § 15 Abs. 6 iVm. Abs. 7 BEEG. Zunächst hat der Arbeitnehmer oder die Arbeitnehmerin gemäß § 15 Abs. 5 Satz 1 BEEG die Verringerung der Arbeitszeit beim Arbeitgeber zu beantragen. Damit wird das Konsensverfahren eingeleitet. Hierzu muss der Arbeitnehmer oder die Arbeitnehmerin noch kein annahmefähiges Angebot iSv. § 145 BGB auf Verringerung der Arbeitszeit gegenüber dem Arbeitgeber abgeben. Es reicht aus, dass der Arbeitgeber um eine Verhandlung über eine Verringerung der Arbeitszeit und gegebenenfalls die Verteilung der verringerten Arbeitszeit gebeten wird. Im Gegensatz dazu regelt § 15 Abs. 6 iVm. Abs. 7 BEEG das Verfahren der Inanspruchnahme, wenn eine Einigung im Konsensverfahren scheitert. Dieses Verfahren leitet der Arbeitnehmer dadurch ein, dass er dem Arbeitgeber ein annahmefähiges Angebot iSv. § 145 BGB auf Verringerung und gegebenenfalls auf Verteilung der verringerten Arbeitszeit unterbreitet und deutlich macht, hierdurch die Verringerung der Arbeitszeit iSv. § 15 Abs. 6 BEEG zu beanspruchen. Ob der Arbeitnehmer oder die Arbeitnehmerin im Konsensverfahren eine Verringerung der Arbeitszeit erreichen will oder im Anspruchsverfahren eine bestimmte Reduzierung der Arbeitszeit durchzusetzen versucht, ist durch Auslegung zu ermitteln.
bb) Dass die Regelung in § 15 Abs. 5 Satz 1 BEEG das Konsensverfahren und nicht das Anspruchsverfahren betrifft, wird bereits aus dem Wortlaut der
- 6 -
Bestimmung deutlich, wonach der Arbeitnehmer oder die Arbeitnehmerin eine Verringerung der Arbeitszeit und ihre Ausgestaltung „beantragen“ kann. Über einen solchen Antrag sollen sich die Parteien nach § 15 Abs. 5 Satz 2 BEEG innerhalb von vier Wochen einigen. Besondere Form- und Fristerfordernisse sieht das Gesetz für den Antrag nach § 15 Abs. 5 Satz 1 BEEG nicht vor. Die gesetzliche Regelung begrenzt die Anzahl der Verringerungsanträge nach § 15 Abs. 5 Satz 1 BEEG nicht und knüpft diese anders als den Verringerungsanspruch nach § 15 Abs. 6 BEEG nicht an die in § 15 Abs. 7 BEEG genannten Voraussetzungen.
cc) Im Gegensatz dazu bestimmt § 15 Abs. 6 BEEG, dass eine Verringerung unter den Voraussetzungen des § 15 Abs. 7 BEEG während der Gesamtdauer der Elternzeit zweimal „beansprucht“ werden kann. Damit spricht die Vorschrift anders als § 15 Abs. 5 Satz 1 BEEG nicht von einem Antrag, sondern von einem Anspruch, und begründet damit das Recht, auch gegen den Willen des Arbeitgebers die Verringerung der Arbeitszeit durchzusetzen. Sie bindet dieses Recht ua. an eine Mindestbeschäftigtenzahl von mehr als 15 Arbeitnehmern (§ 15 Abs. 7 Satz 1 Nr. 1 BEEG), einen ununterbrochenen Bestand des Arbeitsverhältnisses von mehr als sechs Monaten (§ 15 Abs. 7 Satz 1 Nr. 2 BEEG) und die Einhaltung bestimmter Formen und Fristen (§ 15 Abs. 7 Satz 1 Nr. 3 und 5 BEEG).
dd) Die Differenzierung zwischen dem Verringerungsantrag nach § 15 Abs. 5 Satz 1 BEEG im Konsensverfahren und dem Verringerungsanspruch gemäß § 15 Abs. 6 iVm. Abs. 7 BEEG im Anspruchsverfahren wird ferner aus der Regelung in § 15 Abs. 5 Satz 3 BEEG deutlich. Danach „kann“ der Verringerungsantrag nach § 15 Abs. 5 Satz 1 BEEG mit der schriftlichen Mitteilung nach § 15 Abs. 7 Satz 1 Nr. 5 BEEG und damit mit der Geltendmachung des Anspruchs aus § 15 Abs. 6 BEEG verbunden werden. Daraus folgt im Umkehrschluss, dass nach der Vorstellung des Gesetzgebers der Verringerungsantrag und die schriftliche Mitteilung nicht miteinander verbunden werden müssen. Der Arbeitnehmer oder die Arbeitnehmerin kann deshalb zunächst nur einen Antrag nach § 15 Abs. 5 Satz 1 BEEG stellen, den Verlauf des Konsensverfahrens
- 7 -
abwarten und erst dann entscheiden, ob ein bestimmter Anspruch gemäß § 15 Abs. 6 BEEG geltend gemacht werden soll.
ee) Wenn § 15 Abs. 6 BEEG regelt, dass während der Gesamtdauer der Elternzeit zweimal eine Verringerung der Arbeitszeit „beansprucht“ und damit auch gegen den Willen des Arbeitgebers durchgesetzt werden kann, spricht dies dagegen, dass Einigungen der Parteien im Konsensverfahren über die Verringerung der Arbeitszeit während eines Teils der Elternzeit auf den Verringerungsanspruch nach § 15 Abs. 6 BEEG anzurechnen sind.
ff) Diesem Auslegungsergebnis steht der Satzteil in § 15 Abs. 6 BEEG „soweit eine Einigung nach Absatz 5 nicht möglich ist“ nicht entgegen, sondern bestätigt es. § 15 Abs. 6 BEEG knüpft damit an das aus Sicht des Gesetzgebers vorrangige Ziel der Einigung an, die regelmäßig zu einem besseren Ergebnis führt (BT-Drucks. 14/3118 S. 20 f.). Daraus lässt sich jedoch nicht ableiten, dass der in § 15 Abs. 6 BEEG geregelte Anspruch (teilweise) untergeht bzw. verbraucht wird, wenn sich die Parteien für einen Teil der Elternzeit über die Verringerung der Arbeitszeit im Konsensverfahren nach § 15 Abs. 5 Satz 2 BEEG einigen. Mit der Formulierung „soweit eine Einigung nach Absatz 5 nicht möglich ist“ bringt § 15 Abs. 6 BEEG zum Ausdruck, dass der Rechtsanspruch auf eine bestimmte Verringerung der Arbeitszeit erst dann begründet wird, wenn sich die Parteien über die Verringerung der Arbeitszeit im Konsensverfahren nicht (mehr) einigen können.
gg) Sinn und Zweck des § 15 BEEG geben kein anderes Ergebnis vor.
(1) Nach Art. 6 Abs. 1 GG stehen Ehe und Familie unter dem besonderen Schutz der staatlichen Ordnung. Die gesetzlichen Regelungen zur Elternzeit und Elternteilzeit dienen diesem Schutz (BAG 9. Mai 2006 - 9 AZR 278/05 - Rn. 47). Die Zulassung der Teilerwerbstätigkeit bezweckt die Vereinbarkeit von Beruf und Familie (BAG 19. April 2005 - 9 AZR 233/04 - zu II 3 b gg der Gründe, BAGE 114, 206). Der Anspruch auf Teilerwerbstätigkeit während der Elternzeit beruht auf dem Bestreben, Eltern den notwendigen und grundgesetzlich geschützten Freiraum zur Betreuung und Erziehung ihres Kindes (Art. 6 Abs. 2
- 8 -
GG) einzuräumen, ohne den Anschluss an den Beruf zu verlieren. Er dient zugleich der Sicherung der wirtschaftlichen Grundlage der Familie (HK-ArbR/ Reinecke 2. Aufl. § 15 BEEG Rn. 27). Mit der Erleichterung der Erwerbstätigkeit während der Elternzeit sollen Eltern, die ein Kind betreuen und erziehen, gegenüber der alten Rechtslage wirtschaftlich besser gestellt und insbesondere auch Väter verstärkt zur Übernahme der Erziehungsverantwortung motiviert werden (vgl. BT-Drucks. 14/3118 S. 10; BT-Drucks. 14/3553 S. 11).
(2) Das Recht, während der Gesamtdauer der Elternzeit zweimal eine Verringerung der Arbeitszeit zu beanspruchen, berücksichtigt die Erfahrung, dass mit steigendem Alter des Kindes zwar (noch) nicht der Betreuungsbedarf sinkt, wohl aber zunehmend eine Fremdbetreuung in Betracht kommt, sodass dem Arbeitnehmer oder der Arbeitnehmerin mehr Zeit für die berufliche Tätigkeit bleibt (BAG 9. Mai 2006 - 9 AZR 278/05 - Rn. 24). Zu Beginn der Elternzeit sind für Eltern der jeweilige Betreuungsbedarf und die Möglichkeit etwaiger Fremdbetreuung bis zur Vollendung des dritten Lebensjahres des Kindes nur begrenzt vorhersehbar und planbar. Es kann zu unerwarteten familiären oder wirtschaftlichen Entwicklungen während der Elternzeit kommen. Eltern sollte deshalb eine familiengerechte flexible Handhabung der Verringerung der Arbeitszeit ermöglicht werden (vgl. BAG 9. Mai 2006 - 9 AZR 278/05 - Rn. 29). Diesem Ziel der gesetzlichen Regelung widerspräche es, den gegen den Willen des Arbeitgebers durchsetzbaren Rechtsanspruch aus § 15 Abs. 6 BEEG dadurch einzuschränken, dass auch eine freiwillige Einigung im Konsensverfahren über die Verringerung der Arbeitszeit angerechnet wird.
(3) Das Auslegungsergebnis wahrt das Recht des Arbeitgebers, dass gegen seinen Willen die Arbeitszeit während der Gesamtdauer der Elternzeit nicht mehr als zweimal verringert wird. Die Begrenzung des Anspruchs in § 15 Abs. 6 BEEG dient dem Interesse des Arbeitgebers an einer kontinuierlichen Personalplanung. Dieser hat angesichts des Erfordernisses entgegenstehender dringender betrieblicher Gründe in § 15 Abs. 7 Satz 1 Nr. 4 BEEG regelmäßig einen Verringerungsanspruch nach § 15 Abs. 6 BEEG zu erfüllen. Damit er hierdurch nicht unzumutbar belastet wird, soll er nur zweimal damit rechnen
- 9 -
müssen, dass seine Personalplanung durch einen gegen seinen Willen durchsetzbaren Verringerungsanspruch durchkreuzt wird. Die Geltendmachung eines Verringerungsanspruchs nach § 15 Abs. 6 BEEG setzt zudem nicht voraus, dass der Arbeitnehmer gemäß § 15 Abs. 7 Satz 5 BEEG Klage vor den Gerichten für Arbeitssachen erhoben hat und der Arbeitgeber zur Annahme des Verringerungsangebots des Arbeitnehmers verurteilt worden ist. Einigen sich die Arbeitsvertragsparteien nicht im Konsensverfahren, sondern erst nach der Geltendmachung des Verringerungsanspruchs gemäß § 15 Abs. 6 BEEG, ist diese im Anspruchsverfahren erzielte Einigung über die Arbeitszeitverringerung auf den Anspruch des Arbeitnehmers oder der Arbeitnehmerin auf zweimalige Verringerung der Arbeitszeit anzurechnen.
b) Im Entscheidungsfall kann offenbleiben, ob bereits die schriftliche Mitteilung des Verringerungsanspruchs nach § 15 Abs. 7 Satz 1 Nr. 5 BEEG für dessen Geltendmachung iSv. § 15 Abs. 6 BEEG ausreicht oder ob darüber hinaus keine Einigung im Konsensverfahren nach § 15 Abs. 5 Satz 2 BEEG zustande gekommen sein darf.
aa) Die Klägerin hatte vor dem 7. April 2010 ihren Anspruch nicht iSv. § 15 Abs. 7 Satz 1 Nr. 5 BEEG mitgeteilt. Die entgegenstehende Annahme des Landesarbeitsgerichts hält der revisionsrechtlichen Überprüfung nicht stand. Das Schreiben der Klägerin vom 6. November 2008 genügte den Erfordernissen des § 145 BGB nicht. Das Landesarbeitsgericht hat das Schreiben der Klägerin vom 6. November 2008 deshalb zu Unrecht als zweifache Inanspruchnahme einer Verringerung ihrer Arbeitszeit iSv. § 15 Abs. 6 BEEG verstanden.
bb) Die Auslegung der atypischen Erklärungen der Klägerin ist nur beschränkt revisibel. Sie ist vom Senat nur daraufhin zu überprüfen, ob das Landesarbeitsgericht Auslegungsregeln verletzt, gegen Denk- und Erfahrungssätze verstoßen oder wesentliche Tatsachen unberücksichtigt gelassen hat. Dabei ist nach § 133 BGB ausgehend vom objektiven Wortlaut der wirkliche Wille der Klägerin zu erforschen und nicht am buchstäblichen Sinn des Ausdrucks zu haften. Bei der Auslegung sind alle tatsächlichen Begleitumstände der Erklärung zu berücksichtigen, die für die Frage von Bedeutung sein können,
- 10 -
welchen Willen die Klägerin bei ihrer Erklärung gehabt hat und wie die Erklärung von der Beklagten zu verstehen war (vgl. BAG 22. Mai 2012 - 9 AZR 453/10 - Rn. 14 mwN).
cc) Die Auslegung des Schreibens der Klägerin vom 6. November 2008 durch das Landesarbeitsgericht hält selbst dieser eingeschränkten revisions-rechtlichen Kontrolle nicht stand.
(1) Aus dem Schreiben geht hervor, dass die Klägerin in Verhandlungen über die Verringerung ihrer Arbeitszeit eintreten wollte. Sie teilte der Beklagten mit, wann und in welchem Umfang sie in Elternteilzeit arbeiten wollte. Die Klägerin unterbreitete der Beklagten mit dem Schreiben vom 6. November 2008 jedoch noch kein annahmefähiges Angebot. Sie legte in dem Schreiben weder den Umfang der zu ändernden Arbeitszeit iSv. § 145 BGB hinreichend bestimmt fest, noch räumte sie der Beklagten insoweit ein einseitiges Leistungsbestimmungsrecht ein. Die Klägerin machte damit kein Angebot, das mit einem bloßen „Ja“ hätte angenommen werden können.
(2) Die Klägerin überließ der Beklagten auch nicht die Ausgestaltung der verringerten Arbeitszeit. Das Schreiben vom 6. November 2008 lässt nicht erkennen, dass die Klägerin endgültig ihre Verhandlungsmacht über den Umfang ihrer Arbeitspflicht und die Lage der Arbeitszeit aufgeben und sich einer Festlegung durch die Beklagte unterwerfen wollte. Die damit verbundene Erweiterung des Direktionsrechts der Beklagten hätte im Vertragsangebot aus Sicht eines objektiven Dritten unzweifelhaft zum Ausdruck kommen müssen (vgl. BAG 16. Oktober 2007 - 9 AZR 239/07 - Rn. 23, BAGE 124, 219). Dies war nicht der Fall. Die Klägerin wollte im Rahmen der Verhandlung mit der Beklagten noch klären, ob und in welchem Umfang sie zu Hause arbeiten kann. Auf dieser Grundlage sollte der Umfang der Elternteilzeit für die beiden Zeiträume einvernehmlich festgelegt werden. Insbesondere aus dem Satz: „Ich freue mich auf unser Gespräch am 17. November 2008“, wird deutlich, dass das Schreiben der Vorbereitung der Verhandlung mit der Beklagten über die Verringerung der Arbeitszeit während der Elternzeit diente. Erst mit dem Angebot der Beklagten im Schreiben vom 3. Dezember 2008 und dessen Annahme
- 11 -
durch die Klägerin wurde die Verringerung der Arbeitszeit im Zeitraum vom 1. Januar 2009 bis zum 4. Juni 2010 konkret ausgestaltet.
3. Die Klägerin hat gemäß § 15 Abs. 6 iVm. Abs. 7 BEEG auch Anspruch auf die Vereinbarung der von ihr beantragten Verteilung der verringerten Arbeitszeit. Die Verteilung der aufgrund der Elternzeit verringerten Arbeitszeit hat der Arbeitgeber nicht gemäß § 106 Satz 1 GewO nach billigem Ermessen zu bestimmen.
a) Der Verringerungsanspruch aus § 15 Abs. 6 BEEG erstreckt sich auch auf die Verteilung der verringerten Arbeitszeit (Klarstellung von BAG 15. Dezember 2009 - 9 AZR 72/09 - Rn. 26 ff.; Leßmann DB 2001, 94, 97 zu § 15 BErzGG; aA Sievers TK-TzBfG 4. Aufl. Anh. 3 Rn. 74; Reinecke FA 2007, 98, 100; BeckOK R/G/K/U/Schrader Stand 1. Dezember 2012 BEEG § 15 Rn. 59; HWK/Gaul 5. Aufl. § 15 BEEG Rn. 23; AnwK-ArbR/Theiss 2. Aufl. Bd. 1 § 15 BEEG Rn. 22; Buchner/Becker MuSchG und BEEG 8. Aufl. § 15 BEEG Rn. 56; Moll/Reinfeld in MAH Arbeitsrecht 3. Aufl. § 73 Rn. 136; Rudolf/Rudolf NZA 2002, 602, 604; Gaul/Wisskirchen BB 2000, 2466, 2468; wohl auch ErfK/Gallner 13. Aufl. § 15 BEEG Rn. 14; Sowka NZA 2000, 1185, 1189 zu § 15 BErzGG; teilweise unter ausdrücklicher kritischer Würdigung dieses Ergebnisses vgl. zB Laux in Laux/Schlachter TzBfG 2. Aufl. § 23 Anh. 1 B Rn. 24 mwN; Reiserer/Penner BB 2002, 1962, 1963; Hanau FS Buchner S. 290; Leuchten FS Buchner S. 559). Allerdings regeln weder § 15 Abs. 6 BEEG noch § 15 Abs. 7 BEEG ausdrücklich, dass der Verringerungsanspruch die Verteilung der Arbeitszeit umfasst. Diese Vorschriften sprechen - anders als § 15 Abs. 5 BEEG, der auch die Ausgestaltung der Verringerung nennt - nur vom „Anspruch auf Verringerung der Arbeitszeit“. Der Gesetzeswortlaut schließt das Verständnis, dass der Verringerungsanspruch die Ausgestaltung der Verringerung umfasst, aber auch nicht aus. Soweit aus § 15 BEEG gefolgert wird, dass diese Vorschrift bewusst zwischen Umfang und Verteilung der Arbeitszeit differenziere (BeckOK R/G/K/U/Schrader aaO), und auf die unterschiedliche Ausgestaltung von § 8 TzBfG und § 15 BEEG verwiesen wird (HWK/Gaul aaO), zwingt dies nicht zu der Annahme, dass keine bestimmte Ausgestaltung der Verringe-
- 12 -
rung der Arbeitszeit beansprucht werden kann (Leuchten FS Buchner S. 560). Wenn der Gesetzgeber trotz der Uneinigkeit im Schrifttum und aufgrund der bisherigen Rechtsprechung des Senats zu § 15 Abs. 7 BErzGG (BAG 9. Mai 2006 - 9 AZR 278/05 - Rn. 41), wonach kein Anspruch auf eine bestimmte vertragliche Festlegung der verringerten Arbeitszeit bestanden hat, davon abgesehen hat, den Anspruch des Arbeitnehmers oder der Arbeitnehmerin auf eine bestimmte Verteilung der während der Elternzeit verringerten Arbeitszeit ausdrücklich zu regeln, hindert dies nicht die Klarstellung, dass der Verringerungsanspruch nach § 15 Abs. 6 iVm. Abs. 7 BEEG die Verteilung der verringerten Arbeitszeit umfasst, wenn der Arbeitnehmer oder die Arbeitnehmerin eine konkrete Verteilung angegeben hat.
b) Systematik sowie Sinn und Zweck der Regelung in § 15 Abs. 6 BEEG stehen einem Verständnis entgegen, dass der Verringerungsanspruch nicht auch die Ausgestaltung der verringerten Arbeitszeit umfasst, sondern der Arbeitgeber die Verteilung der Arbeitszeit nach billigem Ermessen gemäß § 106 Satz 1 GewO bestimmt.
aa) Die Verringerung der Arbeitszeit während der Elternzeit führt stets dazu, dass die Arbeitszeit anders verteilt werden muss. Deshalb muss immer auch die Ausgestaltung der Verringerung geregelt werden (vgl. Leßmann DB 2001, 94, 97 zu § 15 BErzGG). Aus § 15 Abs. 7 Satz 3 BEEG folgt zwar nicht, dass die gewünschte Verteilung der verringerten Arbeitszeit im Antrag angegeben werden muss. Nach dieser Bestimmung „soll“ sie jedoch angegeben werden. Die nach § 15 Abs. 7 Satz 4 BEEG „beanspruchte Verringerung“ beinhaltet im Falle der Aufnahme eines Verteilungswunsches in den Antrag auch diesen. Dies zeigt, dass der Begriff der „Verringerung der Arbeitszeit“ nicht bloß den Umfang der Arbeitszeit umfasst, sondern auch deren Verteilung. Da ein Antrag nach § 15 Abs. 6 BEEG, in dem die gewünschte Verteilung der verringerten Arbeitszeit gemäß § 15 Abs. 7 Satz 3 BEEG angegeben wurde, gemäß § 145 BGB annahmefähig sein muss, also die damit angebotene Vertragsänderung mit einem bloßen „Ja“ angenommen werden können muss, erstreckt sich eine Zustimmung zu der mit dem Antrag „beanspruchten Verrin-
- 13 -
gerung“ auch auf den angegebenen Verteilungswunsch. Dass dies nach der Vorstellung des Gesetzgebers der Regelfall ist, wird aus der Formulierung „soll ... angegeben werden“ deutlich. Aus der Möglichkeit der klageweisen Herbeiführung dieser Zustimmung gemäß § 15 Abs. 7 Satz 5 BEEG ist deshalb abzuleiten, dass sich der Anspruch auf den angegebenen Verteilungswunsch erstreckt. Ist im Antrag die gewünschte Verteilung der verringerten Arbeitszeit nicht angegeben, verbleibt es allerdings hinsichtlich der Festlegung der Lage der Arbeitszeit beim Direktionsrecht des Arbeitgebers. Stehen der im Antrag angegebenen Verteilung der verringerten Arbeitszeit dringende betriebliche Gründe entgegen, besteht kein Anspruch auf Verringerung der Arbeitszeit. Will der Arbeitnehmer oder die Arbeitnehmerin das Risiko ausschließen, dass der beantragten Verteilung der verringerten Arbeitszeit und damit auch der Elternteilzeit dringende betriebliche Gründe entgegenstehen, darf im Anspruchsverfahren eine Verringerung und bestimmte Verteilung der verringerten Arbeitszeit nicht einheitlich angeboten werden.
bb) Für dieses Verständnis des § 15 BEEG sprechen auch Sinn und Zweck der Vorschrift. Wenn die Teilerwerbstätigkeit während der Elternzeit erleichtert werden soll, um die Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu verbessern, würde dieses Ziel weitgehend verfehlt, wenn der Verringerungsanspruch nicht auch die Verteilung der verringerten Arbeitszeit umfassen würde (vgl. Hanau FS Buchner S. 290). Während der Elternzeit hängen Verringerung und Verteilung der Arbeitszeit - wesentlich mehr als bei der Verringerung der Arbeitszeit nach § 8 TzBfG - wegen der familiären Einbindung und Betreuungsaufgabe in der Regel stark voneinander ab. Nur eine Vertragsänderung auch hinsichtlich der Verteilung der Arbeitszeit bewirkt die notwendige Sicherheit, dass es während der Gesamtdauer der Elternteilzeit bei der im Antrag angegebenen Verteilung der Arbeitszeit bleibt. Angesichts des Ziels der Vereinbarkeit von Beruf und Familie, dem die Zulassung der Teilerwerbstätigkeit während der Elternzeit dient, wäre es ein Wertungswiderspruch, Arbeitnehmern während der Elternzeit anders als bei der Verringerung der Arbeitszeit nach § 8 TzBfG einen Anspruch hinsichtlich der Verteilung zu versagen. Für die erforderliche Betreuung des
- 14 -
Kindes während der Elternzeit ist die Verteilung der verringerten Arbeitszeit regelmäßig ebenso von Bedeutung wie die Verringerung der Arbeitszeit selbst.
III. Die Kostenentscheidung folgt aus § 91 Abs. 1 Satz 1, § 97 Abs. 1, § 269 Abs. 3 Satz 2 iVm. § 92 Abs. 1 Satz 1 ZPO.
Brühler
Klose
Krasshöfer
Kranzusch
Martin Lücke
Weitere Auskünfte erteilen Ihnen gern:
 |
Dr. Martin Hensche Rechtsanwalt Fachanwalt für Arbeitsrecht Kontakt: 030 / 26 39 620 hensche@hensche.de |
 |
Christoph Hildebrandt Rechtsanwalt Fachanwalt für Arbeitsrecht Kontakt: 030 / 26 39 620 hildebrandt@hensche.de |
 |
Nina Wesemann Rechtsanwältin Fachanwältin für Arbeitsrecht Kontakt: 040 / 69 20 68 04 wesemann@hensche.de |