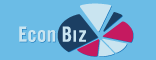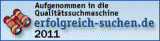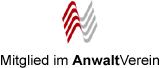- -> zur Mobil-Ansicht
- Arbeitsrecht aktuell
- Tipps und Tricks
- Handbuch Arbeitsrecht
- Gesetze zum Arbeitsrecht
- Urteile zum Arbeitsrecht
- Urteile 2023
- Urteile 2021
- Urteile 2020
- Urteile 2019
- Urteile 2018
- Urteile 2017
- Urteile 2016
- Urteile 2015
- Urteile 2014
- Urteile 2013
- Urteile 2012
- Urteile 2011
- Urteile 2010
- Urteile 2009
- Urteile 2008
- Urteile 2007
- Urteile 2006
- Urteile 2005
- Urteile 2004
- Urteile 2003
- Urteile 2002
- Urteile 2001
- Urteile 2000
- Urteile 1999
- Urteile 1998
- Urteile 1997
- Urteile 1996
- Urteile 1995
- Urteile 1994
- Urteile 1993
- Urteile 1992
- Urteile 1991
- Urteile bis 1990
- Arbeitsrecht Muster
- Videos
- Impressum-Generator
- Webinare zum Arbeitsrecht
-
Kanzlei Berlin
 030 - 26 39 62 0
030 - 26 39 62 0
 berlin@hensche.de
berlin@hensche.de
AnfahrtDetails -
Kanzlei Frankfurt
 069 - 71 03 30 04
069 - 71 03 30 04
 frankfurt@hensche.de
frankfurt@hensche.de
AnfahrtDetails -
Kanzlei Hamburg
 040 - 69 20 68 04
040 - 69 20 68 04
 hamburg@hensche.de
hamburg@hensche.de
AnfahrtDetails -
Kanzlei Hannover
 0511 - 89 97 701
0511 - 89 97 701
 hannover@hensche.de
hannover@hensche.de
AnfahrtDetails -
Kanzlei Köln
 0221 - 70 90 718
0221 - 70 90 718
 koeln@hensche.de
koeln@hensche.de
AnfahrtDetails -
Kanzlei München
 089 - 21 56 88 63
089 - 21 56 88 63
 muenchen@hensche.de
muenchen@hensche.de
AnfahrtDetails -
Kanzlei Nürnberg
 0911 - 95 33 207
0911 - 95 33 207
 nuernberg@hensche.de
nuernberg@hensche.de
AnfahrtDetails -
Kanzlei Stuttgart
 0711 - 47 09 710
0711 - 47 09 710
 stuttgart@hensche.de
stuttgart@hensche.de
AnfahrtDetails
BAG, Urteil vom 28.09.2016, 7 AZR 377/14
| Schlagworte: | Leiharbeit, Zeitarbeit, Befristung | |
| Gericht: | Bundesarbeitsgericht | |
| Aktenzeichen: | 7 AZR 377/14 | |
| Typ: | Urteil | |
| Entscheidungsdatum: | 28.09.2016 | |
| Leitsätze: | ||
| Vorinstanzen: | Arbeitsgericht Frankfurt am Main, Urteil vom 07.05.2013, 19 Ca 8501/12 Hessisches Landesarbeitsgericht, Urteil vom 08.04.2014, 15 Sa 766/13 |
|
BUNDESARBEITSGERICHT
7 AZR 377/14
15 Sa 766/13
Hessisches
Landesarbeitsgericht
Im Namen des Volkes!
Verkündet am
28. September 2016
URTEIL
Schiege, Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle
In Sachen
Kläger, Berufungskläger und Revisionskläger,
pp.
Beklagte, Berufungsbeklagte und Revisionsbeklagte,
hat der Siebte Senat des Bundesarbeitsgerichts aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 28. September 2016 durch die Vorsitzende Richterin am Bundesarbeitsgericht Gräfl, die Richterin am Bundesarbeitsgericht Dr. Rennpferdt, den Richter am Bundesarbeitsgericht Waskow sowie den ehrenamtlichen Richter Willms und die ehrenamtliche Richterin Gmoser für Recht erkannt:
- 2 -
Die Revision des Klägers gegen das Urteil des Hessischen Landesarbeitsgerichts vom 8. April 2014 - 15 Sa 766/13 - wird zurückgewiesen.
Der Kläger hat die Kosten der Revision zu tragen.
Von Rechts wegen!
Tatbestand
Die Parteien streiten im Zusammenhang mit einer Kündigungsschutzklage über die Frage, ob ihr Arbeitsverhältnis über den Ablauf der Vertragslaufzeit eines zum 31. August 2012 befristeten Arbeitsvertrags hinaus verlängert wurde.
Die Beklagte betreibt gewerbsmäßig Arbeitnehmerüberlassung. Sie schloss mit dem Kläger unter dem 1. März 2012/12. April 2012 einen zum 31. August 2012 befristeten Arbeitsvertrag. Der Kläger wurde der B D GmbH (im Folgenden D) überlassen und in deren Betrieb in A eingesetzt. Zuvor hatte die Beklagte mit der D die Überlassung des Klägers in einem unbefristeten „Arbeitnehmerüberlassungsvertrag“ vereinbart.
Der Kläger arbeitete auch nach dem 31. August 2012 im Betrieb der D. Für den Monat September 2012 erhielt er eine Lohnabrechnung von der M GmbH, einer Subunternehmerin der Beklagten, die über eine Erlaubnis zur gewerbsmäßigen Arbeitnehmerüberlassung verfügt. Ab dem 25. Oktober 2012 war der Kläger arbeitsunfähig erkrankt. Die Beklagte ließ die ihr übersandten Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen kommentarlos an den Kläger zurückgehen. Nachdem der Kläger den Fortbestand des Arbeitsverhältnisses über den 31. August 2012 hinaus gerichtlich geltend gemacht hatte, erklärte die Beklagte mit Schriftsatz vom 25. März 2013 vorsorglich eine ordentliche Kündigung.
Der Kläger hat die Auffassung vertreten, zwischen den Parteien habe zum Zeitpunkt des Zugangs der Kündigung ein Arbeitsverhältnis bestanden. Er
- 3 -
habe mit dem Objektleiter Ö die Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses über den 31. August 2012 hinaus vereinbart. Herr Ö sei zum Abschluss von Arbeitsverträgen für die Beklagte berechtigt. Der Geschäftsführer der Beklagten habe ihn im Betrieb der D als Objektleiter mit Einstellungsbefugnis und Ansprechpartner für Personalangelegenheiten der Beklagten vorgestellt und dies auch gegenüber ihren Mitarbeitern kommuniziert. Herr Ö habe die Zuteilung zu bestimmten Arbeitsbereichen vorgenommen, Vertragsunterlagen und Abrechnungen an die Arbeitnehmer der Beklagten ausgehändigt und die Vergütung ausgezahlt. Er habe zu keiner Zeit zum Ausdruck gebracht, für die M GmbH zu handeln. Jedenfalls sei das Arbeitsverhältnis mit Wissen der Beklagten über den 31. August 2012 hinaus fortgesetzt worden. Die Beklagte habe seine Arbeitsstunden auf der Grundlage des mit der D bestehenden Arbeitnehmerüberlassungsvertrags gegenüber dieser abgerechnet und die vereinbarte Vergütung vereinnahmt. Die Beklagte müsse sich jedenfalls die Kenntnis der D von der Weiterarbeit zurechnen lassen, weil sie diese nicht über die Beendigung des mit ihm bestehenden Arbeitsverhältnisses unterrichtet und sichergestellt habe, dass er seine Tätigkeit bei der D einstelle. Die Kündigung sei nicht sozial gerechtfertigt.
Der Kläger hat beantragt
festzustellen, dass das zwischen den Parteien bestehende Arbeitsverhältnis durch die Schriftsatzkündigung der Beklagten vom 25. März 2013 nicht aufgelöst ist.
Die Beklagte hat beantragt, die Klage abzuweisen. Sie hat die Ansicht vertreten, das Arbeitsverhältnis der Parteien habe am 31. August 2012 geendet. Ab dem 1. September 2012 habe der Kläger in einem Arbeitsverhältnis zur M GmbH gestanden und für diese bei D gearbeitet. Herr Ö sei weder zur Abgabe rechtsgeschäftlicher Erklärungen für sie befugt noch als Objektleiter beschäftigt worden. Selbst wenn Herr Ö als Objektleiter für sie aufgetreten wäre und Erklärungen in ihrem Namen abgegeben hätte, sei ihr dieses Verhalten nicht zuzurechnen, da sie hiervon keine Kenntnis gehabt habe.
- 4 -
Das Arbeitsgericht hat die Klage abgewiesen. Das Landesarbeitsgericht hat die Berufung des Klägers zurückgewiesen. Mit der Revision verfolgt der Kläger sein Begehren weiter. Die Beklagte beantragt die Zurückweisung der Revision.
Entscheidungsgründe
Die Revision des Klägers ist zulässig, aber unbegründet.
I. Entgegen der Ansicht der Beklagten ist die Revision zulässig. Die Revisionsbegründung genügt den gesetzlichen Anforderungen. Sie setzt sich mit den tragenden Gründen der angefochtenen Entscheidung hinreichend auseinander.
1. Nach § 72 Abs. 5 ArbGG iVm. § 551 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 ZPO gehört zum notwendigen Inhalt der Revisionsbegründung die Angabe der Revisionsgründe.
a) Bei Sachrügen sind diejenigen Umstände bestimmt zu bezeichnen, aus denen sich die Rechtsverletzung ergibt (§ 551 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 Buchst. a ZPO). Die Revisionsbegründung muss den angenommenen Rechtsfehler des Landesarbeitsgerichts in einer Weise verdeutlichen, die Gegenstand und Richtung des Revisionsangriffs erkennen lässt. Das erfordert eine Auseinandersetzung mit den tragenden Gründen der angefochtenen Entscheidung. Der Revisionsführer muss darlegen, warum er die Begründung des Berufungsgerichts für unrichtig hält (vgl. etwa BAG 9. Dezember 2014 - 1 AZR 146/13 - Rn. 15). Hierzu genügt weder die bloße Wiedergabe des bisherigen Vorbringens (BAG 20. Juni 2013 - 8 AZR 482/12 - Rn. 20) noch eine bloße Darstellung anderer Rechtsansichten ohne jede Auseinandersetzung mit den Gründen des Berufungsurteils (BAG 18. Mai 2011 - 10 AZR 346/10 - Rn. 10).
- 5 -
b) Verfahrensrügen müssen nach § 551 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 Buchst. b ZPO die Bezeichnung der Tatsachen enthalten, die den Mangel ergeben, auf den sich die Revision stützen will. Zudem muss die Kausalität zwischen Verfahrensmangel und Ergebnis des Berufungsurteils dargelegt werden (vgl. BAG 2. Mai 2014 - 2 AZR 490/13 - Rn. 16).
2. Diesen Anforderungen wird die Revisionsbegründung gerecht. Das Landesarbeitsgericht hat angenommen, zwischen den Parteien sei auch dann kein Vertrag über die Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses ab dem 1. September 2012 zustande gekommen, wenn der Kläger eine entsprechende Vereinbarung mit Herrn Ö getroffen habe. Der Kläger habe nicht substantiiert dargelegt, dass Herr Ö zum Abschluss von Arbeitsverträgen namens der Beklagten befugt sei, da er nicht vorgetragen habe, wann und unter welchen Um-ständen wem gegenüber die Vollmacht erteilt worden sei. Das Arbeitsverhältnis sei auch nicht nach § 15 Abs. 5 TzBfG mit Wissen der Beklagten über den 31. August 2012 hinaus fortgesetzt worden. Der Beklagten sei das Wissen des Herrn Ö von der Weiterarbeit des Klägers nicht zuzurechnen. Es komme auch nicht auf die Kenntnis der D von der Fortsetzung der Tätigkeit an, da diese keine zum Abschluss von Arbeitsverträgen berechtigte Vertreterin der Beklagten sei. Dagegen erhebt der Kläger sowohl zulässige Verfahrens- als auch Sachrügen. Der Kläger macht geltend, das Landesarbeitsgericht habe die Anforderungen an die Darlegungslast in Bezug auf die Bevollmächtigung zum Abschluss von Arbeitsverträgen überspannt; sein Vortrag sei auch ohne Darlegung der näheren Umstände der Vollmachtserteilung ausreichend. Ferner rügt er, das Landesarbeitsgericht habe hinsichtlich der Fiktion des Fortbestands des Arbeitsverhältnisses nach § 15 Abs. 5 TzBfG verkannt, dass dem Arbeitgeber in arbeitsteiligen Organisationen nicht nur das Wissen der zum Abschluss von Arbeitsverträgen berechtigten Vertreter, sondern auch das Wissen der mit der Einsatzsteuerung und der Personal- und Finanzbuchhaltung befassten Mitarbeiter von der Fortsetzung der Tätigkeit nach Ablauf der Vertragslaufzeit zugerechnet werden müsse. Dem Verleiher sei auch das Wissen des Entleihers von der Weiterarbeit zuzurechnen, wenn er den Entleiher nicht auf die Beendigung
- 6 -
des Arbeitsverhältnisses hingewiesen habe. Träfen sie zu, wären die Rügen geeignet, die angefochtene Entscheidung insgesamt in Frage zu stellen.
II. Die Revision des Klägers ist unbegründet. Die Vorinstanzen haben die Kündigungsschutzklage zu Recht abgewiesen. Die Klage ist unbegründet, da im Zeitpunkt des Zugangs der Kündigung vom 25. März 2013 zwischen den Parteien kein Arbeitsverhältnis mehr bestand.
1. Gegenstand einer Kündigungsschutzklage nach § 4 KSchG ist das Begehren festzustellen, dass das Arbeitsverhältnis durch die konkrete, mit der Klage angegriffene Kündigung zu dem in ihr vorgesehenen Termin nicht aufgelöst worden ist. Die betreffende Feststellung erfordert nach dem Wortlaut der gesetzlichen Bestimmung eine Entscheidung über das Bestehen eines Arbeitsverhältnisses zum Zeitpunkt des Zugangs der Kündigung. Mit der Rechtskraft des der Klage stattgebenden Urteils steht deshalb regelmäßig zugleich fest, dass jedenfalls bei Zugang der Kündigung ein Arbeitsverhältnis zwischen den Parteien bestanden hat, das nicht zuvor durch andere Ereignisse aufgelöst worden ist (BAG 20. März 2014 - 2 AZR 1071/12 - Rn. 17 mwN, BAGE 147, 358). Daher kann einer Kündigungsschutzklage nur stattgegeben werden, wenn das Arbeitsverhältnis zum Zeitpunkt des Ausspruchs der Kündigung nicht bereits durch andere Beendigungstatbestände aufgelöst ist (BAG 22. November 2012 - 2 AZR 738/11 - Rn. 9).
2. Bei Zugang der Kündigung der Beklagten vom 25. März 2013 bestand zwischen den Parteien kein Arbeitsverhältnis mehr. Das Arbeitsverhältnis der Parteien hat aufgrund Befristung am 31. August 2012 geendet. Die Parteien haben weder einen Arbeitsvertrag für die Zeit ab dem 1. September 2012 geschlossen, noch gilt ihr Arbeitsverhältnis gemäß § 15 Abs. 5 TzBfG als auf unbestimmte Zeit verlängert.
a) Das Arbeitsverhältnis der Parteien hat aufgrund der im Arbeitsvertrag vom 1. März 2012/12. April 2012 vereinbarten Befristung am 31. August 2012 geendet. Der Kläger hat die Befristung nicht mit einer Befristungskontrollklage angegriffen und macht die Unwirksamkeit der Befristung nicht geltend.
- 7 -
b) Zwischen den Parteien ist kein Arbeitsvertrag für die Zeit ab dem 1. September 2012 zustande gekommen. Dabei kann zu Gunsten des Klägers unterstellt werden, dass er seinem Vortrag zufolge mit Herrn Ö die Fortsetzung des mit der Beklagten bestehenden Arbeitsverhältnisses vereinbart hat. Herr Ö war nicht zum Abschluss von Arbeitsverträgen für die Beklagte bevollmächtigt. Die Beklagte muss sich das Handeln des Herrn Ö auch nicht nach den Grundsätzen der Duldungs- oder Anscheinsvollmacht zurechnen lassen.
aa) Das Landesarbeitsgericht hat rechtsfehlerfrei angenommen, der Kläger habe nicht hinreichend dargelegt, dass Herr Ö zum Abschluss von Arbeitsverträgen für die Beklagte berechtigt war.
(1) Das Landesarbeitsgericht ist im Ergebnis zu Recht davon ausgegangen, dass der Kläger mit seiner Behauptung, der Geschäftsführer der Beklagten habe Herrn Ö im Betrieb der D als Objektleiter mit Einstellungsbefugnis vorgestellt und dies auch gegenüber Mitarbeitern der Beklagten kommuniziert, eine Bevollmächtigung des Herrn Ö nicht substantiiert dargelegt hat.
(a) Eine Partei genügt ihrer Darlegungslast, wenn sie Tatsachen vorträgt, die in Verbindung mit einem Rechtssatz geeignet sind, das geltend gemachte Recht als in ihrer Person als entstanden erscheinen zu lassen. Genügt das Parteivorbringen diesen Anforderungen an die Substantiierung, kann der Vortrag weiterer Einzeltatsachen nicht verlangt werden (BAG 7. Juli 2015 - 10 AZR 416/14 - Rn. 29, BAGE 152, 108; 3. August 2005 - 10 AZR 585/04 - zu II b der Gründe; BGH 23. Juni 2016 - III ZR 308/15 - Rn. 18). Eine Beweisaufnahme zu einem bestrittenen erheblichen Vorbringen darf nur dann abgelehnt werden, wenn die unter Beweis gestellte Tatsache so ungenau bezeichnet ist, dass ihre Erheblichkeit nicht beurteilt werden kann oder wenn sie „ins Blaue hinein“ aufgestellt, mithin aus der Luft gegriffen ist, und sich somit als Rechtsmissbrauch darstellt (vgl. BAG 10. September 2014 - 10 AZR 959/13 - Rn. 29, BAGE 149, 84; BGH 23. Juni 2016 - III ZR 308/15 - Rn. 18).
(b) Der Vortrag des Klägers zur Bevollmächtigung des Herrn Ö genügt nicht den Anforderungen an die Substantiierung. Der Kläger hat nicht konkret
- 8 -
vorgetragen, wem gegenüber die behaupteten Erklärungen abgegeben worden sein sollen. Damit kann die Erheblichkeit seiner Behauptung nicht beurteilt werden. Nach § 167 Abs. 1 BGB erfolgt die Erteilung der Vollmacht durch Erklärung gegenüber dem zu Bevollmächtigenden oder dem Dritten, dem gegenüber die Vertretung stattfinden soll. Der Kläger hat weder vorgetragen, dass der Geschäftsführer der Beklagten die Vollmacht durch Erklärung gegenüber Herrn Ö erteilt hat, noch hat er vorgetragen, die Vollmachtserteilung sei ihm gegenüber erklärt worden. Soweit er behauptet hat, der Geschäftsführer der Beklagten habe Herrn Ö im Betrieb der D als Objektleiter mit Einstellungsbefugnis vorgestellt, ergibt sich daraus nicht, dass diese Erklärung in Anwesenheit des Herrn Ö abgegeben wurde. Mit der Behauptung, die Vollmachtserteilung sei gegenüber Mitarbeitern der Beklagten kommuniziert worden, hat der Kläger nicht vorgetragen, die Erklärung sei ihm gegenüber abgegeben worden.
(2) Das Landesarbeitsgericht hat zutreffend erkannt, dass auch die weiteren Behauptungen des Klägers zu den Aufgaben des Herrn Ö nicht die Annahme rechtfertigen, dieser sei zum Abschluss von Arbeitsverträgen für die Beklagte befugt. Die Funktion als Objektleiter und Ansprechpartner in Personalangelegenheiten ist nicht notwendig mit dem Recht zum Abschluss von Arbeitsverträgen verbunden. Die Befugnis, die Einsatzbereiche der Arbeitnehmer festzulegen, lässt ebenfalls nicht auf das Recht zum Abschluss von Arbeitsverträgen schließen. Gleiches gilt für die behauptete Zuständigkeit zur Aushändigung von Vertragsunterlagen und Abrechnungen sowie zur Auszahlung der Vergütung. Diese Aufgaben kann ein Bote wahrnehmen.
bb) Die Beklagte muss sich das Handeln des Herrn Ö auch nicht nach den Grundsätzen der Duldungs- und Anscheinsvollmacht zurechnen lassen.
(1) Eine Duldungsvollmacht liegt vor, wenn der Vertretene es wissentlich geschehen lässt, dass ein anderer für ihn wie ein Vertreter auftritt, und der Geschäftspartner dieses Dulden nach Treu und Glauben dahin versteht und auch verstehen darf, dass der als Vertreter Handelnde zu den vorgenommenen Erklärungen bevollmächtigt ist (BGH 22. Juli 2014 - VIII ZR 313/13 - Rn. 26, BGHZ 202, 158; 10. Januar 2007 - VIII ZR 380/04 - Rn. 19). Diese Vorausset-
- 9 -
zungen liegen nicht vor. Der Kläger hat nicht vorgetragen, dass der Geschäftsführer der Beklagten von dem - behaupteten - Auftreten des Herrn Ö im Namen der Beklagten Kenntnis hatte.
(2) Eine Anscheinsvollmacht setzt voraus, dass der Vertretene das Handeln des Scheinvertreters nicht kennt, er es aber bei pflichtgemäßer Sorgfalt hätte erkennen und verhindern können, und der Geschäftspartner annehmen durfte, der Vertretene kenne und billige das Handeln des Vertreters (BGH 26. Januar 2016 - XI ZR 91/14 - Rn. 61, BGHZ 208, 331). Das ist hier nicht der Fall. Der Kläger hat nicht dargelegt, aufgrund welcher Umstände die Beklagte das - behauptete - Auftreten des Herrn Ö als Vertreter der Beklagten hätte kennen können.
c) Zwischen den Parteien ist auch nicht nach § 15 Abs. 5 TzBfG ab dem 1. September 2012 ein unbefristetes Arbeitsverhältnis entstanden.
aa) Der Kläger ist nicht damit ausgeschlossen, sich auf die Entstehung eines Arbeitsverhältnisses nach § 15 Abs. 5 TzBfG zu berufen, weil er nicht innerhalb von drei Wochen nach dem vereinbarten Vertragsende den Fortbestand des Arbeitsverhältnisses gerichtlich geltend gemacht hat. Die Klagefrist für die Erhebung einer Befristungskontrollklage gemäß § 17 Satz 1 TzBfG findet keine Anwendung, wenn der Arbeitnehmer geltend macht, das Arbeitsverhältnis gelte nach § 15 Abs. 5 TzBfG als auf unbestimmte Zeit verlängert.
bb) Das Landesarbeitsgericht hat zutreffend erkannt, dass die Voraussetzungen des § 15 Abs. 5 TzBfG nicht vorliegen.
(1) Nach § 15 Abs. 5 TzBfG gilt ein Arbeitsverhältnis als auf unbestimmte Zeit verlängert, wenn es nach Ablauf der Zeit, für die es eingegangen ist, mit Wissen des Arbeitgebers fortgesetzt wird und der Arbeitgeber nicht unverzüglich widerspricht. Die Vorschrift regelt - ebenso wie § 625 BGB für die Fortsetzung von Dienstverhältnissen und Arbeitsverhältnissen außerhalb des Anwendungsbereichs des § 15 Abs. 5 TzBfG - die stillschweigende Verlängerung von Arbeitsverhältnissen unabhängig vom Willen der Parteien. Die Fortsetzung des
- 10 -
Arbeitsverhältnisses durch die Vertragsparteien iSv. § 15 Abs. 5 TzBfG ist ein Tatbestand schlüssigen Verhaltens kraft gesetzlicher Fiktion, durch die ein unbefristetes Arbeitsverhältnis zu den Bedingungen des vorangegangenen befristeten Arbeitsvertrags zustande kommt. Die Regelung beruht auf der Erwägung, die Fortsetzung der Arbeitsleistung durch den Arbeitnehmer mit Wissen des Arbeitgebers sei im Regelfall der Ausdruck eines stillschweigenden Willens der Parteien zur Verlängerung des Arbeitsverhältnisses (BAG 7. Oktober 2015 - 7 AZR 40/14 - Rn. 24; 3. September 2003 - 7 AZR 106/03 - zu 4 a der Gründe, BAGE 107, 237). Der Eintritt der in § 15 Abs. 5 TzBfG angeordneten Fiktion setzt voraus, dass der Arbeitnehmer seine Arbeitsleistung bewusst und in der Bereitschaft fortsetzt, die Pflichten aus dem Arbeitsverhältnis weiter zu erfüllen. Der Arbeitnehmer muss die vertragsgemäßen Dienste nach Ablauf der Vertragslaufzeit tatsächlich ausführen (BAG 18. Oktober 2006 - 7 AZR 749/05 - Rn. 15). Dabei genügt nicht jegliche Weiterarbeit des Arbeitnehmers. Diese muss vielmehr mit Wissen des Arbeitgebers selbst erfolgen.
(a) Arbeitgeber iSv. § 15 Abs. 5 TzBfG ist nicht jeder Vorgesetzte (vgl. zu § 625 BGB BAG 21. Februar 2001 - 7 AZR 98/00 - zu B I der Gründe, BAGE 97, 78), sondern der Arbeitgeber selbst. Seiner Kenntnis steht die Kenntnis der zum Abschluss von Arbeitsverträgen berechtigten Vertreter gleich (BAG 11. Juli 2007 - 7 AZR 197/06 - Rn. 26; 21. Februar 2001 - 7 AZR 98/00 - zu B I der Gründe, aaO; 25. Oktober 2000 - 7 AZR 537/99 - zu B IV 4 der Gründe, BAGE 96, 155).
(b) Bei Leiharbeitsverhältnissen ist dem Verleiher die Kenntnis des Entleihers von der Weiterarbeit nur dann zuzurechnen, wenn der Verleiher den Entleiher zum Abschluss von Arbeitsverhältnissen bevollmächtigt hat oder dessen Handeln ihm nach den Grundsätzen der Duldungs- oder Anscheinsvollmacht zuzurechnen ist. „Arbeitgeber“ iSv. § 15 Abs. 5 TzBfG ist der Verleiher als Vertragsarbeitgeber. Der Entleiher ist nicht deshalb - gemeinsam mit dem Verleiher - „Arbeitgeber“, weil die Arbeitgeberfunktionen im Leiharbeitsverhältnis zwischen dem Verleiher als dem Vertragsarbeitgeber und dem Entleiher, der die wesentlichen Arbeitgeberfunktionen in Bezug auf die Arbeitsleistung ausübt,
- 11 -
aufgespalten sind. Für die Verlängerung des Vertragsverhältnisses ist allein der Vertragsarbeitgeber zuständig. Daher setzt die Verlängerung des Arbeitsverhältnisses nach § 15 Abs. 5 TzBfG die Kenntnis des Verleihers voraus. Dem Verleiher ist es auch dann nicht nach Treu und Glauben (§ 242 BGB) verwehrt, sich auf seine Unkenntnis von der Weiterarbeit des Leiharbeitnehmers zu berufen, wenn er den Entleiher nicht über die Befristung des Arbeitsverhältnisses mit dem Leiharbeitnehmer unterrichtet und dadurch auf eine Einstellung der Tätigkeit des Leiharbeitnehmers hingewirkt hat. Den Verleiher trifft gegenüber dem Leiharbeitnehmer schon deshalb keine dahingehende Hinweis- und Kontrollpflicht, weil dem Leiharbeitnehmer die Befristung des Arbeitsverhältnisses bekannt ist (aA Ulber AÜG 4. Aufl. § 9 Rn. 359). Der Leiharbeitnehmer darf nicht schon deshalb von der Verlängerung des Arbeitsverhältnisses mit dem Verleiher ausgehen, weil der Entleiher ihn weiterbeschäftigt.
(2) Danach ist zwischen den Parteien durch die Weiterarbeit des Klägers nach § 15 Abs. 5 TzBfG kein unbefristetes Arbeitsverhältnis zustande gekommen. Die Weiterarbeit des Klägers bei der D erfolgte weder mit Wissen des Geschäftsführers der Beklagten noch in Kenntnis eines zum Abschluss von Arbeitsverträgen berechtigten Vertreters der Beklagten.
(a) Die Annahme des Landesarbeitsgerichts, der Geschäftsführer der Beklagten habe von der Weiterarbeit des Klägers keine Kenntnis gehabt, ist revisionsrechtlich nicht zu beanstanden.
(aa) Die Feststellung des Wissens des Arbeitgebers von der Weiterarbeit unterliegt der freien richterlichen Beweiswürdigung des Tatsachengerichts und ist nur beschränkt revisibel. Die revisionsrechtliche Kontrolle beschränkt sich darauf, ob sich der Tatrichter gemäß dem Gebot des § 286 Abs. 1 Satz 1 ZPO mit dem Prozessstoff umfassend und widerspruchsfrei auseinandergesetzt hat, die Beweiswürdigung also vollständig und rechtlich möglich ist, und nicht gegen Denkgesetze und Erfahrungssätze verstößt (vgl. BAG 27. März 2014 - 6 AZR 989/12 - Rn. 37).
- 12 -
(bb) Diesem eingeschränkten revisionsrechtlichen Prüfungsmaßstab hält das Berufungsurteil stand. Die Würdigung des Landesarbeitsgerichts, eine Kenntnis des Geschäftsführers von der Weiterarbeit des Klägers ergebe sich nicht aus dem Fortbestand des den Kläger betreffenden Überlassungsvertrags, ist nicht zu beanstanden. Die Rüge, das Landesarbeitsgericht habe nicht berücksichtigt, dass die Beklagte die vom Kläger erbrachten Arbeitszeiten abgerechnet habe, ist unbegründet. Das Landesarbeitsgericht hat sich mit dieser Behauptung des Klägers befasst und zu Recht angenommen, die Abrechnung lasse nicht auf eine Kenntnis des Geschäftsführers von der Weiterarbeit schließen.
(b) Das Landesarbeitsgericht hat auch zu Recht angenommen, dass die Weiterarbeit nicht mit Wissen eines zum Abschluss von Arbeitsverträgen berechtigten Vertreters erfolgte.
(aa) Auf die Kenntnis des Herrn Ö kommt es nicht an. Dieser war nicht zum Abschluss von Arbeitsverträgen für die Beklagte befugt. Die Behauptung des Klägers, Herr Ö sei als Objektleiter Ansprechpartner für Personalangelegenheiten, ist unerheblich. Aus der Rechtsprechung des Senats zum Hochschulbereich, auf die sich der Kläger berufen hat, ergibt sich nichts anderes. Danach steht der Kenntnis des Rektors der Universität, der als Behördenleiter Arbeitgeber iSd. § 15 Abs. 5 TzBfG ist, die Kenntnis der Mitarbeiter gleich, deren er sich zur eigenverantwortlichen Bearbeitung von arbeitsvertraglichen Angelegenheiten bedient. Hierzu zählen in erster Linie die zum Abschluss von Arbeitsverträgen berechtigten Mitarbeiter der Personalverwaltung. Daneben können auch Personen aus anderen Teilen der allgemeinen Hochschulverwaltung als Arbeitgeber anzusehen sein, sofern ihnen aufgrund der hochschulinternen Geschäftsverteilung anstelle des Rektors Sachverhalte über die Fortsetzung von Arbeitsverhältnissen von Arbeitnehmern bekannt werden können. Macht der Rektor von seiner Delegationsbefugnis als Behördenleiter Gebrauch und überträgt er die Bearbeitung von arbeitsvertraglichen Vorgängen auf andere selbstständig handelnde Personen, muss er deren Kenntnis aus den übertragenen Angelegenheiten gegen sich gelten lassen. Sind zum Beispiel der Rechts-
- 13 -
abteilung alle arbeitsrechtlichen Klagen zuzustellen, so kann der Justiziar der Universität als Arbeitgeber iSd. § 15 Abs. 5 TzBfG anzusehen sein, weil er anstelle des Rektors von dem in der Klageschrift enthaltenen Sachverhalt Kenntnis erhält. Ist die Rechtsabteilung der Universität generell für die Führung der arbeitsrechtlichen Rechtsstreitigkeiten zuständig, muss sich der Rektor darüber hinaus die Kenntnisse des für die Prozessführung verantwortlichen Justiziars aus Schriftsätzen und der Wahrnehmung von Gerichtsterminen wie seine eigenen zurechnen lassen (BAG 11. Juli 2007 - 7 AZR 501/06 - Rn. 24). Es kann offenbleiben, ob diese Grundsätze auch bei anderen arbeitsteilig tätigen Organisationen als Hochschulen anzuwenden sind. Jedenfalls hat der Kläger nicht dargelegt, dass die Beklagte Herrn Ö die eigenverantwortliche Bearbeitung von arbeitsvertraglichen Angelegenheiten übertragen hat. Eine solche selbstständige Funktion lässt sich weder aus der - behaupteten - Befugnis, Einsatzbereiche der Arbeitnehmer festzulegen, noch aus der Zuständigkeit zur Aushändigung von Vertragsunterlagen und Abrechnungen sowie zur Auszahlung der Vergütung ableiten.
(bb) Der Kläger macht ohne Erfolg geltend, Mitarbeiter der Personalabteilung und der Finanzbuchhaltung hätten aufgrund der Mitteilung der Arbeitsstunden des Klägers durch die D und aufgrund der Abrechnung der vom Kläger erbrachten Stunden durch die Beklagte von der Weiterarbeit Kenntnis erlangt. Es ist weder konkret dargelegt noch ersichtlich, dass diese Mitarbeiter zum Abschluss von Arbeitsverträgen berechtigt sind noch dass ihnen die eigenverantwortliche Bearbeitung von arbeitsvertraglichen Angelegenheiten übertragen ist.
(cc) Der Kläger hat auch nicht dargelegt, dass die Beklagte die D zum Abschluss von Arbeitsverträgen für die Beklagte bevollmächtigt hat. Eine solche Befugnis ergibt sich insbesondere nicht aus dem zwischen der Beklagten und der D geschlossenen „Arbeitnehmerüberlassungsvertrag“ vom 1. Januar 2012.
- 14 -
III. Die Kostenentscheidung beruht auf § 97 Abs. 1 ZPO.
Gräfl
Waskow
M. Rennpferdt
Willms
R. Gmoser
Weitere Auskünfte erteilen Ihnen gern:
 |
Dr. Martin Hensche Rechtsanwalt Fachanwalt für Arbeitsrecht Kontakt: 030 / 26 39 620 hensche@hensche.de |
 |
Christoph Hildebrandt Rechtsanwalt Fachanwalt für Arbeitsrecht Kontakt: 030 / 26 39 620 hildebrandt@hensche.de |
 |
Nina Wesemann Rechtsanwältin Fachanwältin für Arbeitsrecht Kontakt: 040 / 69 20 68 04 wesemann@hensche.de |