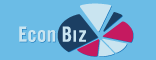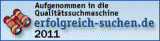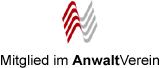- -> zur Mobil-Ansicht
- Arbeitsrecht aktuell
- Tipps und Tricks
- Handbuch Arbeitsrecht
- Gesetze zum Arbeitsrecht
- Urteile zum Arbeitsrecht
- Urteile 2023
- Urteile 2021
- Urteile 2020
- Urteile 2019
- Urteile 2018
- Urteile 2017
- Urteile 2016
- Urteile 2015
- Urteile 2014
- Urteile 2013
- Urteile 2012
- Urteile 2011
- Urteile 2010
- Urteile 2009
- Urteile 2008
- Urteile 2007
- Urteile 2006
- Urteile 2005
- Urteile 2004
- Urteile 2003
- Urteile 2002
- Urteile 2001
- Urteile 2000
- Urteile 1999
- Urteile 1998
- Urteile 1997
- Urteile 1996
- Urteile 1995
- Urteile 1994
- Urteile 1993
- Urteile 1992
- Urteile 1991
- Urteile bis 1990
- Arbeitsrecht Muster
- Videos
- Impressum-Generator
- Webinare zum Arbeitsrecht
-
Kanzlei Berlin
 030 - 26 39 62 0
030 - 26 39 62 0
 berlin@hensche.de
berlin@hensche.de
AnfahrtDetails -
Kanzlei Frankfurt
 069 - 71 03 30 04
069 - 71 03 30 04
 frankfurt@hensche.de
frankfurt@hensche.de
AnfahrtDetails -
Kanzlei Hamburg
 040 - 69 20 68 04
040 - 69 20 68 04
 hamburg@hensche.de
hamburg@hensche.de
AnfahrtDetails -
Kanzlei Hannover
 0511 - 89 97 701
0511 - 89 97 701
 hannover@hensche.de
hannover@hensche.de
AnfahrtDetails -
Kanzlei Köln
 0221 - 70 90 718
0221 - 70 90 718
 koeln@hensche.de
koeln@hensche.de
AnfahrtDetails -
Kanzlei München
 089 - 21 56 88 63
089 - 21 56 88 63
 muenchen@hensche.de
muenchen@hensche.de
AnfahrtDetails -
Kanzlei Nürnberg
 0911 - 95 33 207
0911 - 95 33 207
 nuernberg@hensche.de
nuernberg@hensche.de
AnfahrtDetails -
Kanzlei Stuttgart
 0711 - 47 09 710
0711 - 47 09 710
 stuttgart@hensche.de
stuttgart@hensche.de
AnfahrtDetails
ArbG Wuppertal, Urteil vom 01.03.2012, 6 Ca 3382/11
| Schlagworte: | Betriebsrat, Diskriminierung: Weltanschauung, Persönlichkeitsrecht, Schadensersatz | |
| Gericht: | Arbeitsgericht Wuppertal | |
| Aktenzeichen: | 6 Ca 3382/11 | |
| Typ: | Urteil | |
| Entscheidungsdatum: | 01.03.2012 | |
| Leitsätze: | ||
| Vorinstanzen: | ||
Arbeitsgericht Wuppertal, 6 Ca 3386/11
Datum: 01.03.2012
Spruchkörper: 6. Kammer
Entscheidungsart: Urteil
Aktenzeichen: 6 Ca 3382/11
Tenor:
1. Die Klage wird abgewiesen.
2. Die Klägerin trägt die Kosten des Rechtsstreits.
3. Streitwert: 448.511,46 €.
Tatbestand:
|
Die Parteien streiten über einen Anspruch der Klägerin auf Entschädigung, Schmerzensgeld und materiellen Schadensersatz wegen behaupteten Mobbings, Diskriminierung und Verletzung des Persönlichkeitsrechts. |
|
Die am 14.09.1973 geborene, zwei Kindern zum Unterhalt verpflichtete Klägerin ist seit dem 01.06.2000 bei der Beklagten als kaufmännische Angestellte beschäftigt, zuletzt in Teilzeit in der Position eines „Facility Management Agent“ zu einem Bruttomonatsgehalt von 2.400,00 €. Bei der Beklagten besteht ein Betriebsrat, dessen Vorsitzende die Klägerin seit August 2008 ist. In dieser Funktion ist sie vollumfänglich von der Arbeitsleistung freigestellt. |
|
Mit Schreiben vom 09.07.2010 erteilte die Beklagte der Klägerin eine Abmahnung wegen eines Arbeitszeitverstoßes. Ab September 2010 wurden zahlreiche E-Mails und Schreiben zwischen den Parteien gewechselt. Mit Schreiben vom 01.10.2010 kritisierte die Beklagte das Verhalten der Klägerin als Betriebsratsvorsitzende und wies auf eine mögliche Strafanzeige und Unterlassungsklage hin. Am 01. und 15. Oktober 2010 erteilte die Beklagte der Klägerin weitere Abmahnungen, gegen die die Klägerin ebenso wie gegen die zuvor erteilte Abmahnung Klage erhoben hat. Die Beklagte wies die Klägerin mit Schreiben vom 21.10.2010 darauf hin, dass sie bei weiteren Verstößen gegen ihre Amtspflichten mit einem Amtsenthebungsverfahren rechnen müsse. Am 08.10.2010 erlitt die Klägerin einen Nervenzusammenbruch und war vom 08.10.2010 bis zum 24.10.2010 arbeitsunfähig. Mit Schreiben vom 02.11.2010 kündigte die Beklagte das mit der Klägerin bestehende Arbeitsverhältnis mit Zustimmung des Betriebsrats fristlos wegen des Vorliegens gravierender Pflichtverletzungen und erließ gegen die Klägerin ein Hausverbot für sämtliche Bereiche des Firmengeländes wegen massiver Beleidigungen und Bedrohungen von Betriebsratsmitgliedern. Mit Schreiben vom 12.11.2010, 16.12.2010 und 01.02.2011 kündigte die Beklagte das Arbeitsverhältnis mit Zustimmung des Betriebsrats hilfsweise erneut außerordentlich fristlos. Die insoweit von der Klägerin jeweils erhobenen Kündigungsschutzklagen vor dem Arbeitsgericht Wuppertal sind noch nicht rechtskräftig entschieden. Mehrere Betriebsratsmitglieder erstatteten am 04.11.2010 Strafanzeige gegen die Klägerin und stellten einen Strafantrag. |
|
Mit ihrer am 22.11.2011 beim Arbeitsgericht eingegangenen Klage begehrt die Klägerin Entschädigung, Schmerzensgeld und materiellen Schadensersatz. |
|
Die Klägerin fühlt sich durch verschiedene Mitarbeiter der Beklagten, z.B. Herrn Q., Frau B. und Herrn B. systematisch schikaniert und sieht diesen Vorwurf durch zahlreiche E-Mails und Schreiben bestätigt. |
|
Sie behauptet, über Jahre hinweg von der Beklagten wegen ihres Geschlechts und ihrer Weltanschauung, die darin bestehe, dass sie sich eine gleichberechtigte Vertretung der Arbeitnehmer und einen sozialen Ausgleich zwischen Beschäftigten und Arbeitgebern vorstelle, diskriminiert worden zu sein. Sie sei einem Verhalten ausgesetzt gewesen, das sie als Mobbing bezeichnet. Sie sei vor Kollegen erniedrigt und in ihrer Betriebsratstätigkeit behindert worden. Die Beklagte habe das Ziel verfolgt, sie aus dem Betriebsrat und dem Arbeitsverhältnis zu drängen. Sie sei von der Beklagten unter Druck gesetzt, falsch beschuldigt, bedroht, persönlich und beruflich isoliert worden. Ihre Anfragen und Schreiben seien komplett ignoriert worden. Die Klägerin meint, aufgrund der massiven Diskriminierung und der anhaltenden Mobbinghandlungen sei sie in ihrer Gesundheit erheblich verletzt worden. Die Beklagte habe ihr Persönlichkeitsrecht verletzt und ihre Menschenwürde missachtet, um sie als Betriebsratsvorsitzende gefügig zu machen. Der Beklagten sei es um die Vernichtung missliebiger Betriebsräte gegangen. Aufgrund der Attacken der Beklagten sei sie gesundheitlich schwer mitgenommen. Sie leide unter Depressionen, einer posttraumatischen Belastungsstörung, Schwindel, Sehstörungen, Wortfindungsstörungen, Atemnot und Angstzuständen. Infolge der Erkrankungen habe sie auf zahlreiche private Aktivitäten verzichten müssen und könne nicht mehr wie früher am gesellschaftlichen Leben teilnehmen. Sie habe jegliche Lebensfreude verloren und stecke in einer tiefen Depression. Auch ihre Kinder würden unter ihrer Persönlichkeitsveränderung leiden. |
|
Die Klägerin beantragt, |
|
1. die beklagte Partei zu verurteilen, an die klägerische Partei einen angemessenen Ersatz für den immateriellen Schaden (Entschädigung und Schmerzensgeld) in Höhe von 420.000,00 € nebst Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit Rechtshängigkeit zu zahlen, |
|
2. die beklagte Partei zu verurteilen, an die klägerische Partei einen weiteren Betrag in Höhe von 10.276,66 € nebst Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit Rechtshängigkeit zu zahlen, |
|
3. festzustellen, dass die beklagte Partei verpflichtet ist, alle weiteren Gesundheits-, Vermögens- und sonstige Schäden zu ersetzen, die der klägerischen Partei aufgrund der in der Klage beschriebenen Persönlichkeitsverletzungen in Form von Benachteiligungen, Belästigungen und Diskriminierungen durch die beklagte Partei und ihre Mitarbeiter im Rahmen des zwischen den Parteien bestehenden Arbeitsverhältnisses entstanden sind und die zukünftig entstehen werden, soweit diese Ansprüche nicht auf Sozialversicherungsträger oder sonstige Dritte übergegangen sind; |
|
4. die beklagte Partei zu verurteilen, die Kosten der außergerichtlichen Rechtsverfolgung in Höhe von 8.234,80 € nebst Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit Rechtshängigkeit an die klägerische Partei zu zahlen; |
|
5. festzustellen, dass die beklagte Partei verpflichtet ist, die weiteren Kosten der gerichtlichen Rechtsverfolgung an die klägerische Partei zu zahlen. |
|
Die Beklagte beantragt, |
|
die Klage abzuweisen. |
|
Sie ist der Auffassung, dass die eingeklagten Ansprüche weder dem Grunde noch der Höhe nach gerechtfertigt seien. Die Tätigkeit der Klägerin als Betriebsrätin sei weder Ausdruck einer Religion noch einer Weltanschauung. Es handele sich vielmehr um eine persönliche Überzeugung/Vorstellung der Klägerin. Das von der Klägerin behauptete Verhalten der Mitarbeiter der Beklagten diskriminiere sie nicht in ihrer Weltanschauung. Eine Diskriminierung wegen des Geschlechts liege nicht vor. Die Klägerin habe keine diskriminierenden Handlungen dargelegt. Sie beschreibe lediglich Meinungsverschiedenheiten und Rechtsstreitigkeiten zwischen dem Arbeitgeber und dem Betriebsrat, zwischen dem Arbeitgeber und ihr als Vorsitzender des Betriebsrats sowie zwischen dem Arbeitgeber und ihr als Arbeitnehmerin. Sie habe weder unmittelbare noch mittelbare Benachteiligungen aufgezeigt. Eine Benachteiligung gegenüber anderen Kollegen liege gerade nicht vor, da jeder andere Arbeitnehmer, der nicht Mitglied des Betriebsrats sei, auch Abmahnungen und Kündigungen bei Vorliegen derart schwerer Pflichtverletzungen erhalten hätte. Die Klägerin habe keine Belästigungen aufgezeigt, durch die ihre Würde oder ihr Persönlichkeitsrecht verletzt worden sein könnten. Die Beklagte bestreitet die behaupteten Erkrankungen und meint, der Vortrag sei unglaubwürdig. Es sei höchst zweifelhaft, ob die von der Klägerin behaupteten Diskriminierungen ein Jahr nach Abschluss der Diskriminierungen eine solche Krankheit auslösen könnten. Darüber hinaus sei die Klägerin trotz ihrer vermeintlichen Erkrankungen äußerst aktiv und nehme, wie verschiedene Fernsehauftritte zeigen würden, durchaus am gesellschaftlichen Leben teil. Sie sei in ihrem Verein sehr aktiv und nehme aufwühlende Gerichtstermine, öffentliche Auftritte und Reisen mit zu betreuenden Kindern und Jugendlichen als verantwortliche Betreuerin wahr. Darüber hinaus bestreitet die Beklagte, dass die angeblichen gesundheitlichen Beschwerden durch das Verhalten der Beklagten oder von Personen verursacht seien, deren Verhalten der Beklagten zuzurechnen sei. |
|
Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf die wechselseitigen umfassenden Schriftsätze der Parteien nebst Anlagen sowie den Inhalt der mündlichen Verhandlungen Bezug genommen. |
Entscheidungsgründe:
|
Die überwiegend zulässige Klage ist unbegründet. A. |
|
Die Klägerin hat gegen die Beklagte weder einen Anspruch auf Entschädigung und Schmerzensgeld noch auf Ersatz eines materiellen Schadens. Ein Anspruch auf Erstattung der Kosten für die außergerichtliche und gerichtliche Rechtsverfolgung besteht ebenfalls nicht. I. |
|
Die Klägerin hat gegen die Beklagte unter keinem rechtlichen Gesichtspunkt einen Anspruch auf Entschädigung und Schmerzensgeld in Höhe von 420.000,00 €. 1. |
|
Die Klägerin kann ihren Anspruch nicht mit Erfolg auf § 15 Abs. 1, 2 AGG stützen. a) |
|
Voraussetzung für einen Anspruch nach § 15 AGG ist ein Verstoß des Arbeitgebers gegen das Benachteiligungsverbot des § 7 AGG. Gem. § 15 Abs. 1 AGG hat der Arbeitgeber Vermögensschäden, die aus der Verletzung des Benachteiligungsverbotes entstanden sind, verschuldensabhängig zu ersetzen. Entsprechend § 280 Abs. 1 S. 2 BGB wird das Verschulden des Arbeitgebers wiederlegbar vermutet (§ 15 Abs. 1 S. 2 AGG). Nach § 15 Abs. 2 AGG haftet der Arbeitgeber auch für Nichtvermögensschäden. Anders als Abs. 1 setzt der Entschädigungsanspruch nach Abs. 2 keinen schuldhaften Verstoß des Arbeitgebers gegen das Benachteiligungsverbot voraus; auch ein dem Arbeitgeber bloß zurechenbares Verhalten wird sanktioniert (BAG, Urteil vom 22.01.2009 - 8 AZR 906/07, NZA 09, 945). Tatbestandsvoraussetzung ist ein Verstoß gegen das Benachteiligungsverbot gem. § 7 Abs. 1 i.V.m. § 1 AGG. § 1 AGG erfasst Benachteiligungen aus Gründen der Rasse oder wegen der ethnischen Herkunft, des Geschlechts, der Religion oder Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen Identität. Bei der Festsetzung der angemessenen Entschädigung sind alle Umstände des Einzelfalls zu berücksichtigen, z.B. Art und Schwere, Dauer und Folgen, Anlass und Beweggrund der Benachteiligung, der Grad der Verantwortlichkeit des Arbeitgebers, etwa geleistete Wiedergutmachung, das Vorliegen eines Wiederholungsfalls und das Erzielen einer abschreckenden Wirkung unter Berücksichtigung des Sanktionszweck der Norm (BAG, Urteil vom 22.01.2009, a.a.O.). b) |
|
Ausgehend von diesen Rechtsgrundsätzen liegt auch nach dem Vorbringen der Klägerin ein Verstoß gegen das Benachteiligungsverbot des § 7 AGG nicht vor. aa) |
|
Eine zunächst behauptete Diskriminierung wegen ihrer ethnischen Herkunft hat die Klägerin nicht weiter aufrecht erhalten. Vielmehr hat sie im Kammertermin eingeräumt, dass es sich insoweit um einen Tippfehler handele. bb) |
|
Soweit die Klägerin ihren Anspruch auf eine Diskriminierung wegen ihres Geschlechts stützt, hat sie hierzu trotz des Hinweises der Beklagten keine konkreten Tatsachen vorgetragen. Dem Vorbringen der Klägerin kann eine Diskriminierung wegen ihres Geschlechts nicht entnommen werden. cc) |
|
Die Klägerin kann ihren Anspruch auch nicht mit Erfolg auf eine Diskriminierung wegen ihrer Weltanschauung stützen. |
|
Als Weltanschauung wird ein subjektiv verbindliches Gedankensystem, das sich mit Fragen nach dem Sinnganzen der Welt und insbesondere des Lebens der Menschen in dieser Welt befasst und das zu sinnentsprechenden Werturteilen führt, verstanden. In Anlehnung an Artikel 4 Abs. 2 GG dürften nur Fundamentalkonzepte über die Ordnung des gesellschaftlichen Zusammenlebens, die in Geschlossenheit und Sinngebungskraft einer Religion vergleichbar sind, vom AGG erfasst sein. Überzeugungen zu einzelnen Teilaspekten des Lebens genügen nicht (BVerwG, Urteil vom 19.02.1992 - 6 C 5/91, NVwZ 92, 1192). Allerdings muss der Weltanschauung eine Gewissensentscheidung zugrunde liegen. Eine bloße (z.B. politische) Überzeugung dürfte eher nicht ausreichen (ErfK/Schlachter, 11. Aufl. 2011, § 1 AGG, Rn. 8; Thüsing, Diskriminierungsschutz, Rn. 199). |
|
Nach Auffassung der Kammer ist die Tätigkeit als Betriebsrätin weder Ausdruck einer Religion noch einer Weltanschauung. Die Klägerin meint, ihre Weltanschauung bestehe darin, dass sie eine gleichberechtigte Vertretung der Arbeitnehmer und einen sozialen Ausgleich zwischen Beschäftigten und Arbeitgeber für erforderlich hält. Es sei ihre feste Überzeugung, einen gerechten Ausgleich zwischen dem Interesse des Arbeitgebers auf freie Ausübung seines Wollens und dem Interesse des Arbeitnehmers auf Schutz vor Eingriffen in das Arbeitsverhältnis sicherzustellen. Insoweit handelt es sich eher um eine individuelle Wertehaltung bzw. um ein individuelles Verhaltensmuster der Klägerin. Ihr besonderes Engagement als Betriebsrätin stellt keine Weltanschauung dar. Wie die Beklagte zu Recht ausführt, ist der Begriff der Weltanschauung umfassend zu verstehen und nicht auf den Teilaspekt Arbeitsrecht/Betriebsratstätigkeit beschränkt. |
|
Im Übrigen ist die Kammer der Auffassung, dass die Klägerin keine diskriminierenden Handlungen dargelegt hat. Sie beschreibt vielmehr Meinungsverschiedenheiten und Rechtsstreitigkeiten zwischen der Beklagten und dem Betriebsrat, zwischen der Beklagten und ihr als Vorsitzender des Betriebsrats sowie der Beklagten und ihr als Arbeitnehmerin. Zwischen der Klägerin und der Beklagten bzw. einzelnen Mitarbeitern der Beklagten lag eine noch hinzunehmende, normale Konfliktsituation am Arbeitsplatz vor, in der die Persönlichkeitsrechte der Klägerin nicht verletzt worden sind. Die Gesamtwürdigung aller Umstände lässt keine durch Organe oder Erfüllungsgehilfen der Beklagten begangenen, ihr gem. § 31 bzw. § 278 BGB zuzurechnenden Pflichtverletzungen erkennen. Selbst wenn die Kammer das Vorbringen der Klägerin hinsichtlich der Äußerungen des Geschäftsbereichsleiters Q., der zunächst externen Unternehmensberaterin und späteren Mitarbeiterin Frau B. sowie des Geschäftsführers B. als wahr unterstellt, handelt es sich insoweit weder um ein diskriminierendes Verhalten noch um Mobbing. Selbst wenn einige Aspekte im Verhalten der Mitarbeiter Q., B. und des Geschäftsführers B. gegenüber der Klägerin Zweifel an einem vernünftigen Führungsverhalten und an der Fähigkeit, auch in angespannter Lage höflichen Umgang zu pflegen, begründen, war die Klägerin objektiv letztlich keinem Verhalten ausgesetzt, das bezweckte oder bewirkte, dass ihre Würde verletzt und ein von Einschüchterungen, Anfeindungen, Erniedrigungen, Entwürdigungen und Beleidigungen gekennzeichnetes Umfeld geschaffen wurde. Im Übrigen hat die Beklagte von den ihr arbeitsrechtlich und betriebsverfassungsrechtlich zur Verfügung stehenden Instrumentarien Gebrauch gemacht. Mit der Androhung bestimmter Maßnahmen, der Erteilung von Abmahnungen und dem Ausspruch fristloser Kündigungen hat die Beklagte lediglich arbeitgeberseitige Befugnisse ausgeübt. Auf die Rechtmäßigkeit dieser Maßnahmen kommt es an dieser Stelle nicht an. Entwürdigendes oder Beleidigendes steht insoweit jedenfalls nicht in Rede. Es ist nicht erkennbar, dass es sich hierbei um Maßnahmen handelt, die völlig abwegig sind, nur um die Klägerin aus dem Betriebsrat bzw. dem Arbeitsverhältnis zu drängen. Es liegt weder eine unmittelbare noch eine mittelbare Benachteiligung vor. Jeder andere Arbeitnehmer, der nicht Mitglied des Betriebsrats ist, hätte bei entsprechendem Verhalten auch Abmahnungen bzw. Kündigungen erhalten. |
|
Da die Tatbestandsvoraussetzungen des § 15 AGG nicht gegeben sind, war eine Entscheidung über die nach Auffassung der Kammer unangemessene Höhe des Anspruchs und die Einhaltung der Geltendmachungsfrist nicht erforderlich. 2. |
|
Ein Anspruch auf Entschädigung und Schmerzensgeld in der geltend gemachten Höhe ergibt sich auch nicht aus § 823 Abs. 2 BGB i.V.m. §§ 7 Abs. 1, 12 AGG. |
|
Ein Verstoß gegen § 12 Abs. 1 AGG liegt nicht vor. |
|
Vorliegend kann dahinstehen, ob § 12 Abs. 1 AGG überhaupt einen Anspruch auf Entschädigung auslöst, da die Voraussetzungen nicht vorliegen. Nach § 12 Abs. 1 AGG ist der Arbeitgeber verpflichtet, die erforderlichen Maßnahmen zum Schutz vor Diskriminierungen zu treffen. Dem Vorbringen der Klägerin, weil keine AGG-Schulungen durchgeführt worden seien, sei davon auszugehen, dass die Beklagte Diskriminierungen unterstütze, kann die Kammer nicht folgen. Es ist nicht nachvollziehbar, warum zum Schutz der Mitarbeiter vor Diskriminierungen entsprechende Schulungen für Mitarbeiter durchgeführt werden sollten. Die Klägerin hat nicht behauptet, dass in irgendwelchen Abteilungen der Beklagten Diskriminierungen stattfinden würden. Sie hat lediglich vorgetragen, sie sei von der Geschäftsleitung, der Personalabteilung und Frau B. als Beraterin diskriminiert worden. Wie bereits oben dargelegt, konnte eine Diskriminierung der Klägerin nicht festgestellt werden. 3. |
|
Die Klägerin hat gegen die Beklagte auch keinen Anspruch auf Schmerzensgeld und Entschädigung wegen einer Verletzung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts und der Gesundheit durch Mobbing gem. § 280 Abs. 1 S. 1 BGB. |
|
Es kann dahinstehen, ob aufgrund der Spezialität des § 3 AGG ein Anspruch aus § 280 BGB ausgeschlossen ist, da nach Auffassung der Kammer weder eine Verletzung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts noch der Gesundheit durch Mobbing festgestellt werden kann. a) |
|
Nicht alles, was als Mobbing bezeichnet wird, ist von rechtlicher, insbesondere arbeitsrechtlicher und schadensrechtlicher Relevanz (vgl. BAG, Urteil vom 16.05.2007 - 8 AZR 709/06, juris). Da der Begriff des „Mobbing“ als solcher nicht trennscharf ist, kommt es bei der Prüfung eines Anspruchs aus § 280 Abs. 1 BGB nach allgemeinen rechtlichen Gesichtspunkten darauf an, ob durch tatsächliches Verhalten vertragliche Pflichten verletzt worden sind (vgl. BAG, Urteil vom 24.04.2008 - 8 AZR 347/07, juris; LAG Düsseldorf, Urteil vom 16.09.2010 - 11 Sa 346/10). Die Fürsorge- und Schutzpflichten des Arbeitgebers verbieten auch die Herabwürdigung und Missachtung eines Arbeitnehmers durch den Arbeitgeber. Der Arbeitnehmer hat daher Anspruch darauf, dass auf sein Wohl und seine berechtigten Interessen Rücksicht genommen und er vor Gesundheitsgefahren, auch psychischer Art, geschützt wird (BAG, Urteil vom 24.04.2008, a.a.O.). Entscheidend für die Beurteilung einer Verletzung der Fürsorge- und Schutzpflichten ist, ob der Arbeitnehmer einem Verhalten ausgesetzt ist, das bezweckt oder bewirkt, dass seine Würde verletzt und ein von Einschüchterungen, Anfeindungen, Erniedrigungen, Entwürdigungen und Beleidigungen gekennzeichnetes Umfeld geschaffen wird (BAG, Urteil vom 24.04.2008, a.a.O.). Dabei kommt es nicht auf den jeweiligen Einzelakt an. Maßgeblich ist die Zusammenfassung mehrerer Einzelakte in einem Prozess zu einer Verletzung des Persönlichkeitsrechts oder der Gesundheit des betroffenen Arbeitnehmers. |
|
Die Darlegungs- und Beweislast für das Vorliegen von als Mobbing einzustufenden Verhaltensweisen des Arbeitgebers trägt der Arbeitnehmer. Er hat konkret die Tatsachen anzugeben, aus denen er das Vorliegen von Mobbing ableitet (BAG, Urteil vom 24.04.2008, a.a.O.). b) |
| Ausgehend von diesen Grundsätzen liegt nach Auffassung der Kammer, die Behauptungen der Klägerin als wahr unterstellt, eine Verletzung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts und der Gesundheit durch Mobbinghandlungen der Beklagten nicht vor. Selbst wenn das Verhalten der Beklagten nicht immer vorbildlich war, stellt nicht jedes problematische Arbeitgeberhandeln Mobbing dar. Insbesondere kann nicht davon ausgegangen werden, dass jedes die Klägerin belastende Verhalten der Beklagten Eingriffsqualität hat und schon eine Verletzung der vertraglichen Pflicht zur Rücksichtnahme darstellt. Selbst unberechtigte Kritik, überzogene Abmahnungen oder unwirksame Kündigungen stellen nicht gleichzeitig auch eine Persönlichkeitsverletzung dar und führen zu einer Verletzung der vertraglichen Pflicht zur Rücksichtnahme. Den Äußerungen und Weisungen der Beklagten kann nicht eindeutig eine schikanöse Tendenz entnommen werden. Selbst wenn sich im Rahmen der gerichtlichen Auseinandersetzungen hinsichtlich der erteilten Abmahnungen und ausgesprochenen fristlosen Kündigungen eine Maßnahme nachträglich als rechtsunwirksam herausstellt, liegt nicht zwangsläufig eine Pflichtverletzung vor, die einen Schmerzensgeldanspruch begründen könnte. Insoweit darf nämlich nicht übersehen werden, dass der Umgang von Arbeitnehmern untereinander, mit Vorgesetzten oder dem Arbeitgeber selbst im Arbeitsleben zuweilen von Konflikten geprägt ist. Dies insbesondere auch zwischen Betriebsratsmitgliedern und dem Arbeitgeber. Bei den von der Klägerin geschilderten Vorfällen handelt es sich um übliche Auseinandersetzungen, die als Tatbestand einer Pflichtverletzung ausscheiden. Es genügt insoweit nicht, dass die Klägerin die Verhaltensweisen der Beklagten subjektiv als Einschüchterungen, Anfeindungen, Erniedrigungen, Entwürdigungen oder Beleidigungen verstanden hat. Entscheidend ist nicht das subjektive Empfinden des Arbeitnehmers, sondern eine objektive Bewertung der Umstände. Dabei ist insbesondere auch zu berücksichtigen, ob und inwieweit der Arbeitnehmer zur entstandenen Situation beigetragen hat (LAG Düsseldorf, Urteil vom 16.09.2010, a.a.O.). Nach dem Vorbringen der Klägerin handelt es sich nach Auffassung der Kammer um eine noch hinzunehmende, normale Konfliktsituation am Arbeitsplatz.
4. |
|
Aus den oben dargelegten Gründen besteht auch kein Anspruch aus § 823 Abs. 1 BGB. 5. |
|
Ein Anspruch gem. § 826 BGB scheidet aus, da dem Verhalten der Beklagten bzw. ihrer Mitarbeiter eine vorsätzliche sittenwidrige Schädigung nicht entnommen werden kann. Wie bereits oben ausgeführt, kann weder ein diskriminierendes Verhalten der Beklagten noch eine Verletzung des Persönlichkeitsrechts bzw. der Gesundheit der Klägerin durch Mobbing festgestellt werden. II. |
|
Die Klägerin hat gegen die Beklagte keinen Anspruch auf Schadensersatz in Höhe von 10.276,66 €, da über die von der Beklagten ausgesprochene fristlose Kündigung vom 02.11.2010 noch keine rechtskräftige Entscheidung ergangen ist. III. |
|
Der Feststellungsantrag ist unzulässig und unbegründet. |
|
Der Antrag ist weder hinreichend bestimmt noch hat die Klägerin ein besonderes Feststellungsinteresse dargelegt. |
|
Im Übrigen ist der Anspruch auch unbegründet, da - wie oben dargelegt - ein Anspruch auf Schadensersatz und/oder Entschädigung nicht besteht. IV. |
|
Die Klägerin hat gegen die Beklagte keinen Anspruch auf Erstattung der Kosten für die außergerichtliche Rechtsverfolgung in Höhe von 8.234,80 €. |
|
Dem Anspruch steht § 12a ArbGG entgegen. Der Ausschluss der Kostenerstattung erfasst nach ständiger Rechtsprechung des BAG auch materiell-rechtliche Kostenerstattungsansprüche im Rahmen des Schadensersatzes, gleichgültig, worauf der Anspruch gestützt wird (BAG, Beschluss vom 11.03.2008 - 3 AZN 1311/07). V. |
|
Dem Anspruch der Klägerin auf Erstattung der Kosten für die gerichtliche Rechtsverfolgung steht § 12a ArbGG entgegen. B. |
|
Die Kostenentscheidung folgt aus § 91 Abs. 1 S. 1 ZPO. Die Streitwertfestsetzung beruht auf § 3 ZPO. RECHTSMITTELBELEHRUNG Gegen diese Urteil kann von der klagenden Partei Berufung eingelegt werden. Für die beklagte Partei ist gegen dieses Urteil kein Rechtsmittel gegeben. Die Berufung muss innerhalb einer Notfrist* von einem Monat schriftlich beim Landesarbeitsgericht Düsseldorf Ludwig-Erhard-Allee 21 40227 Düsseldorf Fax: 0211-77702199 eingegangen sein. Die Notfrist beginnt mit der Zustellung des in vollständiger Form abgefassten Urteils, spätestens mit Ablauf von fünf Monaten nach dessen Verkündung. Die Berufungsschrift muss von einem Bevollmächtigten unterzeichnet sein. Als Bevollmächtigte sind nur zugelassen: 1.Rechtsanwälte, 2.Gewerkschaften und Vereinigungen von Arbeitgebern sowie Zusammenschlüsse solcher Verbände für ihre Mitglieder oder für andere Verbände oder Zusammenschlüsse mit vergleichbarer Ausrichtung und deren Mitglieder, 3.juristische Personen, deren Anteile sämtlich im wirtschaftlichen Eigentum einer der in Nummer 2 bezeichneten Organisationen stehen, wenn die juristische Person ausschließlich die Rechtsberatung und Prozessvertretung dieser Organisation und ihrer Mitglieder oder anderer Verbände oder Zusammenschlüsse mit vergleichbarer Ausrichtung und deren Mitglieder entsprechend deren Satzung durchführt, und wenn die Organisation für die Tätigkeit der Bevollmächtigten haftet. Eine Partei, die als Bevollmächtigte zugelassen ist, kann sich selbst vertreten. * Eine Notfrist ist unabänderlich und kann nicht verlängert werden. |
|
S c h o n |
|
Richterin am Arbeitsgericht |
Weitere Auskünfte erteilen Ihnen gern:
 |
Dr. Martin Hensche Rechtsanwalt Fachanwalt für Arbeitsrecht Kontakt: 030 / 26 39 620 hensche@hensche.de |
 |
Christoph Hildebrandt Rechtsanwalt Fachanwalt für Arbeitsrecht Kontakt: 030 / 26 39 620 hildebrandt@hensche.de |
 |
Nina Wesemann Rechtsanwältin Fachanwältin für Arbeitsrecht Kontakt: 040 / 69 20 68 04 wesemann@hensche.de |