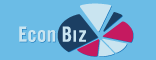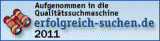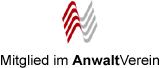- -> zur Mobil-Ansicht
- Arbeitsrecht aktuell
- Tipps und Tricks
- Handbuch Arbeitsrecht
- Gesetze zum Arbeitsrecht
- Urteile zum Arbeitsrecht
- Urteile 2023
- Urteile 2021
- Urteile 2020
- Urteile 2019
- Urteile 2018
- Urteile 2017
- Urteile 2016
- Urteile 2015
- Urteile 2014
- Urteile 2013
- Urteile 2012
- Urteile 2011
- Urteile 2010
- Urteile 2009
- Urteile 2008
- Urteile 2007
- Urteile 2006
- Urteile 2005
- Urteile 2004
- Urteile 2003
- Urteile 2002
- Urteile 2001
- Urteile 2000
- Urteile 1999
- Urteile 1998
- Urteile 1997
- Urteile 1996
- Urteile 1995
- Urteile 1994
- Urteile 1993
- Urteile 1992
- Urteile 1991
- Urteile bis 1990
- Arbeitsrecht Muster
- Videos
- Impressum-Generator
- Webinare zum Arbeitsrecht
-
Kanzlei Berlin
 030 - 26 39 62 0
030 - 26 39 62 0
 berlin@hensche.de
berlin@hensche.de
AnfahrtDetails -
Kanzlei Frankfurt
 069 - 71 03 30 04
069 - 71 03 30 04
 frankfurt@hensche.de
frankfurt@hensche.de
AnfahrtDetails -
Kanzlei Hamburg
 040 - 69 20 68 04
040 - 69 20 68 04
 hamburg@hensche.de
hamburg@hensche.de
AnfahrtDetails -
Kanzlei Hannover
 0511 - 89 97 701
0511 - 89 97 701
 hannover@hensche.de
hannover@hensche.de
AnfahrtDetails -
Kanzlei Köln
 0221 - 70 90 718
0221 - 70 90 718
 koeln@hensche.de
koeln@hensche.de
AnfahrtDetails -
Kanzlei München
 089 - 21 56 88 63
089 - 21 56 88 63
 muenchen@hensche.de
muenchen@hensche.de
AnfahrtDetails -
Kanzlei Nürnberg
 0911 - 95 33 207
0911 - 95 33 207
 nuernberg@hensche.de
nuernberg@hensche.de
AnfahrtDetails -
Kanzlei Stuttgart
 0711 - 47 09 710
0711 - 47 09 710
 stuttgart@hensche.de
stuttgart@hensche.de
AnfahrtDetails
LAG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 15.07.2010, 10 Sa 108/10
| Schlagworte: | Betriebsrat, Arbeitszeit, Arbeitsbefreiung, Freistellung | |
| Gericht: | Landesarbeitsgericht Rheinland-Pfalz | |
| Aktenzeichen: | 10 Sa 108/10 | |
| Typ: | Urteil | |
| Entscheidungsdatum: | 15.07.2010 | |
| Leitsätze: | ||
| Vorinstanzen: | Arbeitsgericht Mainz, Urteil vom 12.01.2010, 6 Ca 898/09 | |
Aktenzeichen:
10 Sa 108/10
6 Ca 898/09
ArbG Mainz
- AK Bad Kreuznach -
Entscheidung vom 15.07.2010
Tenor:
Die Berufung des Klägers gegen das Urteil des Arbeitsgerichts Mainz - Auswärtige Kammern Bad Kreuznach - vom 12. Januar 2010, Az.: 6 Ca 898/09, wird kostenpflichtig zurückgewiesen.
Die Revision wird nicht zugelassen.
Tatbestand:
Die Parteien streiten über Ansprüche auf Freizeitausgleich für Betriebsratstätigkeit außerhalb der Arbeitszeit sowie Entgeltfortzahlung.
Die Beklagte betreibt ein Unternehmen des öffentlichen Personennahverkehrs, sie beschäftigt ca. 120 Arbeitnehmer. Während der Schulferien benötigt sie dienstplanmäßig neun Fahrer weniger als in der Schulzeit. Der Kläger (geb. am 18.12.1957) ist seit April 1991 bei der Beklagten als Busfahrer zu einem Bruttomonatsentgelt von € 2.536,00 beschäftigt. Er ist Vorsitzender des siebenköpfigen Betriebsrates.
Am 16.03.2009 beantragte der Kläger, ihm für Betriebsratstätigkeit außerhalb der persönlichen Arbeitszeit, die er im ersten Quartal 2009 ausgeübt hatte, Arbeitsbefreiung nach § 37 Abs. 3 BetrVG zu gewähren. Während für den beantragten Zeitraum vom 25. bis zum 28.03.2009 Einigkeit erzielt werden konnte, lehnte die Beklagte die beantragte Arbeitsbefreiung am 10., 12. und 15.06.2009 ab. Sie schlug dem Kläger vor, ihn am 07., 08., 14., 16., 17. und 18.04.2009 - in den Osterferien - von der Arbeit zu befreien. Der Kläger erklärte sich mit einer Freistellung am 07. und 08.04.2009 einverstanden. Dagegen lehnte er die Arbeitsbefreiung am 14., 16., 17. und 18.04.2009 ab und bot ausdrücklich seine Arbeitskraft an. Die Beklagte beschäftigte den Kläger gleichwohl nicht und buchte auf seinem Zeitkonto am 14.04.2009 6:30 Stunden, am 16.04.2009 8:44 Stunden, am 17.04.2009 8:44 Stunden und am 18.04.2009 8:04 Stunden als Ausgleichszeit für Betriebsratstätigkeit ein. Hiergegen wendet sich der Kläger mit seinem Klageantrag zu 1).
Der Kläger wollte am 11. und 12.02.2009 an einer Sitzung des Konzernbetriebsrates teilnehmen. Er beantragte deshalb am 02.02.2009 Arbeitsbefreiung, die ihm am 03.02.2009 genehmigt wurde. Für Freitag, den 13.02.2009, sah der aufgestellte Dienstplan ursprünglich einen Arbeitseinsatz des Klägers von 5:01 Stunden vor. Am Samstag und Sonntag, 14. und 15.02.2009, war der Kläger nicht zum Dienst eingeteilt. Ab 16.02.2009 hatte er bis zum Monatsende Erholungsurlaub. Der Kläger war vom 09.02. bis zum 13.02.2009 arbeitsunfähig erkrankt. Ob sich die Parteien vor der Erkrankung des Klägers auf eine Arbeitsbefreiung am 13.02.2009 zum Zwecke des Ausgleichs von Überstunden für Betriebsratstätigkeit geeinigt haben, ist streitig. Mit dem Klageantrag zu 2) verlangt der Kläger Vergütung für 5:01 Stunden mit einem Stundensatz von € 12,74 brutto nebst Zulagen.
Wegen weiterer Einzelheiten des unstreitigen Sachverhalts, des streitigen Vorbringens der Parteien und der Sachanträge in erster Instanz wird gemäß § 62 Abs. 2 ArbGG Bezug genommen auf den Tatbestand des Urteils des Arbeitsgerichts Mainz - Auswärtige Kammern Bad Kreuznach - vom 12.01.2010 (dort Seite 2-5 = Bl. 121-124 d.A.).
Das Arbeitsgericht hat die Klage mit Urteil vom 12.01.2010 abgewiesen und zur Begründung ausgeführt, die Beklagte habe dem Kläger in der Zeit vom 14. bis zum 18.04.2009 wirksam gemäß § 37 Abs. 3 BetrVG Freizeit zum Ausgleich von betriebsratsbedingt angefallenen Überstunden gewährt. Der Kläger könne für den 13.02.2009 keine Entgeltfortzahlung beanspruchen, weil ohnehin keine Arbeitspflicht bestanden habe. Das Arbeitsgericht hat die Berufung wegen grundsätzlicher Bedeutung zugelassen. Wegen der Einzelheiten der Entscheidungsgründe des Arbeitsgerichts wird auf Seite 5 bis 10 des Urteils (= Bl. 124-129 d.A.) Bezug genommen.
Gegen dieses Urteil, das ihm am 10.02.2010 zugestellt worden ist, hat der Kläger mit am 08.03.2010 beim Landesarbeitsgericht eingegangenem Schriftsatz Berufung eingelegt und diese innerhalb der bis zum 10.05.2010 verlängerten Begründungsfrist am 10.05.2010 begründet.
Er ist der Ansicht, die Beklagte habe ihn im Zeitraum vom 14. bis 18.04.2009 nicht wirksam von der Arbeit freigestellt. Die zeitliche Lage der Arbeitsbefreiung gemäß § 37 Abs. 3 BetrVG könne nicht einseitig vom Arbeitgeber bestimmt werden, sondern richte sich nach den Wünschen des Betriebsratsmitglieds, sofern keine betriebsbedingten Gründe dagegen sprächen. Das Betriebsratsmitglied habe den Anspruch auf Arbeitsbefreiung geltend zu machen. Da er für die Zeit vom 14. bis zum 18.04.2009 keine Freizeitgewährung beantragt habe, könne ihn die Beklagte nicht gegen seinen Willen freistellen. Die Beklagte habe keine erheblichen Gründe dafür vorgetragen, weshalb eine Freizeitgewährung im streitigen Zeitraum zwingend erforderlich gewesen sei. Auch sein Zahlungsanspruch für den 13.02.2009 sei begründet. Die Beklagte habe den Zeitpunkt der Freizeitgewährung nachträglich und einseitig festgelegt. Sie habe mit ihm über das Abfeiern von Überstunden für die Betriebsratstätigkeit nicht gesprochen. Er sei vor dem 13.02.2009 zuletzt am 04.02.2009 im Betrieb gewesen, die Dienstplanänderung habe er nicht gekannt. Selbst wenn es ihm möglich gewesen wäre, vor seiner Erkrankung eine Dienstplanänderung festzustellen, hätte er selbst den Zeitpunkt der Freizeitgewährung geltend machen müssen. Dies sei Sache des Betriebsratsmitglieds. Wegen weiterer Einzelheiten der Berufungsbegründung wird auf den Schriftsatz des Klägers vom 10.05.2010 (Bl. 153-157 d.A.) Bezug genommen.
Der Kläger beantragt zweitinstanzlich,
das Urteil des Arbeitsgerichts Mainz - Auswärtige Kammern Bad Kreuznach - vom 12.01.2010, 6 Ca 898/09, abzuändern und die Beklagte zu verurteilen,
ihm für den 14.04.2009 6:30 Stunden, für den 16.04.2009 8:44 Stunden, für den 17.04.2009 8:44 Stunden und für den 18.04.2009 8:04 Stunden auf seinem Zeitarbeitskonto gutzuschreiben,
an ihn € 63,70 brutto und € 7,40 nebst Zinsen in Höhe von fünf Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz seit 21.04.2009 zu zahlen.
Die Beklagte beantragt,
die Berufung zurückzuweisen.
Sie verteidigt das angefochtene Urteil nach Maßgabe ihres Schriftsatzes vom 17.06.2010 (Bl. 169-175 d.A.), auf den ergänzend Bezug genommen wird. Der Kläger habe keinen Anspruch auf die beantragten Stundengutschriften. Sie habe ihm innerhalb der Monatsfrist des § 37 Abs. 3 BetrVG Arbeitsbefreiung gewährt. Wenn sich über den Freistellungszeitpunkt - wie hier - keine Einigkeit erzielen lasse, sei der Arbeitgeber in den Grenzen billigen Ermessens berechtigt, den Zeitpunkt der Arbeitsbefreiung einseitig zu bestimmen. Vorliegend habe während der Osterferien ein erheblich reduzierter Bedarf an Fahrern bestanden, so dass es möglich gewesen sei, den Kläger ohne Mehrbelastung anderer Fahrer von der Arbeit zu befreien. Der Kläger habe keinerlei Gründe angeführt, die einem Freizeitausgleich zwischen dem 14. und 18.04.2009 entgegengestanden haben könnten. Der Kläger habe keinen Anspruch auf Entgeltfortzahlung für den 13.02.2009. Sie habe sich mit dem Kläger darauf geeinigt, dass er an diesem Tag Mehrarbeitsstunden für zuvor erbrachte Betriebsratstätigkeit abfeiere. Der Dienstplan sei vor Bekanntwerden der Erkrankung des Klägers, nämlich bereits am 05.02.2009, geändert worden.
Im Übrigen wird ergänzend auf die zwischen den Parteien gewechselten Schriftsätze nebst Anlagen sowie die Sitzungsniederschrift vom 15.07.2010 (Bl. 177-179 d.A.) Bezug genommen.
Entscheidungsgründe:
I. Die Berufung des Klägers ist nach § 64 Abs. 2 lit. a) ArbGG statthaft, weil sie in dem Urteil des Arbeitsgerichts zugelassen worden ist. Die Berufungskammer ist gemäß § 64 Abs. 4 ArbGG an die Zulassung gebunden. Die Berufung ist gemäß §§ 66 Abs. 1, 64 Abs. 6 ArbGG i.V.m. §§ 517, 519 ZPO form- und fristgerecht eingelegt und begründet worden. Sie ist somit zulässig.
II. In der Sache hat die Berufung keinen Erfolg. Das Arbeitsgericht hat die Klage zu Recht abgewiesen. Die vom Kläger geltend gemachten Ansprüche bestehen nicht.
1. Der Kläger hat keinen Anspruch gegen die Beklagte auf die beantragten Stundengutschriften auf seinem Zeitarbeitskonto für die Zeit vom 14. bis zum 18.04.2009. Der Klageantrag zu 1) ist deshalb abzuweisen. Dies hat das Arbeitsgericht zutreffend erkannt.
Die Beklagte hat den Kläger am 14.04.2009 für 6:30 Stunden, am 16.04.2009 für 8:44 Stunden, am 17.04.2009 für 8:44 Stunden und am 18.04.2009 für 8:04 Stunden gemäß § 37 Abs. 3 BetrVG von seiner Arbeit unter Fortzahlung der Vergütung befreit. Da die Gewährung dieser Arbeitsbefreiung rechtmäßig war, sind die Ansprüche des Klägers durch Erfüllung erloschen (§ 362 Abs. 1 BGB). Die Beklagte befand sich nicht in Annahmeverzug.
Nach § 37 Abs. 3 Satz 1 BetrVG hat das Betriebsratsmitglied zum Ausgleich von Betriebsratstätigkeit, die aus betriebsbedingten Gründen außerhalb der Arbeitszeit durchzuführen ist, einen Anspruch auf entsprechende Arbeitsbefreiung unter Fortzahlung des Arbeitsentgelts. Der Freizeitausgleich ist nach Satz 3 dieser Vorschrift grundsätzlich vor Ablauf eines Monats zu gewähren, gerechnet ab dem Zeitpunkt der außerhalb der Arbeitszeit durchgeführten Betriebsratstätigkeit (BAG Beschluss vom 16.04.2003 - 7 AZR 423/01 - Rd. 25 - NZA 2004, 171). Ist dies aus betriebsbedingten Gründen nicht möglich, so ist die aufgewendete Zeit wie Mehrarbeit zu vergüten.
Liegen - was vorliegend unstreitig ist - die Voraussetzungen des § 37 Abs. 3 Satz 1 BetrVG vor, so besteht primär ein Anspruch des Betriebsratsmitglieds auf Freizeitausgleich. Nur wenn dieser Anspruch aus betriebsbedingten Gründen nicht vor Ablauf eines Monats erfüllt werden kann, besteht hilfsweise ein Abgeltungsanspruch auf Vergütung der aufgewendeten Zeit wie Mehrarbeit. Die Rangordnung der Ansprüche ist zwingend (DLW/ Wildschütz, 8. Aufl., Kap. 12, Rd. 633; m.w.N.). Die Regelung des § 37 Abs. 3 BetrVG geht vom Vorrang des Freizeitausgleichs vor dessen Abgeltung durch einen Vergütungsanspruch aus. Nur bei einer auf betriebsbedingten Gründen beruhenden Unmöglichkeit der Gewährung von Arbeitsbefreiung kommt eine Vergütung der aufgewendeten Zeit in Betracht. Dies dient zum einen der Begrenzung der Arbeitsbelastung des Betriebsratsmitglieds. Zum anderen soll hierdurch im Interesse der persönlichen Unabhängigkeit der Betriebsratsmitglieder soweit wie möglich verhindert werden, dass Betriebsratsmitglieder entgegen dem Ehrenamtsprinzip des § 37 Abs. 1 BetrVG durch ihre Betriebsratstätigkeit zusätzliche Vergütungsansprüche erwerben. Deshalb wandelt sich der Anspruch auf Arbeitsbefreiung weder mit Ablauf der Monatsfrist des § 37 Abs. 3 Satz 2 Halbsatz 1 BetrVG noch durch eine bloße Untätigkeit des Arbeitgebers in einen Vergütungsanspruch. Die Monatsfrist des § 37 Abs. 3 Satz 2 BetrVG ist keine Umwandlungsvorschrift. Der Vergütungsanspruch entsteht vielmehr nur, wenn die Arbeitsbefreiung aus betriebsbedingten Gründen nicht möglich ist (vgl. BAG Urteil vom 25.08.1999 - 7 AZR 713/97 - Rd. 16 - NZA 2000, 554; m.w.N.).
Über die zeitliche Lage der Arbeitsbefreiung nach § 37 Abs. 3 BetrVG hat der Arbeitgeber nach billigem Ermessen (§ 315 Abs. 1 BGB) zu entscheiden (so auch DLW/ Wildschütz, 8. Aufl., Kap. 12, Rz. 635; GK-BetrVG/ Weber, 9. Aufl., § 37 Rd. 94; Richardi/ Thüsing, BetrVG, 12. Aufl., § 37 Rd. 54; jeweils m.w.N.). Zwar wird in der Literatur teilweise die Auffassung vertreten, dass die Grundsätze für die Urlaubsgewährung entsprechend gelten, wobei sich die zeitliche Lage der Arbeitsbefreiung nach den Wünschen des Betriebsratsmitglieds richten soll, sofern keine betriebsbedingten Gründe entgegenstehen (z.B. ErfK/ Koch, 10. Aufl., § 37 Rd. 8; Fitting, BetrVG, 25. Aufl., § 37 Rd. 95, DKK/ Wedde, BetrVG, 10. Aufl., § 37 Rd. 66).
Dem kann sich die Berufungskammer nicht anschließen. Ein Vorrang der Interessen des Betriebsratsmitglieds an einer Art Zusatzurlaub ist dem Gesetz nicht zu entnehmen. Das Betriebsratsmitglied hat unter den Voraussetzungen des § 37 Abs. 3 BetrVG einen Anspruch - so wörtlich - auf „Arbeitsbefreiung“, nicht auf zusätzliche Urlaubstage. Urlaubsansprüche und Ansprüche auf Arbeitsbefreiung unterscheiden sich inhaltlich in mehrfacher Hinsicht. Nach § 7 Abs. 1 Satz 1 BUrlG kann der Arbeitgeber die zeitliche Lage eines Urlaubswunsches lediglich aus den im Gesetz genannten Gründen ablehnen. Bei der zeitlichen Festlegung von Ansprüchen auf Freizeitausgleich hat er dagegen (nur) billiges Ermessen nach § 106 Satz 1 GewO, § 315 BGB auszuüben, soweit sein Ermessen nicht durch Gesetz, Kollektivrecht oder Vertrag beschränkt ist (vgl. BAG Urteil vom 19.01.2010 - 9 AZR 426/09 - Rd. 17, Juris). Den berechtigten Interessen des Arbeitnehmers trägt die Pflicht des Arbeitgebers gemäß § 106 Satz 1 GewO Rechnung, bei Ausübung seines Weisungsrechts die Grenzen billigen Ermessens nach § 315 Abs. 3 BGB einzuhalten. Damit muss er auch auf die berechtigten Interessen des Arbeitnehmers an der Planbarkeit seiner Freizeit Rücksicht nehmen (vgl. BAG Urteil vom 19.05.2009 - 9 AZR 433/08 - Rd. 28, 29, NZA 2009, 1211).
Die Beklagte hat vorliegend die Grenzen billigen Ermessens gewahrt. Der Kläger hatte im ersten Quartal 2009 aus betriebsbedingten Gründen insgesamt 77,16 Stunden Betriebsratstätigkeiten außerhalb seiner persönlichen Arbeitszeit durchgeführt. Die Beklagte hatte den Freizeitausgleich grundsätzlich vor Ablauf eines Monats zu erfüllen. Sie war deshalb nicht gezwungen, dem Antrag des Klägers vom 16.03.2009, ihm am 10., 12. und 15.06.2009 Arbeitsbefreiung zu gewähren, stattzugeben. Müsste sich die Arbeitgeberin allein nach den Wünschen des Betriebsratsmitglieds richten, könnte das Betriebsratsmitglied entgegen dem Ehrenamtsprinzip des § 37 Abs. 1 BetrVG durch seine Betriebsratstätigkeit hohe Freizeitausgleichsansprüche ansammeln und diese als eine Art Zusatzurlaub nach Gutdünken abbauen. Das ist nicht Sinn und Zweck des § 37 Abs. 3 BetrVG. Der Arbeitgeber kann durch die Gewährung des Freizeitausgleichs vielmehr ein solches Ansammeln verhindern und damit erreichen, dass der Ausgleich zeitnah
- möglichst innerhalb der Monatsfrist - genommen wird.
Die Beklagte hat den Kläger in den Osterferien zwischen dem 14. und 18.04.2009 wirksam von der Arbeit befreit. In den Schulferien bestand unstreitig ein erheblich reduzierter Bedarf an Fahrern, so dass sich die Arbeitsbefreiung des Klägers ohne Mehrbelastung anderer Arbeitnehmer durchführen ließ. Der Kläger hat - außer seinem entgegenstehenden Willen - keinerlei Gründe angeführt, die einer Arbeitsbefreiung in den Osterferien entgegenstanden. Nach alledem hat die Beklagte mit ihrer Entscheidung, den Kläger am 14., 16., 17. und 18.04.2009 von der Arbeit zu befreien, die Grenzen billigen Ermessens nicht überschritten. Ein Anspruch des Klägers, ihm die abgebauten Stunden auf seinem Zeitarbeitskonto wieder gutzuschreiben, besteht nicht.
2. Der Kläger hat keinen Anspruch gegen die Beklagte auf Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall für den 13.02.2009. Deshalb ist auch der Klageantrag zu 2) abzuweisen. Auch dies hat das Arbeitsgericht zutreffend erkannt.
Die Beklagte hat dem Kläger am 13.02.2009 unter Fortzahlung des Arbeitsentgeltes Freizeitausgleich gemäß § 37 Abs. 3 BetrVG im Umfang von 5:01 Stunden gewährt. Der Kläger kann nicht zusätzlich noch Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall und damit eine „doppelte Bezahlung“ für diesen Tag verlangen. Der 13.02.2009 ist von der Beklagten bereits vor der Erkrankung des Klägers (vom 09.02. bis zum 13.02.2009) verbindlich als bezahlter Freizeitausgleichstag festgelegt worden. Aus dem Umstand, dass er an diesem Tag durch eine Erkrankung arbeitsunfähig war, kann der Kläger keine zusätzliche Zahlungsverpflichtung der Beklagten herleiten.
Wenn ein Arbeitnehmer - wie hier - an einem bezahlten arbeitsfreien Tag erkrankt, der nicht Urlaub ist, kann er nicht zusätzlich Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall verlangen (so schon BAG Urteil vom 04.09.1985 - 7 AZR 531/82 - AP Nr. 13 zu § 17 BAT). Die Rechtsgrundsätze der Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall sichern nur die Vergütung des Arbeitnehmers, nicht aber die Nutzung seiner Freizeit. Dem Kläger konnte am 13.02.2009 angesichts der unstreitig fortgezahlten Vergütung nach § 37 Abs. 3 BetrVG durch seine krankheitsbedingte Arbeitsunfähigkeit kein Einkommensverlust entstehen. Seine Erkrankung hatte keinen Einfluss auf die Wirksamkeit der ihm von der Beklagten erteilten Arbeitsbefreiung. Die Arbeitsbefreiung des Klägers am 13.02.2009 ist bereits vor seiner Erkrankung ab dem 09.02.2009, einem Montag, festgelegt worden. Der Dienstplan wurde vor der Erkrankung des Klägers, bereits am 05.02.2009, einem Donnerstag, geändert. Damit war die Zeit der Arbeitsbefreiung schon vor der Erkrankung des Klägers bekanntgegeben. Hierauf kommt es an. Es kann deshalb dahinstehen, ob sich die Parteien am 03.02.2009 auf die Arbeitsbefreiung am 13.02.2009 geeinigt haben, was der Kläger bestreitet. Dass er den - bereits vor seiner Erkrankung - geänderten Dienstplan nicht zur Kenntnis genommen hat, fällt nicht in die Risikosphäre der Beklagten.
III. Nach alledem ist die Berufung des Klägers mit der Kostenfolge aus § 97 Abs. 1 ZPO zurückzuweisen.
Ein Grund, der nach den hierfür maßgeblichen gesetzlichen Kriterien des § 72 Abs. 2 ArbGG die Zulassung der Revision rechtfertigen könnte, besteht nicht.
Weitere Auskünfte erteilen Ihnen gern:
 |
Dr. Martin Hensche Rechtsanwalt Fachanwalt für Arbeitsrecht Kontakt: 030 / 26 39 620 hensche@hensche.de |
 |
Christoph Hildebrandt Rechtsanwalt Fachanwalt für Arbeitsrecht Kontakt: 030 / 26 39 620 hildebrandt@hensche.de |
 |
Nina Wesemann Rechtsanwältin Fachanwältin für Arbeitsrecht Kontakt: 040 / 69 20 68 04 wesemann@hensche.de |