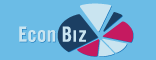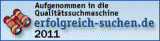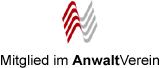- -> zur Mobil-Ansicht
- Arbeitsrecht aktuell
- Tipps und Tricks
- Handbuch Arbeitsrecht
- Gesetze zum Arbeitsrecht
- Urteile zum Arbeitsrecht
- Urteile 2023
- Urteile 2021
- Urteile 2020
- Urteile 2019
- Urteile 2018
- Urteile 2017
- Urteile 2016
- Urteile 2015
- Urteile 2014
- Urteile 2013
- Urteile 2012
- Urteile 2011
- Urteile 2010
- Urteile 2009
- Urteile 2008
- Urteile 2007
- Urteile 2006
- Urteile 2005
- Urteile 2004
- Urteile 2003
- Urteile 2002
- Urteile 2001
- Urteile 2000
- Urteile 1999
- Urteile 1998
- Urteile 1997
- Urteile 1996
- Urteile 1995
- Urteile 1994
- Urteile 1993
- Urteile 1992
- Urteile 1991
- Urteile bis 1990
- Arbeitsrecht Muster
- Videos
- Impressum-Generator
- Webinare zum Arbeitsrecht
-
Kanzlei Berlin
 030 - 26 39 62 0
030 - 26 39 62 0
 berlin@hensche.de
berlin@hensche.de
AnfahrtDetails -
Kanzlei Frankfurt
 069 - 71 03 30 04
069 - 71 03 30 04
 frankfurt@hensche.de
frankfurt@hensche.de
AnfahrtDetails -
Kanzlei Hamburg
 040 - 69 20 68 04
040 - 69 20 68 04
 hamburg@hensche.de
hamburg@hensche.de
AnfahrtDetails -
Kanzlei Hannover
 0511 - 89 97 701
0511 - 89 97 701
 hannover@hensche.de
hannover@hensche.de
AnfahrtDetails -
Kanzlei Köln
 0221 - 70 90 718
0221 - 70 90 718
 koeln@hensche.de
koeln@hensche.de
AnfahrtDetails -
Kanzlei München
 089 - 21 56 88 63
089 - 21 56 88 63
 muenchen@hensche.de
muenchen@hensche.de
AnfahrtDetails -
Kanzlei Nürnberg
 0911 - 95 33 207
0911 - 95 33 207
 nuernberg@hensche.de
nuernberg@hensche.de
AnfahrtDetails -
Kanzlei Stuttgart
 0711 - 47 09 710
0711 - 47 09 710
 stuttgart@hensche.de
stuttgart@hensche.de
AnfahrtDetails
BGH, Urteil vom 17.07.2009, 5 StR 394/08
| Schlagworte: | Compliance Officer, Strafbarkeit, Haftung | |
| Gericht: | Bundesgerichtshof | |
| Aktenzeichen: | 5 StR 394/08 | |
| Typ: | Urteil | |
| Entscheidungsdatum: | 17.07.2009 | |
| Leitsätze: | ||
| Vorinstanzen: | ||
5 StR 394/08
BUNDESGERICHTSHOF
IM NAMEN DES VOLKES
URTEIL
vom 17. Juli 2009
in der Strafsache
gegen
wegen Beihilfe zum Betrug
- 2 -
Der 5. Strafsenat des Bundesgerichtshofs hat auf Grund der Hauptverhandlung vom 16. und 17. Juli 2009, an der teilgenommen haben:
Vorsitzender Richter Basdorf,
Richter Dr. Raum, Richter Dr. Brause,
Richterin Dr. Schneider,
Richter Dölp
als beisitzende Richter,
Bundesanwalt
als Vertreter der Bundesanwaltschaft,
Rechtsanwältin
als Verteidigerin,
Justizangestellte
als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle,
- 3 -
am 17. Juli 2009 für Recht erkannt:
Die Revision des Angeklagten W. gegen das Urteil des Landgerichts Berlin vom 3. März 2008 wird verworfen.
Der Angeklagte W. trägt die Kosten seines Rechtsmittels.
– Von Rechts wegen –
G r ü n d e
Das Landgericht hat den Angeklagten W. wegen Beihilfe (durch Unterlassen) zum Betrug zu einer Geldstrafe von 120 Tagessätzen verurteilt und angeordnet, dass als Entschädigung für die überlange Verfahrensdauer 20 Tagessätze als vollstreckt gelten. Die umfassend eingelegte und mit formellen und materiellen Beanstandungen geführte Revision dieses Angeklagten bleibt erfolglos.
I.
Das Landgericht hat folgende Feststellungen und Wertungen getroffen:
1. Der Angeklagte war seit 1989 als Volljurist bei den Berliner Stadtreinigungsbetrieben (im Folgenden: BSR) tätig und seit Anfang 1998 Leiter des Stabsbereichs Gremienbetreuung sowie Leiter der Rechtsabteilung. Zwischen 2000 und Ende 2002 war ihm zudem die Innenrevision unterstellt. Der BSR, einer Anstalt des öffentlichen Rechts, oblag in ihrem hoheitlichen Be-
- 4 -
reich die Straßenreinigung mit Anschluss- und Benutzungszwang für die Eigentümer der Anliegergrundstücke. Die Rechtsverhältnisse waren zwar privatrechtlich ausgestaltet; für die Bestimmung der Entgelte galten jedoch das Äquivalenz- und das Kostendeckungsprinzip als öffentlich-rechtliche Grundsätze der Gebührenbemessung.
Nach den Regelungen des Berliner Straßenreinigungsgesetzes hatten die Anlieger 75 % der angefallenen Kosten für die Straßenreinigung zu tragen; 25 % der Kosten verblieben beim Land Berlin (§ 7 Abs. 1). Die Aufwendungen der Reinigung für Straßen ohne Anlieger musste das Land Berlin im vollen Umfang tragen (§ 7 Abs. 6). Die Entgelte, die sich nach der Häufigkeit der Reinigung in vier Tarifklassen unterteilten, wurden für den Tarifzeitraum auf der Grundlage einer Prognose der voraussichtlichen Aufwendungen festgesetzt. Die von Vorstand und Aufsichtsrat zu verabschiedende Tarifbestimmung wurde durch eine Projektgruppe „Tarifkalkulation“ vorbereitet, die der Angeklagte W. leitete. Infolge eines Versehens wurden bei der Berechnung der Entgelte der Tarifperiode 1999/2000 auch die Kosten für die Straßen zu 75 % einbezogen, für die es keine Anlieger gab; diese hätte das Land Berlin vollständig tragen müssen. Der Berechnungsfehler wurde in der Folgezeit bemerkt, aber nicht korrigiert.
Für die Tarifperiode 2001/2002, den Tatzeitraum, wurde vom Gesamtvorstand der BSR eine neue Projektgruppe eingesetzt. Dieser gehörte der Angeklagte W. nicht mehr an. Sie wurde von dem früheren Mitangeklagten H. geleitet, der im Stabsbereich tätig und dem Angeklagten W. unmittelbar unterstellt war. Der Angeklagte W. nahm selbst unregelmäßig an den Sitzungen der neuen Projektgruppe teil, die zunächst den Rechnungsfehler aus der vergangenen Tarifperiode beheben wollte. Auf Weisung des früheren Mitangeklagten G. wurde dies jedoch unterlassen. Der Tarif, in dessen Berechnungsgrundlage auch die anliegerfreien Straßen einbezogen worden waren, wurde vom Vorstand und Aufsichtsrat der BSR gebilligt, wobei jeweils die Tarife erläutert wurden, ohne jedoch die
- 5 -
Entscheidungsträger auf die Einbeziehung der anliegerfreien Straßen hinzuweisen. Der Angeklagte W. , der um den Berechnungsfehler wusste, war bei der Sitzung des Gesamtvorstands nicht anwesend. Bei der Sitzung des Aufsichtsrats führte er zwar Protokoll; eine weitere Beteiligung seinerseits konnte das Landgericht jedoch nicht feststellen. Der Angeklagte W. unterrichtete auch in der Folgezeit weder seinen unmittelbaren Vorgesetzten, den Vorstandsvorsitzenden D. , noch ein Mitglied des Aufsichtsrats. Die Senatsverwaltung genehmigte den Tarif. Dabei verpflichtete sie die BSR allerdings im Wege einer Auflage zu einer Nachkalkulation. Auf der Grundlage des genehmigten Tarifs wurden von den Eigentümern der Anliegergrundstücke um insgesamt 23 Mio. Euro überhöhte Entgelte verlangt, die auch überwiegend bezahlt wurden.
2. Das Landgericht hat das Verhalten des vormaligen Mitangeklagten G. im Blick auf die gesamte Tarifperiode 2001/2002 als (einheitlichen) Betrug in mittelbarer Täterschaft gewertet. Der Angeklagte W. habe hierzu Beihilfe geleistet. Ein aktives Handeln des Angeklagten W. , dem die falsche Tarifberechnung bekannt gewesen sei, lasse sich nicht zweifelsfrei feststellen. Er habe sich jedoch der Beihilfe durch Unterlassen schuldig gemacht. Eine Garantenstellung im Sinne des § 13 StGB ergebe sich daraus, dass er als Leiter der Tarifkommission den Bewertungsfehler in der vorigen Periode zu vertreten habe und dessen Behebung in der folgenden Tarifperiode hätte veranlassen müssen. Zudem komme ihm als Leiter der Innenrevision eine Garantenstellung zu. In dieser Eigenschaft, zumal als Bediensteter einer Anstalt des öffentlichen Rechts, sei er nämlich verpflichtet, die Einhaltung der gesetzlichen Regeln auch zum Schutz der Entgeltschuldner sicherzustellen. Da sich der Angeklagte W. dem Handeln des früheren Mitangeklagten G. untergeordnet habe, liege bei ihm lediglich ein Gehilfenvorsatz vor.
- 6 -
II.
Die Revision des Angeklagten W. ist unbegründet.
1. Die Verfahrensrügen bleiben ohne Erfolg.
a) Die Besetzungsrüge zeigt keinen Rechtsfehler auf. Wie der Senat im Beschluss vom 24. März 2009 (NStZ 2009, 342; hierzu Volkmer NStZ 2009, 371) seine eigene Besetzung betreffend ausgeführt hat, ist Verletzter im Sinne des § 22 Nr. 1 i.V.m. § 338 Nr. 2 StPO nicht bereits ein Mieter, auf den – abhängig von den vertraglichen Vereinbarungen – die Reinigungsentgelte umgelegt werden können. Entgegen der Auffassung der Revision begründet auch der Umstand, dass der Vater des Richters We. an einem in einer Gesellschaft bürgerlichen Rechts organisierten Fonds beteiligt ist, keinen Ausschlussgrund. Dieser Fonds ist selbst nicht Eigentümer. Vielmehr wird das Eigentum treuhänderisch von einer GmbH gehalten. Eine über den Fonds und die Treuhand doppelt vermittelte und nur indirekte Berührung der wirtschaftlichen Interessen des Vaters des Richters We. ist – wie das Landgericht zutreffend ausgeführt hat – für einen Ausschluss nach § 22 Nr. 3 StPO nicht ausreichend.
b) Das Landgericht hat den Antrag auf Vernehmung des Zeugen R. rechtsfehlerfrei zurückgewiesen. Die Verteidigung hat die Vernehmung dieses Zeugen, der Nachfolger des Angeklagten als Leiter der Innenrevision war, zum Beweis für die Verhältnisse bei der Innenrevision und deren Anbindung an den Vorstand beantragt. Das Landgericht hat die beantragte Beweiserhebung abgelehnt, weil die Frage, wie die Innenrevision personell strukturiert war und welche Prüfaufträge dort abgearbeitet werden, für die Garantenstellung ohne Bedeutung ist.
Dies ist aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden. Für die Frage einer aus dieser Stellung folgenden Garantenpflicht ist es unerheblich, ob die In-
- 7 -
nenrevision die Tarifbildung geprüft hat oder diese überhaupt aufgrund ihrer geringen personellen Ausstattung hätte prüfen können. Das Landgericht hat nämlich die Garantenstellung nicht aus einer konkret erfolgten Prüfung der Tarife hergeleitet, sondern sie vielmehr darauf gestützt, dass der Angeklagte als Leiter der Innenrevision eine besondere Pflichtenstellung innehatte, eine betrügerische Tarifbildung zu verhindern.
c) Ohne Erfolg rügt die Verteidigung, dass das Landgericht nicht sämtliche (ca. 170.000) Grundstückseigentümer als Zeugen über ihre jeweiligen Vorstellungen bei dem Erhalt der (rechtwidrig überhöhten) Abrechnungen der BSR gehört hat. Die Strafkammer hat diesen Antrag als bloßen Beweisermittlungsantrag angesehen.
aa) Diese Auffassung ist aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden. Entgegen der Auffassung der Verteidigung hat das Landgericht diesen Antrag schon deshalb zu Recht nicht als einen nach § 244 Abs. 3 StPO zu be-scheidenden Beweisantrag angesehen, weil die Zeugen nicht mit Namen und vollständiger Anschrift genannt wurden. Dies ist aber erforderlich (BGHSt 40, 3, 7; Beschluss vom 28. Mai 2009 – 5 StR 191/09 – zur Veröffentlichung bestimmt in BGHR StPO § 244 Abs. 6 Beweisantrag). Eine Ausnahme gilt allenfalls insoweit, als der Antragsteller außerstande ist, die vollständige Anschrift zu benennen. Dies ist nicht ersichtlich. Abgesehen davon, dass der Angeklagte selbst in der Lage gewesen wäre, eine Reihe von Grundstückseigentümern mit vollständiger Adresse allein aus seinem Wissen zu bezeichnen und schon dies nicht getan hat, ist nicht erkennbar, dass er diese Daten nicht über seine Arbeitgeberin hätte besorgen und dem Landgericht vorlegen können.
bb) Auch in der Sache hätte das Landgericht der beantragten Beweiserhebung nicht nachkommen müssen. Bei einer im Wesentlichen auf eine Zahlungsanforderung beschränkten Erklärung reichte es – wie der Senat in seinem Beschluss vom 9. Juni 2009 bezüglich des Mitangeklagten G.
- 8 -
in derselben Sache bereits ausgeführt hat – für einen Irrtum im Sinne des § 263 StGB aus, wenn sich die Empfänger in einer wenngleich allgemein gehaltenen Vorstellung befanden, dass die Tarifberechnung in Ordnung sei. Ein differenziertes Vorstellungsbild bei den einzelnen Empfängern der Rechnungen liegt hier fern. Insoweit weicht die Fallkonstellation im vorliegenden Fall von den von der Revision in Bezug genommenen Entscheidungen des Bundesgerichtshofs (BGHR StGB § 263 Abs. 1 Irrtum 9, 11) ab, die von den Geschädigten individuell zu bearbeitende Rechnungen oder Überweisungen zum Gegenstand hatten. Diese Fälle unterscheiden sich von dem hier vorliegenden schon dadurch, dass die Entgeltforderung hier für den jeweiligen Grundstückseigentümer eine wirtschaftlich nicht sehr gewichtige und auch völlig unauffällige Erklärung darstellte. Bei dem einzelnen Empfänger konnte deshalb nur das von dem sachgedanklichen Mitbewusstsein umfasste Vorstellungsbild entstanden sein, dass die Abrechnung jedenfalls nicht betrügerisch sei.
cc) Dieses von ihm angenommene und im Wesentlichen normativ geprägte Vorstellungsbild der Empfänger hat das Landgericht zudem erhärtet, indem es mehrere Zeugen einvernommen hat und in deren Aussagen dieses Ergebnis bestätigt fand. Angesichts dieses Befunds – zumal mit Blick auf die abgeurteilte einheitliche Tat – bedurfte es keiner weiteren Aufklärung durch die zusätzliche Vernehmung weiterer Zeugen. Dass das Landgericht in den Urteilsgründen nur die Aussage von drei dieser Zeugen wiedergegeben hat, verstößt nicht gegen §§ 261, 267 Abs. 1 Satz 2 StPO. Das Tatgericht ist nicht gehalten, sämtliche Zeugenaussagen zu dokumentieren.
2. Die Revision des Angeklagten zeigt auch mit der Sachrüge keinen durchgreifenden Rechtsfehler auf.
a) Soweit die Revision die strafrechtliche Würdigung der Haupttat als Betrug in mittelbarer Täterschaft angreift, verweist der Senat auf seine Entscheidung, die er am 9. Juni 2009 im Beschlusswege gegen den Mitange-
- 9 -
klagten G. getroffen hat. Die Ausführungen der Verteidigung geben dem Senat keinen Anlass zu weiteren Ausführungen im Hinblick auf die Tatbestandsvoraussetzungen des Betrugs oder zum Nichtvorliegen der speziellen Strafvorschriften der §§ 352, 353 StGB.
Entgegen der Auffassung der Verteidigung ist bei dem Angeklagten auch die Kenntnis von der Haupttat belegt. Nach den Feststellungen des Landgerichts wurde der Angeklagte nämlich durch den ihm direkt unterstellten H. darüber in Kenntnis gesetzt, dass G. den Fehler so „laufen lassen wolle“. Im Übrigen führte der Angeklagte bei der entscheidenden Sitzung des Aufsichtsrats Protokoll, in der die unrichtig berechneten Tarife von G. vorgestellt und vom Aufsichtsrat schließlich gebilligt wurden.
b) Die Verurteilung des Angeklagten wegen Beihilfe zum Betrug hält im Ergebnis rechtlicher Überprüfung stand. Das Landgericht hat bei dem An-geklagten zu Recht eine Garantenstellung bejaht.
aa) Allerdings ergibt sich diese nicht schon daraus, dass der Angeklagte die Tarifkommission für die vorherige (nicht verfahrensgegenständliche) Abrechnungsperiode geleitet hatte. Zwar unterlief dieser von ihm geführten Kommission bereits der Fehler, dass die anliegerfreien Grundstücke in den Tarif einbezogen wurden. Eine Garantenstellung folgt hieraus jedoch nicht.
In Betracht käme insoweit eine Garantenstellung aus der tatsächlichen Herbeiführung einer Gefahrenlage (Ingerenz). Ein (pflichtwidriges) Vorverhalten begründet aber nur dann eine Garantenstellung, wenn es die naheliegende Gefahr des Eintritts des konkret untersuchten, tatbestandsmäßigen Erfolgs verursacht (BGHR StGB § 13 Abs. 1 Garantenstellung 14; BGH NJW 1999, 69, 71, insoweit in BGHSt 44, 196 nicht abgedruckt; BGH NStZ 2000, 583). Eine solche nahe Gefahr bestand hier nicht. Der Umstand, dass die vorherige Tariffestsetzung fehlerbehaftet war, bedeutet nämlich nicht, dass
- 10 -
sich dieser Fehler auch in die nächste Tarifperiode hinein fortsetzt. Dies gilt jedenfalls, sofern nicht – wofür hier nichts festgestellt ist – eine gesteigerte Gefahr bestand, dass die zunächst unerkannt fehlerhafte Berechnungsgrundlage ohne erneute sachliche Prüfung der neuen Festsetzung ohne weiteres zugrunde gelegt würde. Vielmehr wird in der nächsten Tarifperiode der Tarif uneingeschränkt neu bestimmt. Schon die ausschließliche Verantwortlichkeit der neuen Tarifkommission steht deshalb der Annahme einer Garantenstellung aus Ingerenz entgegen (vgl. Roxin, Strafrecht AT II 2003 S. 773). Zwar mag eine gewisse, eher psychologisch vermittelte Gefahr bestehen, zur Vertuschung des einmal gemachten Fehlers diesen zu wiederholen. Ein solcher motivatorischer Zusammenhang reicht jedoch nicht für die Begründung einer Garantenstellung aus. Der neue Tarif wird auf der Grundlage der hierfür maßgeblichen Rahmendaten selbständig festgesetzt. Seine Festsetzung erfolgt ohne Bindung an den Berechnungsmaßstab der Vorperioden, dessen Fehlerhaftigkeit nicht einmal zwangsläufig hätte aufgedeckt werden müssen. Auch ohne Eingreifen des Angeklagten wäre der Fehler nicht automatisch in die folgende Tarifperiode eingeflossen. Dies zeigt sich im Übrigen auch darin, dass die neue Tarifkommission bereits von sich aus diesen Fehler nicht wiederholen wollte, sondern hierzu erst durch die Einflussnahme des vormaligen Mitangeklagten G. veranlasst wurde.
bb) Dagegen hat das Landgericht zu Recht aus der Stellung des Angeklagten W. als Leiter der Rechtsabteilung und der Innenrevision eine Garantenstellung hergeleitet.
(1) Durch die Übernahme eines Pflichtenkreises kann eine rechtliche Einstandspflicht im Sinne des § 13 Abs. 1 StGB begründet werden. Die Entstehung einer Garantenstellung hieraus folgt aus der Überlegung, dass denjenigen, dem Obhutspflichten für eine bestimmte Gefahrenquelle übertragen sind (vgl. Roxin aaO S. 712 ff.), dann auch eine „Sonderverantwortlichkeit“ für die Integrität des von ihm übernommenen Verantwortungsbereichs trifft (vgl. Freund in MünchKomm StGB § 13 Rdn. 161). Es kann dahinstehen, ob
- 11 -
der verbreiteten Unterscheidung von Schutz- und Überwachungspflichten in diesem Zusammenhang wesentliches Gewicht zukommen kann, weil die Überwachungspflicht gerade dem Schutz bestimmter Rechtsgüter dient und umgekehrt ein Schutz ohne entsprechende Überwachung des zu schützenden Objekts kaum denkbar erscheint (vgl. BGHSt 48, 77, 92). Maßgeblich ist die Bestimmung des Verantwortungsbereichs, den der Verpflichtete übernommen hat. Dabei kommt es nicht auf die Rechtsform der Übertragung an, sondern darauf, was unter Berücksichtigung des normativen Hintergrunds Inhalt der Pflichtenbindung ist (vgl. BGHSt 43, 82).
Die Rechtsprechung hat bislang in einer Reihe von Fällen Garantenstellungen anerkannt, die aus der Übernahme von bestimmten Funktionen abgeleitet wurden. Dies betraf nicht nur hohe staatliche oder kommunale Repräsentanten, denen der Schutz von Leib und Leben der ihnen anvertrauten Bürger obliegt (BGHSt 38, 325; 48, 77, 91), sondern auch Polizeibeamte (BGHSt 38, 388), Beamte der Ordnungsbehörde (BGH NJW 1987, 199) oder auch Bedienstete im Maßregelvollzug (BGH NJW 1983, 462). Eine Garantenpflicht wird weiterhin dadurch begründet, dass der Betreffende eine gesetzlich vorgesehene Funktion als Beauftragter übernimmt (vgl. OLG Frankfurt NJW 1987, 2753, 2757; Böse NStZ 2003, 636), etwa als Beauftragter für Gewässerschutz (§§ 21a ff. WHG), Immissionsschutz (§§ 53 ff. BImSchG) oder Strahlenschutz (§§ 31 ff. StrahlenschutzVO).
Die Übernahme entsprechender Überwachungs- und Schutzpflichten kann aber auch durch einen Dienstvertrag erfolgen. Dabei reicht freilich der bloße Vertragsschluss nicht aus. Maßgebend für die Begründung einer Garantenstellung ist vielmehr die tatsächliche Übernahme des Pflichtenkreises. Allerdings begründet nicht jede Übertragung von Pflichten auch eine Garantenstellung im strafrechtlichen Sinne. Hinzutreten muss regelmäßig ein besonderes Vertrauensverhältnis, das den Übertragenden gerade dazu veranlasst, dem Verpflichteten besondere Schutzpflichten zu überantworten (vgl. BGHSt 46, 196, 202 f.; 39, 392, 399). Ein bloßer Austauschvertrag genügt
- 12 -
hier ebenso wenig wie ein Arbeitsverhältnis (Weigend in LK 12. Aufl. § 13 Rdn. 41). Im vorliegenden Fall kann nicht zweifelhaft sein, dass der Angeklagte aufgrund des übernommenen Aufgabenbereichs eine Garantenstellung innehatte. Entgegen der Auffassung der Verteidigung und des Generalbundesanwalts beschränkte sich seine Einstandspflicht jedoch nicht nur darauf, Vermögensbeeinträchtigungen des eigenen Unternehmens zu unterbinden, sondern sie kann auch die Verhinderung aus dem eigenen Unternehmen kommender Straftaten gegen dessen Vertragspartner umfassen.
(2) Der Inhalt und der Umfang der Garantenpflicht bestimmen sich aus dem konkreten Pflichtenkreis, den der Verantwortliche übernommen hat. Dabei ist auf die besonderen Verhältnisse des Unternehmens und den Zweck seiner Beauftragung abzustellen. Entscheidend kommt es auf die Zielrichtung der Beauftragung an, ob sich die Pflichtenstellung des Beauftragten allein darin erschöpft, die unternehmensinternen Prozesse zu optimieren und gegen das Unternehmen gerichtete Pflichtverstöße aufzudecken und zukünftig zu verhindern, oder ob der Beauftragte weitergehende Pflichten dergestalt hat, dass er auch vom Unternehmen ausgehende Rechtsverstöße zu beanstanden und zu unterbinden hat. Unter diesen Gesichtspunkten ist gegebenenfalls die Beschreibung des Dienstpostens zu bewerten.
Eine solche, neuerdings in Großunternehmen als „Compliance“ bezeichnete Ausrichtung, wird im Wirtschaftsleben mittlerweile dadurch umgesetzt, dass so genannte „Compliance Officers“ geschaffen werden (vgl. BGHSt 52, 323, 335; Hauschka, Corporate Compliance 2007 S. 2 ff.). Deren Aufgabengebiet ist die Verhinderung von Rechtsverstößen, insbesondere auch von Straftaten, die aus dem Unternehmen heraus begangen werden und diesem erhebliche Nachteile durch Haftungsrisiken oder Ansehensverlust bringen können (vgl. Bürkle in Hauschka aaO S. 128 ff.). Derartige Beauftragte wird regelmäßig strafrechtlich eine Garantenpflicht im Sinne des § 13 Abs. 1 StGB treffen, solche im Zusammenhang mit der Tätigkeit des Unternehmens stehende Straftaten von Unternehmensangehörigen zu ver-
- 13 -
hindern. Dies ist die notwendige Kehrseite ihrer gegenüber der Unternehmensleitung übernommenen Pflicht, Rechtsverstöße und insbesondere Straf-taten zu unterbinden (vgl. Kraft/Winkler CCZ 2009, 29, 32).
Eine derart weitgehende Beauftragung ist bei dem Angeklagten nicht ersichtlich. Nach den Feststellungen war der Angeklagte als Jurist Leiter der Rechtsabteilung und zugleich Leiter der Innenrevision. Er war unmittelbar dem Vorstandsvorsitzenden unterstellt. Zwar gibt es zwischen dem Leiter der Innenrevision und dem so genannten „Compliance Officer“ regelmäßig erhebliche Überschneidungen im Aufgabengebiet (vgl. Bürkle aaO S. 139). Dennoch erscheint es zweifelhaft, dem Leiter der Innenrevision eines Unternehmens eine Garantenstellung auch insoweit zuzuweisen, als er im Sinne des § 13 Abs. 1 StGB verpflichtet ist, Straftaten aus dem Unternehmen zu Lasten Dritter zu unterbinden.
Im vorliegenden Fall bestehen indes zwei Besonderheiten: Das hier tätige Unternehmen ist eine Anstalt des öffentlichen Rechts und die vom Angeklagten nicht unterbundene Tätigkeit bezog sich auf den hoheitlichen Bereich des Unternehmens, nämlich die durch den Anschluss- und Benutzungszwang geprägte Straßenreinigung, die gegenüber den Anliegern nach öffentlich-rechtlichen Gebührengrundsätzen abzurechnen ist. Dies hat für die Eingrenzung der dem Angeklagten obliegenden Überwachungspflichten Bedeutung. Als Anstalt des öffentlichen Rechts war die BSR den Anliegern gegenüber zu gesetzmäßigen Gebührenberechnungen verpflichtet. Anders als ein privates Unternehmen, das lediglich innerhalb eines rechtlichen Rahmens, den es zu beachten hat, maßgeblich zur Gewinnerzielung tätig wird, ist bei einer Anstalt des öffentlichen Rechts der Gesetzesvollzug das eigentliche Kernstück ihrer Tätigkeit. Dies bedeutet auch, dass die Erfüllung dieser Aufgaben in gesetzmäßiger Form zentraler Bestandteil ihres „unternehmerischen“ Handelns ist. Damit entfällt im hoheitlichen Bereich die Trennung zwischen einerseits den Interessen des eigenen Unternehmens und andererseits den Interessen außenstehender Dritter. Dies wirkt sich auf die Ausle-
- 14 -
gung der Überwachungspflicht aus, weil das, was zu überwachen ist, im privaten und im hoheitlichen Bereich unterschiedlich ausgestaltet ist.
Die Überwachungspflicht konzentriert sich auf die Einhaltung dessen, was Gegenstand der Tätigkeit des Dienstherrn ist, nämlich den gesetzmäßigen Vollzug der Straßenreinigung, der auch eine gesetzmäßige Abrechnung der angefallenen Kosten einschließt. Der konkrete Dienstposten des Angeklagten umfasste die Aufgabe, die Straßenanlieger vor betrügerisch überhöhten Gebühren zu schützen, und begründete so auch eine entsprechende Garantenpflicht. Der Zuschnitt der vom Angeklagten zu übernehmenden Aufgabe ist dabei – was das Landgericht zutreffend ausgeführt hat – vor dem Hintergrund seiner bisherigen Funktionen für die BSR zu sehen. Dort galt er ins-besondere als Tarifrechtsexperte und als das „juristische Gewissen“ der BSR (UA S. 7, 10, 46). Die zusätzliche Übertragung der Leitung der Innenrevision (UA S. 5, 22) war ersichtlich mit dieser Fähigkeit verbunden. Der dem Vorstandsvorsitzenden unmittelbar unterstellte Angeklagte sollte gerade als Leiter der Innenrevision verpflichtet sein, von ihm erkannte Rechtsverstöße bei der Tarifkalkulation zu beanstanden (UA S. 12), wobei die Beachtung der gesetzlichen Regelungen auch dem Schutz der Entgeltschuldner dienen sollte (UA S. 56). Auf dieser letztlich so ausreichenden Tatsachengrundlage durfte das Landgericht den Schluss ziehen, dass es zum wesentlichen Inhalt des Pflichtenkreises des Angeklagten gehören sollte (vgl. Fischer, StGB 56. Aufl. § 13 Rdn. 17), die Erhebung betrügerischer Reinigungsentgelte zu verhindern.
(3) Der Angeklagte war deshalb im Sinne des § 13 Abs. 1 StGB verpflichtet, von ihm erkannte Fehler der Tarifberechnung zu beanstanden. Dies gilt unabhängig davon, ob sich diese zu Lasten seines Dienstherrn oder zu Lasten Dritter ausgewirkt haben. Sein pflichtwidriges Unterlassen führt dazu, dass ihm der Erfolg, den er hätte verhindern sollen, strafrechtlich zugerechnet wird (vgl. BGH NJW 1987, 199). Insofern liegt – wie das Landgericht rechtsfehlerfrei ausgeführt hat – Beihilfe gemäß § 27 Abs.1 StGB vor, weil
- 15 -
der Angeklagte lediglich mit Gehilfenvorsatz gehandelt und sich dem Haupttäter G. ersichtlich untergeordnet hat. Da der Angeklagte die betrügerische Handlung des Vorstands G. ohne weiteres durch die Unterrichtung des Vorstandsvorsitzenden oder des Aufsichtsratsvorsitzenden hätte unterbinden können und ihm dies auch zumutbar war, hat sich der Angeklagte einer Beihilfe zum Betrug durch Unterlassen strafbar gemacht. Da er alle Umstände kannte, ist hier auch die subjektive Tatseite zweifelsfrei gegeben (vgl. BGHSt 19, 295, 299). Dies hat das Landgericht in den Urteilsgründen zutreffend dargelegt.
c) Entgegen der Auffassung des Generalbundesanwalts kommt bei dem Angeklagten keine Untreue gemäß § 266 StGB zu Lasten der BSR in Betracht. Zwar trifft den Angeklagten eine Vermögensbetreuungspflicht gegenüber seinem Dienstherrn. Es fehlt jedoch an einem Nachteil im Sinne des § 266 StGB. Der BSR ist durch die betrügerische Tarifbildung ein Vorteil entstanden, weil so höhere Reinigungsentgelte vereinnahmt wurden, als ihr nach der gesetzlichen Regelung zustanden.
Der Generalbundesanwalt erwägt die Möglichkeit eines solchen Nachteils in den Ersatzansprüchen und Prozesskosten nach Aufdeckung des Betrugs. Ein solcher Schaden ist aber nicht unmittelbar (BGHSt 51, 29, 33; BGH NStZ 1986, 455, 456; Fischer aaO § 266 Rdn. 55). Er setzt nämlich mit der Aufdeckung der Tat einen Zwischenschritt voraus. Der für die Nachteilsfeststellung notwendige Gesamtvermögensvergleich hat aber auf der Grundlage des vom Täter verwirklichten Tatplans zu erfolgen.
d) Die Strafzumessung hält gleichfalls im Ergebnis revisionsrechtlicher Überprüfung stand. Die Bedenken gegen die vom Landgericht vorgenommene Schadensbewertung, die im Verfahren gegen den Angeklagten G. zu einer Aufhebung des Strafausspruchs in dem Senatsbeschluss vom 9. Juni 2009 geführt haben, bestehen hinsichtlich des Angeklagten W.
- 16 -
nicht. Ausweislich der Urteilsgründe hat das Landgericht bei diesem Angeklagten der Schadenshöhe ein geringeres Gewicht beigemessen.
Entgegen der Auffassung der Verteidigung hat das Landgericht sich mit der Motivlage des Angeklagten auseinandergesetzt. Es hat nämlich festgestellt, dass er sich aus falsch verstandener Loyalität dem Vorstand G. untergeordnet hat.
Ebenso wenig ist die für die rechtsstaatswidrige Verfahrensverzögerung angesetzte Kompensation von 20 Tagessätzen zu beanstanden. Bei der vom Landgericht rechtsfehlerfrei festgestellten Verfahrensverzögerung von zehn Monaten war dieser Abschlag ausreichend, jedenfalls nicht rechtsfehlerhaft.
Das Landgericht war aus Rechtsgründen auch nicht gehalten, dem Angeklagten eine Strafrahmenverschiebung nach § 13 Abs. 2 StGB i.V.m. § 49 Abs. 1 StGB zu gewähren. Die hierfür gegebene Begründung, dass er über Monate hinweg Gelegenheit gehabt hätte, den Kalkulationsfehler aufzudecken, ist tragfähig. Dies gilt insbesondere vor dem Hintergrund, dass der Angeklagte in der Aufsichtsratssitzung anwesend war und das Protokoll führte, in der die unzutreffend berechneten Tarife vorgestellt wurden.
Die von der Revision vermisste Auseinandersetzung mit einer zusätzlichen fakultativen Strafrahmenverschiebung nach § 17 Satz 2 StGB i.V.m. § 49 Abs. 1 StGB war im vorliegenden Fall schon deshalb nicht erforderlich, weil sich der Angeklagte in keinem Verbotsirrtum befand. Es kommt nicht darauf an, dass der Angeklagte um die Strafbarkeit seines Verhaltens als Betrug wusste. Ein Verbotsirrtum ist bereits dann ausgeschlossen, wenn der Angeklagte die Rechtswidrigkeit seines Handelns (hier: seines Unterlassens) kennt (BGHSt 42, 123, 130; 52, 182, 190 f.; 52, 307, 313; BGHR StGB § 11 Amtsträger 14). Dem Angeklagten war nach den Urteilsgründen nämlich klar, dass die Berechnung der Tarife unter Verstoß gegen das Berliner Straßen-
- 17 -
reinigungsgesetz erfolgte und er schon aufgrund seines Dienstverhältnisses verpflichtet war, seinen unmittelbaren Dienstvorgesetzten, den Vorstandsvorsitzenden, zu unterrichten.
Der vom Landgericht festgesetzte Tagessatz in Höhe von 75 Euro ist rechtsfehlerfrei bestimmt (vgl. dazu eingehend Häger in LK, 12. Aufl. § 40 Rdn. 54 ff.; ferner BGH wistra 2008, 19).
Basdorf
Raum
Brause
Schneider
Dölp
Weitere Auskünfte erteilen Ihnen gern:
 |
Dr. Martin Hensche Rechtsanwalt Fachanwalt für Arbeitsrecht Kontakt: 030 / 26 39 620 hensche@hensche.de |
 |
Christoph Hildebrandt Rechtsanwalt Fachanwalt für Arbeitsrecht Kontakt: 030 / 26 39 620 hildebrandt@hensche.de |
 |
Nina Wesemann Rechtsanwältin Fachanwältin für Arbeitsrecht Kontakt: 040 / 69 20 68 04 wesemann@hensche.de |