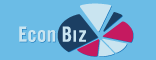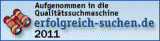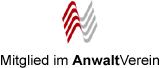- -> zur Mobil-Ansicht
- Arbeitsrecht aktuell
- Tipps und Tricks
- Handbuch Arbeitsrecht
- Gesetze zum Arbeitsrecht
- Urteile zum Arbeitsrecht
- Urteile 2023
- Urteile 2021
- Urteile 2020
- Urteile 2019
- Urteile 2018
- Urteile 2017
- Urteile 2016
- Urteile 2015
- Urteile 2014
- Urteile 2013
- Urteile 2012
- Urteile 2011
- Urteile 2010
- Urteile 2009
- Urteile 2008
- Urteile 2007
- Urteile 2006
- Urteile 2005
- Urteile 2004
- Urteile 2003
- Urteile 2002
- Urteile 2001
- Urteile 2000
- Urteile 1999
- Urteile 1998
- Urteile 1997
- Urteile 1996
- Urteile 1995
- Urteile 1994
- Urteile 1993
- Urteile 1992
- Urteile 1991
- Urteile bis 1990
- Arbeitsrecht Muster
- Videos
- Impressum-Generator
- Webinare zum Arbeitsrecht
-
Kanzlei Berlin
 030 - 26 39 62 0
030 - 26 39 62 0
 berlin@hensche.de
berlin@hensche.de
AnfahrtDetails -
Kanzlei Frankfurt
 069 - 71 03 30 04
069 - 71 03 30 04
 frankfurt@hensche.de
frankfurt@hensche.de
AnfahrtDetails -
Kanzlei Hamburg
 040 - 69 20 68 04
040 - 69 20 68 04
 hamburg@hensche.de
hamburg@hensche.de
AnfahrtDetails -
Kanzlei Hannover
 0511 - 89 97 701
0511 - 89 97 701
 hannover@hensche.de
hannover@hensche.de
AnfahrtDetails -
Kanzlei Köln
 0221 - 70 90 718
0221 - 70 90 718
 koeln@hensche.de
koeln@hensche.de
AnfahrtDetails -
Kanzlei München
 089 - 21 56 88 63
089 - 21 56 88 63
 muenchen@hensche.de
muenchen@hensche.de
AnfahrtDetails -
Kanzlei Nürnberg
 0911 - 95 33 207
0911 - 95 33 207
 nuernberg@hensche.de
nuernberg@hensche.de
AnfahrtDetails -
Kanzlei Stuttgart
 0711 - 47 09 710
0711 - 47 09 710
 stuttgart@hensche.de
stuttgart@hensche.de
AnfahrtDetails
LAG München, Urteil vom 14.08.2007, 4 Sa 189/07
| Schlagworte: | Karenzentschädigung, Arbeitslosengeld | |
| Gericht: | Landesarbeitsgericht München | |
| Aktenzeichen: | 4 Sa 189/07 | |
| Typ: | Urteil | |
| Entscheidungsdatum: | 14.08.2007 | |
| Leitsätze: | Der Arbeitgeber kann auf die während der Zeit eines nachvertraglichen Wettbewerbsverbots zu zahlende Karenzentschädigung ein vom Arbeitnehmer während dieses Zeitraum bezogenes Arbeitslosengeld (in den Grenzen der § 74c Abs. 1 HGB) nur in Höhe des "Netto-"Auszahlungsbetrages, nicht in Höhe eines fiktiv hochgerechneten "Brutto-"Betrages des Arbeitslosengeldes anrechnen (so auch die ständige Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts). | |
| Vorinstanzen: | Arbeitsgericht München | |
4 Sa189/07
33 a Ca 13058/06
(München)
Verkündet am:
14. August 2007
Hömberg, ROS als
Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle
LANDESARBEITSGERICHT MÜNCHEN
IM NAMEN DES VOLKES
URTEIL
In dem Rechtsstreit
R.
- Kläger und Berufungsbeklagter -
Prozessbevollmächtigte: Rechtsanwälte Sch.
gegen
Fa. W. GmbH,
- Beklagte und Berufungsklägerin -
Prozessbevollmächtigte: Rechtsanwälte P.
hat die Vierte Kammer des Landesarbeitsgerichts München auf Grund der mündlichen Verhandlung vom 2. August 2007 durch den Vorsitzenden Richter am Landesarbeitsgericht Burger sowie die ehrenamtlichen Richter Baumann und Tögel für Recht erkannt:
- 2 -
I. Die Berufung der Beklagten gegen das Endurteil des Arbeitsgerichts München vom 20. Dezember 2006 - 33a Ca 13058/06 - wird auf Kosten der Beklagten zurückgewiesen.
II. Die Revision wird zugelassen.
Tatbestand:
Die Parteien streiten über die Berechnung des Karenzentschädigungsanspruches des Klägers aufgrund eines nachvertraglichen Wettbewerbsverbots mit der Beklagten als seiner früheren Arbeitgeberin.
Der, ausweislich der Angaben in den vorgelegten Gehaltsabrechnungen, am 00.00.1947 geborene Kläger war bei der Beklagten im Zeitraum vom 01.01.1995 bis 30.11.2005 als Techniker in der Forschung und Entwicklung mit einer Vergütung von zuletzt 4.380,-- € brutto/Monat zzgl. vermögenswirksamer Leistungen von 15,-- €/Monat, bei Zahlung von 13 Gehältern/Jahr, beschäftigt. Vor Beginn des Arbeitsverhältnisses hatten die Parteien unter dem 26.09./04.10.1994 im Rahmen einer „Vertraulichkeitsvereinbarung und Wettbewerbsverbot ...“ (Anl. K2, Bl. 5 bis 7 d. A.) ein nachvertragliches Wettbewerbsverbot des Klägers für die Dauer von zwei Jahren vereinbart, das hinsichtlich der Höhe des Anspruchs des Klägers auf Karenzentschädigung bestimmt:
3. G. verpflichtet sich, dem A. für die Dauer dieses Wettbewerbsverbots eine Entschädigung von 70 % seiner letzten Bezüge von G. zu bezahlen, zahlbar in 24 Raten jeweils am Monatsende.
Von dieser Entschädigung ist das weitere Einkommen des A. bzw. das was der A. zu erwerben unterlässt insoweit abzuziehen, als dieses sonstige Einkommen und die Entschädigungszahlung gemeinsam das
- 3 -
letzte Gehalt um mehr als 1/10 übersteigen oder um mehr als 1/4, wenn das Wettbewerbsverbot einen Umzug des As zur Folge hat.
...“
Der Kläger befindet sich seit seinem Ausscheiden, somit seit 01.12.2005, im nachvertraglichen Wettbewerbsverbot und erhält von der Beklagten die vertraglich vereinbarte Karenzentschädigung in Höhe von 70 % seines durch zwölf (Monate) geteilten letzten Jahresgehalts. Ebenfalls seit 01.12.2005 erhält der Kläger Arbeitslosengeld in Höhe von, bis zuletzt unverändert, 1.467,30 €/Monat. Seit 01.01.2006 rechnet die Beklagte das vom Kläger bezogene Arbeitslosengeld auf einen monatlichen Brutto-Leistungsbezug von 2.445,60 € hoch (Berechnung im vorgerichtlichen Schreiben der Beklagten an die anwaltschaftlichen Vertreter des Klägers in Anl. K5, Bl. 10 d. A.), was zur Folge hat, dass dieser Betrag zusammengerechnet mit dem Karenzentschädigungsanspruch des Klägers in Höhe von 70 % seiner letzten Bezüge (= 3.332,-- € brutto/Monat) den um 10 % erhöhten Betrag seines letzten Einkommens im Umfang von 541,60 €/Monat übersteigt - welchen Betrag die Beklagte von der Karenzentschädigung für das Jahr 2006 in Abzug gebracht hat und den der Kläger für das Kalenderjahr 2006 mit der vorliegenden Leistungsklage geltend macht.
Das Arbeitsgericht München hat mit Endurteil vom 20.12.2006, das den Prozessbevollmächtigten der Beklagten am 07.02.2007 zugestellt wurde - auf das wegen des streitigen Vorbringens sowie der Anträge der Parteien im Ersten Rechtszug Bezug genommen wird -, der Klage in vollem Umfang mit der Begründung stattgegeben, dass der nach der wirksamen vertraglichen Regelung hierzu dem Grunde nach entstandene Karenzentschädigungsanspruch dem Kläger auch in ungekürzter vertraglicher Höhe zustehe, da zwar, entgegen der Ansicht des Klägers, eine Anrechnung des Arbeitslosengeldes auf die Karenzentschädigung nicht von vornherein und grundsätzlich ausscheide - nach der Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts sei die Anrechnungsvorschrift des § 74c Abs. 1 Satz 1 HGB hier entsprechend anzuwenden -, jedoch ebenfalls nach der Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts im Rahmen der Regelungen des § 74c Abs. 1 HGB auf die Karenzentschädi-gung nur das Netto-Arbeitslosengeld, nicht ein fiktiv hochgerechnetes Brutto-
- 4 -
Arbeitslosengeld, angerechnet werden könne. Anderes sei, entgegen der Ansicht der Beklagten, nicht zur Vermeidung von Wertungswidersprüchen erforderlich, wobei auch zu berücksichtigen sei, dass ein Arbeitnehmer, der sich einem nachvertraglichen Wettbewerbsverbot unterwerfe und sich im Zustand der Arbeitslosigkeit befinde, auch vor dem Hintergrund der aktuellen Arbeitsmarktsituation in einer schwierigeren und schutzwürdigeren Position sei als ein vergleichbarer Arbeitnehmer, der während der Karenzzeit einer ihm nicht verbotenen Arbeit nachgehe und somit bereits über ein geregeltes Einkommen verfüge - was eine unterschiedliche soziale Lage und Schutzbedürftigkeit beider Personenkreise zeige.
Hiergegen richtet sich die Berufung der Beklagten mit Schriftsatz vom 26.02.2007, am 27.02.2007 beim Landesarbeitsgericht München eingegangen, zu deren Begründung sie fristgerecht vorgetragen hat, dass die Argumentation des Arbeitsgerichts nicht überzeugen könne, wenn es sich lediglich auf eine apodiktische Auffassung des Bundesarbeitsgerichts beziehe, die zur streitigen Frage keine Begründung enthalte - was die Instanzgerichte nicht von einer eigenständigen Prüfung und Entscheidung entbinde, ob die Argumentation des Bundesarbeitsgerichts zutreffend sei. In früheren Entscheidungen habe das Bundesarbeitsgerichts die Besserstellung eines Arbeitslosen gegenüber einem Beschäftigten und die damit einhergehende Ungleichbehandlung mit der gesetzlichen Pflicht in § 128a Satz 3 AFG - welche Norm zwischenzeitlich nicht mehr existiere - gerechtfertigt. Auch die Rechtfertigung der Ungleichbehandlung durch eine besondere Schutzwürdigkeit eines Arbeitslosen seitens des Arbeitsgerichts könne nicht überzeugen, da Arbeitslosengeld grundsätzlich steuerfrei sei und die Agentur für Arbeit die alleinige Beitragspflicht zur Sozialversicherung trage, was sich von der tatsächlichen Belastung eines normalen wesentlich Erwerbstätigen unterscheide. Aus der Perspektive der sozialen Absicherung solle damit der Arbeitslose nicht schlechter als ein Erwerbstätiger gestellt werden. Eine grundsätzlich schwierigere und schutzwürdigere Stellung des Arbeitslosen, der sich im nachvertraglichen Wettbewerbsverbot befinde, könne gleichwohl nicht bei einzelnen Fragen der Gleichstellung des Arbeitslosen und des Beschäftigten eine Ungleichbehandlung rechtfertigen. Es sei nicht Aufgabe der Anrechnungsvorschriften, eine allgemein schwierigere Stellung eines Arbeitslosen gegenüber
- 5 -
einem Beschäftigten zu kompensieren. Damit sei die Anrechnung des Arbeitslosengeldes auf die Karenzentschädigung des Klägers auf der Basis des Bruttobetrags des Arbeitslosengeldes vorzunehmen, sodass die die 110 %-Grenze des § 74c Abs. 1 HGB in Höhe des streitgegenständlichen Betrages von 541,60 €/Monat überschritten sei, in welchem Umfang somit die Beklagte zur Kürzung des Karenzentschädi-gungsanspruches des Klägers berechtigt sei.
Die Beklagte beantragt:
Das Urteil des Arbeitsgerichts München vom 20.12.2006, Aktenzeichen 33a Ca 13058/06, wird aufgehoben und die Klage abgewiesen.
Der Kläger trägt zur Begründung seines Antrages auf Zurückweisung der Berufung vor, dass Arbeitslosengeld von vornherein nicht, auch nicht im Nettobetrag, auf den Karenzentschädigungsanspruch angerechnet werden könne, da nach § 74c HGB derjenige, der sich im nachvertraglichen Wettbewerbsverbot befinde, sich auf den Anspruch auf Karenzentschädigung nur solche Beträge anrechnen lassen müsse, die er durch anderweitige Verwertung seiner Arbeitskraft erwerbe, was beim Arbeitslosengeld nicht der Fall sei. Dies gelte insbesondere, wenn wie im vorliegenden Fall aufgrund der 58er-Regelung der Arbeitslose der Arbeitsvermittlung nicht mehr zur Verfügung stehen müsse. Gemäß ständiger Rechtsprechung zu § 74c HGB seien allenfalls die bezahlte Vergütung anrechenbar, nicht fiktiv hochgerechnete Beträge.
Wegen des Sachvortrags der Parteien im Zweiten Rechtszug im Übrigen wird auf die Schriftsätze vom 10.04.2007 (Bl. 81 f d. A.) und vom 16.04.2007 (Bl. 90 f d. A.) sowie auf die Sitzungsniederschrift vom 02.08.2007 (Bl. 96/97 d. A.) Bezug genommen.
- 6 -
Entscheidungsgründe:
Die zulässige Berufung hat in der Sache keinen Erfolg.
I.
Die gemäß § 64 Abs. 2 ArbGG statthafte Berufung der Beklagten ist form- und fristgerecht eingelegt und begründet worden und daher zulässig (§§ 66 Abs. 1 Satz 1, 64 Abs. 6 Satz 1 ArbGG, 519, 520 ZPO).
II.
Die Berufung der Beklagten ist unbegründet. Das Arbeitsgericht hat im Ergebnis und in der Begründung - worauf zunächst Bezug genommen wird (§ 69 Abs. 2 ArbGG) - zutreffend entschieden, dass die Beklagte auf den dem Grunde und der Höhe nach unstreitigen Anspruch des Klägers auf Zahlung von Karenzentschädi-gung für den hier streitgegenständlichen Zeitraum (01.01.2006 bis 31.12.2006) - wenn überhaupt (dazu 1.) - das von ihm in diesem Zeitraum bezogene Arbeitslosengeld lediglich in Höhe dessen („Netto-“)Auszahlungsbetrages, nicht in Höhe eines hochgerechneten, fiktiven, „Brutto“-Betrages anrechnen kann (dazu 2.b bb).
1. Da die Anrechnung des vom arbeitslosen Kläger parallel zur Karenzentschädigung bezogenen Arbeitslosengeldes nur mit dessen „Netto-“Auszahlungsbetrag (unstreitig und unverändert: 1.467,30 € - dazu 2. -) hier unstreitig und unzweifelhaft dazu führt, dass damit die 110 %-Grenze des § 74c Abs. 1 Satz 1 HGB nicht überschritten würde (siehe die Einlassung bzw. das entsprechende Zugeständnis der Beklagten bereits in der mündlichen Verhandlung im erstinstanzlichen Verfahren, Protokoll vom 19.12.2006, S. 3, Bl. 31 f/33 d. A., sowie auch die dem offensichtlich zugrunde liegende Berechnung der Beklagten im vorgerichtlichen Schreiben an die
- 7 -
anwaltschaftlichen Vertreter des Klägers vom 13.06.2006, Anl. K5, Bl. 10 d. A.), hätte der Kläger auch in diesem Fall Anspruch auf die ungeminderte Karenzentschädi-gung - sodass im Ergebnis auch offen bleiben könnte, ob eine Anrechnung von Arbeitslosengeld als Sozialversicherungsleistung gemäß oder entsprechend § 74c Abs. 1 HGB überhaupt erfolgen kann, wie dies der Kläger grundsätzlich in Abrede stellen will.
2. Jedenfalls aber kann eine Anrechnung von Arbeitslosengeld im Sinne der §§ 117 f SGB III, das der sich gemäß einem nachvertraglichen Wettbewerbsverbot des Wettbewerbs enthaltende und arbeitslose (ehemalige) Arbeitnehmer parallel zum damit grundsätzlich gegebenen Anspruch auf Zahlung von Karenzentschädi-gung erhält, auf diesen Anspruch nur mit dessen („Netto-“)Auszahlungsbetrag erfolgen.
a) Die nachvertragliche Wettbewerbsvereinbarung der Parteien vom 26.09./04.10.1994 entspricht den gesetzlichen Anforderungen der §§ 74 Abs. 1 und Abs. 2, 74a HGB - Einwände gegen deren Wirksamkeit werden auch von der Beklagten nicht erhoben.
b) Wenn das Arbeitslosengeld auf die Karenzentschädigung des Klägers - entgegen seiner Ansicht - überhaupt anzurechnen ist (dazu aa), kann die Anrechnung nur mit dem („Netto-“)Auszahlungsbetrag des Arbeitslosengeldes erfolgen (dazu bb):
aa) Da aus nachfolgenden Gründen (bb) eigentlich entscheidungsunerheblich (siehe 1.), wird im Anschluss an die grundsätzlichen Ausführungen des Bundesarbeitsgerichts insbesondere im Urteil vom 25.06.1985 (AP Nr. 11 zu § 74c HGB) - auf die sich auch das Arbeitsgericht bezogen hat - lediglich der Vollständigkeit halber in der gebotenen Kürze darauf hingewiesen, dass Arbeitslosengeld als sozialrechtliche Lohnersatzleistung, die nicht Gegenleistung für tatsächlich erbrachte Arbeit ist, zwar - obwohl nicht durch anderweitige Verwertung der Arbeitskraft des Arbeitnehmers erzielt (so der Wortlaut des § 74c Abs. 1 Satz 1 Alternative 1 HGB, der
- 8 -
allerdings durch Gesetz vom 10.06.1914 eingeführt wurde, während eine dem heutigen Arbeitslosengeld ähnliche Leistung erstmals im November 1918 geschaffen und eine gesetzliche Arbeitslosenversicherung erst 1927 eingeführt wurden: BAG, aaO) - entsprechend § 74c Abs. 1 HGB gleichwohl grundsätzlich auf den Karenz-entschädigungsanspruch anrechenbar sein muss, um eine wertungswidersprüchliche Besserstellung des arbeitslosen, Arbeitslosengeld beziehenden und sich gleich¬zeitig des Wettbewerbs enthaltenden (ehemaligen) Arbeitnehmers gegenüber demjenigen vergleichbaren Arbeitnehmer, der während der Karenzzeit einer erlaubten anderweitigen Erwerbstätigkeit nachgeht zu vermeiden (siehe auch die Anrechnungsgrenzen des § 74c Abs. 1 Satz 1 und Satz 2 HGB).
bb) Jedoch kann das Arbeitslosengeld entsprechend der ständigen Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts, der sich das Berufungsgericht anschließt, nur mit dem tatsächlichen Auszahlungsbetrag - dessen von der Beklagten sogenannten „Nettobetrag“ - angerechnet werden, nicht mit einem hochgerechneten „Bruttobetrag“ (so BAG, zuletzt U. v. 23.11.2004, 9 AZR 595/03, AP Nr. 75 zu § 74 HGB, unter Rz. 40; U. v. 27.11.1991, 4 AZR 211/91, AP Nr. 22 zu § 4 TVG - III. 2. b (juris Rz. 67) der Gründe -; aA LAG Köln, U. v. 20.02.1991, LAGE Nr. 1 zu § 5 TVG; siehe auch Etzel in Ensthaler (Hg.), HGB, 7. Aufl. 2007, §§ 74 - 75 d Rz. 95; vgl. von Hoyningen-Huene, HGB, Bd. 1, 2. Aufl. 2005, § 74c Rz. 11).
Dies ergibt sich bereits und maßgeblich daraus, dass eine erforderliche Rechtsgrundlage für eine Anrechnung nicht lediglich des tatsächlich gezahlten, sondern eines fiktiv hochgerechneten „Brutto-Arbeitslosengeldes“ - so die Diktion der Beklagten u. a. im erstinstanzlichen Klageerwiderungsschriftsatz vom 30.11.2006, wobei sie nicht näher erläutert, wie sich ihre Hochrechnung des unstreitig an den Kläger bezahlten Arbeitslosengeldes in Höhe 1.467,30 € („netto“)/Monat auf 2.445,60 € „brutto“/Monat erklären soll - fehlt:
Der Arbeitslose und Arbeitslosengeldberechtigte (§§ 117 f SGB III) erhält Arbeitslosengeld als sozialrechtliche - öffentlichrechtliche - Lohnersatzleistung (steuerfrei, § 3 Nr. 2 EStG) gemäß dem allgemeinen Leistungssatz oder dem, bei Unterhaltspflichten, erhöhten Leistungssatz, dem ein Leistungsentgelt als Prozentsatz
- 9 -
des pauschalierten Nettoentgelts aus seiner vorherigen Erwerbstätigkeit im Bezugszeitraum zugrunde liegt (§ 129 Ziffern 1. und 2. SGB III). Berechnungsgrundlage für die Höhe des Anspruchs auf das Arbeitslosengeld ist das auf einen Tag entfallende Bruttoentgelt als Bemessungsentgelt (§§ 131, 132 SGB III), das um eine Sozialversicherungspauschale und - wiederum pauschalierte - Lohnsteuer/Solidaritäts-zuschlag vermindert wird und damit das maßgebliche Leistungsentgelt darstellt (§ 133 SGB III), aus dem der Anspruch auf Arbeitslosengeld prozentual (60/67 %) ermittelt wird.
Dies bedeutet: Es gibt kein „Netto“-Arbeitslosengeld und kein „Brutto“-Arbeitslosengeld, sondern nur ein Arbeitslosengeld als solches, dessen sozialrechtlicher Berechnung aufgrund seiner Funktion als Lohnersatzleistung lediglich ein pauschaliert errechnetes Nettoarbeitsentgelt zugrunde liegt, das aber dann als Lohnersatz-Sozialleistung für den anspruchsberechtigten Arbeitslosen belastungsfrei - steuer- und sozialversicherungsfrei - ausgezahlt wird.
Die von der Beklagten gebrauchte Begrifflichkeit des „Netto-“ und des „Brutto“-Arbeitslosengeldes ist insoweit verfehlt, als dies eine Parallelität zur Behandlung und Abrechnung des zivilrechtlichen, arbeitsvertraglichen, Anspruches auf Arbeitsentgelt suggeriert. Hier werden in der herkömmlichen Diktion der vertraglich geschuldete Vergütungsanspruch als „Brutto-Entgelt“ und der - nach Abzug von öf-fentlichrechtlichen Steuer- und Sozialversicherungslasten/Arbeitnehmerbeiträgen zur den gesetzlichen Pflichtversicherungen - konkret zur Auszahlung kommende Betrag als „Netto-Entgelt“ bezeichnet. Eine solche Situation der Behandlung als „Netto-“Betrag und als „Brutto-“Betrag“ gibt es beim Arbeitslosengeld jedoch nicht. Dieses wird „Brutto=Netto“, als Prozentsatz des pauschalierten Leistungsentgelts, errechnet und genauso ausgezahlt. Ohne Einfluss hierauf und insoweit ohne Bedeutung ist – weil nicht die Auszahlungshöhe des dem Arbeitslosen zustehenden Arbeitslosengeldes als Abzugsbetrag/Arbeitnehmeranteils betreffend - , dass der Arbeitslose während des Bezuges von Arbeitslosengeld in der gesetzlichen Kranken-und Pflegeversicherung weiter pflichtversichert ist (§§ 5 Abs. 1 Nr. 2 SGB V, 20 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 SGB XI) und die Arbeitsverwaltung die Beträge hierzu nach gesonderten Vorschriften trägt (§§ 251 Abs. 4a SGB V, 59 Abs. 1 SGB XI), sowie die Zei-
- 10 -
ten der Arbeitslosigkeit in der gesetzlichen Rentenversicherung berücksichtigt werden (§§ 3 Satz 1 Nr. 3 SGB VI) und wiederum die Bundesagentur für Arbeit wäh¬rend des Leistungsbezuges Beiträge hierzu aus 80 % des Leistungsentgelts abführt (§§ 170 Abs. 1 Nr. 2b, 166 Abs. 1 Nr. 2 SGB VI). Dies führt zwar im Ergebnis zu einer derjenigen des aktiven Erwerbstätigen (nicht un-)vergleichbaren sozialen Absicherung, aber nicht dazu, dass die öffentlichrechtliche Leistungszahlung als Lohnersatzleistung und deren Errechnung, nebst sozialrechtlicher Flankierung nach gesonderten Bestimmungen, etwa als gleich oder analog oder entsprechend der Behandlung des zivilrechtlich, arbeitsvertraglich, geschuldeten Arbeitsentgelts mit Abzug von Quellensteuer und Sozialversicherungsbeiträgen als „Brutto-“ und „Netto-“ Vergütung betrachtet werden müsste (Einkommenssteuer wird, wie ausgeführt, allerdings nicht bezahlt).
Es gibt eben nur ein Arbeitslosengeld, nicht ein solches als „Netto-“ und als „Brutto-“Arbeitslosengeld.
Es fehlt damit an einer Rechtsgrundlage, das Arbeitslosengeld als „Netto“-Betrag anzusehen und diesen auf einen (fiktiven) „Brutto“-Betrag hochzurechnen.
Es ist auch nicht nach Sinn und Zweck oder zur Vermeidung von Wertungswidersprüchen geboten, das Arbeitslosengeld vor einer Anrechnung auf die Karenz-entschädigung auf einen fiktiven „Brutto“-Betrag hochzurechnen. Es ist nicht zu erkennen, weshalb dies aus der Tatsache folgen sollte, dass die Bundesagentur für Arbeit nach gesonderten Vorschriften – nicht als Belastung des Arbeitslosengeldes – die Beiträge zur während des Leistungsbezuges fortbestehenden Pflichtversicherung des Leistungsempfängers in der gesetzlichen Sozialversicherung tragen muss. Für die Bundesagentur für Arbeit mag es einen rechnerischen „Gesamthaushalt“ ihrer wirtschaftlichen Gesamtbelastung durch einen Arbeitslosengeldempfänger geben – in Höhe seines Leistungsbezuges und der für ihn an die Träger der Kranken-, Pflege- und Rentenversicherung daneben abzuführenden Beiträge - . Dies stellt aber kein etwa mittelbares „Brutto“-Arbeitslosengeld dar.
- 11 -
Weiter und im Hinblick auf die von der Beklagten maßgeblich in Bezug genommene gesetzliche Entwicklung der Regelung des vormaligen § 128a AFG ist darauf hinzuweisen, dass allerdings § 148 SGB III vorsah, dass dann, wenn der Arbeitslosengeldbezieher durch ein nachvertragliches Wettbewerbsverbot mit seinem bisherigen Arbeitgeber in seinen beruflichen Entwicklungsmöglichkeiten und Vermittlungsoptionen beschränkt war, dieser der Bundesanstalt/-agentur vierteljährlich 30 % des gezahlten Arbeitslosengeldes und auch des entsprechenden Anteils der von der Arbeitsverwaltung gezahlten Beiträge zur Kranken-, Pflege- und Rentenversicherung zu erstatten hatte und in dieser (relativ geringen: 30 %) Höhe der Erstattungspflicht der Arbeitnehmer sich diese vom Arbeitgeber erstatteten Beträge auf seinen Karenzentschädigungsanspruch anrechnen lassen musste (§ 148 Abs. 1 Satz 2 SGB III aF). Diese Anrechnungsregelung - die zum 01.01.2004 durch das Dritte Gesetz für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt (Hartz III) vom 23.12.2003, BGBl. I, S. 2848, aufgehoben wurde (weil dem mit der Prüfung der rechtlichen Wirksamkeit der Wettbewerbsabrede verbundenen Verwaltungsaufwand nur eine geringe Zahl von tatsächlichen Erstattungsfällen gegenüber gestanden habe: so von Hoyningen-Huene, aaO) - war jedoch gesondert und spezifisch gesetzlich normiert
- als Anrechnungsanspruch des Arbeitgebers gegenüber dem Karenzentschädigungsanspruch in Höhe - und damit komplementär zu - seiner Erstattungspflicht gegenüber der Bundesagentur,
- wobei die Höhe eben nur 30 % des erstatteten („Brutto-“)Arbeitslosengeldes,
incl. hierauf gezahlter Sozialversicherungsbeiträge, in diesem Prozentsatz betraf (dass das BAG die Aufhebung dieser gesetzlichen Regelung des § 148 SGB III zum 01.01.2004 in seiner Entscheidung vom 23.11.2004 (aaO) übersehen haben sollte, wie die Beklagte im Berufungsbegründungsschriftsatz ausführen lässt, befremdet: genau hierauf ist unter Rz. 40 dieses Urteils abgehoben ...!).
Schließlich hat das Arbeitsgericht im angefochtenen Urteils vom 20.12.2006 weiter nicht unnachvollziehbar auf die grundsätzlich - unabhängig von der Situation des Klägers im vorliegenden Verfahren – bestehende besondere Situation des arbeitslosen Arbeitnehmers während der Karenzzeit eines nachvertraglichen Wettbe-
- 12 -
werbsverbotes gegenüber demjenigen hingewiesen, der in diesem Zeitraum einer wettbewerbsneutralen Tätigkeit nachgeht - was ebenfalls eine Anrechnung des Arbeitslosengeldes „nur“ mit dem Auszahlbetrag - einen anderen gibt es eben nicht - rechtfertigen könnte.
Nach allem wäre, entsprechend auch der ständigen Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts hierzu, das Arbeitslosengeld auf die Karenzentschädigung - wenn überhaupt (s. o.) - nicht mit einem fiktiv hochgerechneten „Brutto“-Betrag, sondern mit dem („Netto“-)Zahlbetrag anzurechnen, weshalb die Berufung der Beklagten zurückzuweisen ist.
III.
Die Beklagte hat damit die Kosten ihrer erfolglosen Berufung zu tragen (§ 97 Abs. 1 ZPO).
IV.
Die Berufungskammer hat die Revision zum Bundesarbeitsgericht wegen grundsätzlicher Bedeutung der Rechtssache - im Hinblick auf die von der Beklagten dargelegte Vielzahl vergleichbarer nachvertraglicher Wettbewerbsvereinbarungen allein in ihrem Unternehmen - und wegen möglicher Divergenz zum zit. Urteil des Landesarbeitsgerichts Köln (aaO) zugelassen.
- 13 -
Rechtsmittelbelehrung:
Gegen dieses Urteil kann die Beklagte Revision einlegen.
Für den Kläger ist gegen dieses Urteil kein Rechtsmittel gegeben.
Die Revision muss innerhalb einer Frist von einem Monat eingelegt und innerhalb einer Frist von zwei Monaten begründet werden.
Beide Fristen beginnen mit der Zustellung des in vollständiger Form abgefassten Ur¬teils, spätestens aber mit Ablauf von fünf Monaten nach der Verkündung des Urteils.
Die Revision muss beim
Bundesarbeitsgericht
Hugo-Preuß-Platz 1
99084 Erfurt
Postanschrift:
Bundesarbeitsgericht
99113 Erfurt
Fax-Nummer:
(03 61) 26 36 – 20 00
- 14 -
Die Revisionsschrift und die Revisionsbegründung müssen von einem Rechtsanwalt unterzeichnet sein.
Burger
Baumann
Tögel
Hinweis der Geschäftsstelle:
Das Bundesarbeitsgericht bittet, alle Schriftsätze in siebenfacher Ausfertigung einzureichen.
Weitere Auskünfte erteilen Ihnen gern:
 |
Dr. Martin Hensche Rechtsanwalt Fachanwalt für Arbeitsrecht Kontakt: 030 / 26 39 620 hensche@hensche.de |
 |
Christoph Hildebrandt Rechtsanwalt Fachanwalt für Arbeitsrecht Kontakt: 030 / 26 39 620 hildebrandt@hensche.de |
 |
Nina Wesemann Rechtsanwältin Fachanwältin für Arbeitsrecht Kontakt: 040 / 69 20 68 04 wesemann@hensche.de |