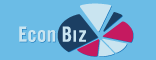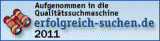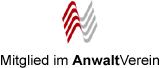- -> zur Mobil-Ansicht
- Arbeitsrecht aktuell
- Tipps und Tricks
- Handbuch Arbeitsrecht
- Gesetze zum Arbeitsrecht
- Urteile zum Arbeitsrecht
- Urteile 2023
- Urteile 2021
- Urteile 2020
- Urteile 2019
- Urteile 2018
- Urteile 2017
- Urteile 2016
- Urteile 2015
- Urteile 2014
- Urteile 2013
- Urteile 2012
- Urteile 2011
- Urteile 2010
- Urteile 2009
- Urteile 2008
- Urteile 2007
- Urteile 2006
- Urteile 2005
- Urteile 2004
- Urteile 2003
- Urteile 2002
- Urteile 2001
- Urteile 2000
- Urteile 1999
- Urteile 1998
- Urteile 1997
- Urteile 1996
- Urteile 1995
- Urteile 1994
- Urteile 1993
- Urteile 1992
- Urteile 1991
- Urteile bis 1990
- Arbeitsrecht Muster
- Videos
- Impressum-Generator
- Webinare zum Arbeitsrecht
-
Kanzlei Berlin
 030 - 26 39 62 0
030 - 26 39 62 0
 berlin@hensche.de
berlin@hensche.de
AnfahrtDetails -
Kanzlei Frankfurt
 069 - 71 03 30 04
069 - 71 03 30 04
 frankfurt@hensche.de
frankfurt@hensche.de
AnfahrtDetails -
Kanzlei Hamburg
 040 - 69 20 68 04
040 - 69 20 68 04
 hamburg@hensche.de
hamburg@hensche.de
AnfahrtDetails -
Kanzlei Hannover
 0511 - 89 97 701
0511 - 89 97 701
 hannover@hensche.de
hannover@hensche.de
AnfahrtDetails -
Kanzlei Köln
 0221 - 70 90 718
0221 - 70 90 718
 koeln@hensche.de
koeln@hensche.de
AnfahrtDetails -
Kanzlei München
 089 - 21 56 88 63
089 - 21 56 88 63
 muenchen@hensche.de
muenchen@hensche.de
AnfahrtDetails -
Kanzlei Nürnberg
 0911 - 95 33 207
0911 - 95 33 207
 nuernberg@hensche.de
nuernberg@hensche.de
AnfahrtDetails -
Kanzlei Stuttgart
 0711 - 47 09 710
0711 - 47 09 710
 stuttgart@hensche.de
stuttgart@hensche.de
AnfahrtDetails
EGMR, Urteil vom 23.09.2010, 425/03
| Schlagworte: | Kündigung, Tendenzträger, Kirchenarbeitsrecht, Menschenrechte | |
| Gericht: | Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte | |
| Aktenzeichen: | 425/03 | |
| Typ: | Urteil | |
| Entscheidungsdatum: | 23.09.2010 | |
| Leitsätze: | ||
| Vorinstanzen: | ||
23/09/10 Rechtssache O. gegen DEUTSCHLAND (Beschwerde Nr. 425/03)
RECHTSSACHE O. ./. DEUTSCHLAND
(Beschwerde Nr. 425/03)
URTEIL
STRASSBURG
23. September 2010
Dieses Urteil wird nach Maßgabe des Artikels 44 Absatz 2 der Konvention endgültig. Es wird gegebenenfalls noch redaktionell überarbeitet.
- 2 -
In der Rechtssache O. ./. Deutschland,
hat der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (Fünfte Sektion) als Kammer, die
sich zusammensetzt aus
Peer Lorenzen, Präsident,
Renate Jaeger,
Rait Maruste,
Isabelle Berro-Lefèvre,
Mirjana Lazarova Trajkovska,
Zdravka Kalaydjieva,
Ganna Yudkivska, Richter,
sowie der Kanzlerin der Sektion, Claudia Westerdiek,
nach Beratung in nicht öffentlicher Sitzung am 31. August 2010,
das folgende Urteil erlassen, das an diesem Tag angenommen worden ist:
VERFAHREN
1. Der Rechtssache liegt eine gegen die Bundesrepublik Deutschland gerichtete Individualbeschwerde (Nr. 425/03) zugrunde, die ein deutscher Staatsangehöriger, Herr O. („der Beschwerdeführer“), am 2. Januar 2003 nach Artikel 34 der Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten („die Konvention“) beim Gerichtshof eingereicht hat.
2. Der Beschwerdeführer wird von Rechtsanwältin Ulrike Muhr aus Essen vertreten. Die deutsche Regierung („die Regierung“) wird von ihrer Verfahrensbevollmächtigten, Frau Almut Wittling-Vogel, Ministerialdirigentin im Bundesministerium der Justiz, vertreten.
3. Der Beschwerdeführer behauptet, dass die Ablehnung der Arbeitsgerichte, seine fristlose Kündigung durch die Mormonenkirche aufzuheben, Artikel 8 der Konvention verletzt habe.
4. Am 18. März 2008 hat der Präsident der Fünften Sektion beschlossen, der Regierung die Beschwerde zu übermitteln. In Einklang mit Artikel 29 Absatz 3 der Konvention ist ferner beschlossen worden, dass die Kammer über die Zulässigkeit und die Begründetheit der Rechtssache zeitgleich entscheidet.
- 3 -
5. Sowohl der Beschwerdeführer als auch die Regierung haben schriftliche Stellungnahmen vorgelegt. Die Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage (die Mormonenkirche), die der Präsident ermächtigt hat, am schriftlichen Verfahren teilzunehmen (Artikel 36 Absatz 2 der Konvention und Artikel 44 Absatz 2 der Verfahrensordnung), hat ebenfalls Stellung genommen. Die Parteien haben auf diese Stellungnahmen erwidert (Artikel 44 Absatz 5 der Verfahrensordnung).
SACHVERHALT
I. DIE UMSTÄNDE DES FALLES
A. Hintergrund der Rechtssache
6. Der Beschwerdeführer wurde1959 geboren und ist in N.-A. wohnhaft.
7. Er ist in der Mormonenkirche aufgewachsen, die den Status einer öffentlich-rechtlichen Körperschaft innehat. 1980 heiratete er nach mormonischem Ritus. Nachdem er bereits verschiedene Ämter bei der Mormonenkirche bekleidet hatte, wurde er ab dem 1. Oktober 1986 als Gebietsdirektor Europa in der Abteilung Öffentlichkeitsarbeit mit einem Monatsgehalt von 10.047,85 DM (ca. 5000 EUR) beschäftigt.
8. § 10 seines Anstellungsvertrags vom 25. September 1986 enthielt folgende Klausel:
Verhalten im Betrieb und außerhalb
„Dem Arbeitnehmer sind die wesentlichen Grundsätze der Kirche bekannt. Er hat Mitteilungen und jegliches Verhalten zu unterlassen, wodurch der Ruf der Kirche geschädigt oder diese Grundsätze in Frage gestellt werden könnten. Der Arbeitnehmer verpflichtet sich insbesondere zur Einhaltung hoher moralischer Grundsätze.
Er verpflichtet sich, in den Betriebsräumen sowie unmittelbar in der Nähe des Betriebes und auch auf betrieblich veranlassten Fahrten und Veranstaltungen weder zu rauchen, noch Alkohol, Bohnenkaffee oder Rauschgift zu sich zu nehmen. Grobe Verstöße berechtigen den Arbeitgeber zur fristlosen Kündigung.
- 4 -
Für die folgenden drei Gruppen von Mitarbeitern gelten gesteigerte Pflichten bezüglich des Verhaltens im Betrieb und außerhalb:
a) Führungskräfte (insbesondere Manager)
b) Mitarbeiter, die im Rahmen ihrer betrieblichen Tätigkeiten Kontakt mit betriebsfremden Personen (...) haben
c) Mitarbeiter, die im Bildungswesen der Kirche religiösen Unterricht erteilen.
Die diesen Gruppen zugehörigen Arbeitnehmer müssen Mitglied der Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage sein. Sollten sie ihre Mitgliedschaft, aus welchen Gründen auch immer, verlieren oder sollten sie gegen die Grundsätze der Kirche in erheblichem Maße verstoßen, so muss dies eine Kündigung - in schwerwiegenden Fällen auch eine fristlose - nach sich ziehen.“
9. Anfang Dezember 1993 wandte sich der Beschwerdeführer an seinen zuständigen Seelsorger S. und bat um seelsorgerischen Beistand. Im Laufe des Gesprächs offenbarte er ihm, dass seine Ehe seit Jahren notleidend sei und dass er eine sexuelle Beziehung zu einer anderen Frau gehabt habe. S. legte ihm nahe, sich an N., Gebietspräsident und Vorgesetzter des Beschwerdeführers, zu wenden, und stellte klar, dass er N. unterrichten werde, wenn der Beschwerdeführer dies nicht selbst tue. Am 21. Dezember 1993 wandte sich der Beschwerdeführer an N., der sich seines seelsorgerischen Beistands enthielt. Am 27. Dezember 1993 sprach N. die fristlose Kündigung des Beschwerdeführers aus. Anschließend wurde der Betroffene im Rahmen eines internen Disziplinarverfahrens aus der Kirche ausgeschlossen.
B. Die Entscheidungen der unteren Arbeitsgerichte
10. Am 14. Januar 1994 reichte der Beschwerdeführer beim Arbeitsgericht Frankfurt am Main Klage ein. Mit Urteil vom 26. Januar 1995 hob dieses die Kündigung mit der Begründung auf, sie stehe im Widerspruch zu den Offenbarungen des Propheten und Gründer der mormonischen Kirche, Joseph Smith. Es führte aus, der Ausschluss eines Kirchenmitglieds
- 5 -
sei nämlich nur dann vorgesehen, wenn der Betroffene keine Reue zeige; dies sei bei dem Beschwerdeführer nicht der Fall, weil er um seelsorgerischen Beistand gebeten habe, um seine Ehe wieder in Ordnung zu bringen. Das Gericht hielt die Kündigung daher für eine unverhältnismäßige Sanktion.
11. Am 5. März 1996 wies das Hessische Landesarbeitsgericht die Berufung der Mormonenkirche zurück. Es war der Ansicht, dass die Verhängung einer solchen Maßnahme gegen den Beschwerdeführer im vorliegenden Fall gegen die guten Sitten verstoße, obwohl Ehebruch, der bei den Mormonen als „die gräulichste aller Sünden“ gelte, die Mormonenkirche grundsätzlich berechtige, dem fraglichen Angestellten zu kündigen. Unter Hinweis darauf, dass sich die Kirche auf Informationen zu den Eheproblemen des Paares gestützt habe, die der Beschwerdeführer seinen Seelsorgern mit dem Ziel offenbart habe, seelsorgerischen Beistand zu erhalten, war es der Auffassung, dass dieses Wissen moralisch der seelsorgerischen Schweigepflicht unterlegen hätte. Wie ein katholischer Priester oder Bischof, dem ein Verbrechen gebeichtet werde und der diese Information nicht an andere Personen weitergeben dürfe, solange sie nicht außerhalb der Beichte preisgegeben worden sei, seien daher dem Gericht zufolge die beiden Vorgesetzten des Beschwerdeführers nicht berechtigt gewesen, die Aussagen des Beschwerdeführers zu arbeitsrechtlichen Zwecken zu verwerten. Wegen der grundsätzlichen Bedeutung der Rechtssache ließ das Landesarbeitsgericht die Revision zu.
C. Das Urteil des Bundesarbeitsgerichts
12. Am 24. April 1997 hob das Bundesarbeitsgericht das Urteil des Landesarbeitsgerichts auf und verwies die Sache an dieses Gericht zurück. Ihm zufolge verstieß die streitgegenständliche Kündigung nicht gegen die guten Sitten und stellte durchaus einen Kündigungsgrund im Sinne des § 626 Bürgerliches Gesetzbuch (Rdnr. 25 unten) dar, da der Beschwerdeführer durch sein Verhalten gegen die in § 10 seines Anstellungsvertrags vorgesehenen Verpflichtungen verstoßen habe.
13. Unter Bezugnahme auf die Grundsatzentscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 4. Juni 1985 (Rdnr. 26 unten) wies das Bundesarbeitsgericht anschließend darauf hin, dass die moralischen Grundsätze der Mormonenkirche bei der Beurteilung der Frage, ob ein wichtiger Kündigungsgrund im Sinne von § 626 Bürgerliches Gesetzbuch vorliege, aus verfassungsrechtlichen Gründen zu berücksichtigen seien. Es führte weiterhin aus: Als Religionsgesellschaft im Sinne von Artikel 137 Absatz 3 der Weimarer Verfassung habe die Mor-
- 6 -
monenkirche das verfassungsrechtlich verbürgte Recht, ihre Angelegenheiten innerhalb der Schranken des für alle geltenden Gesetzes selbst zu regeln (Rdnr. 24 unten). Wenn sich die Kirchen der Privatautonomie zur Einstellung von Personen bedienten, finde das staatliche Arbeitsrecht zwar Anwendung. Jedoch hindere die Anwendbarkeit des Arbeitsrechts die Zugehörigkeit der Arbeitsverhältnisse zu den eigenen Angelegenheiten der Kirchen nicht. Eine Kirche könne daher im Interesse ihrer eigenen Glaubwürdigkeit ihren Beschäftigten die Beachtung der tragenden Grundsätze ihrer Glaubens- und Sittenlehre auferlegen und von ihnen verlangen, dass sie nicht gegen die fundamentalen Verpflichtungen verstoßen, die jedem ihrer Mitglieder obliegen. Das Bundesarbeitsgericht war der Meinung, im vorliegenden Fall sei die Mormonenkirche also berechtigt gewesen, vom Beschwerdeführer die Einhaltung der ehelichen Treue zu verlangen.
14. Es fügte hinzu, die Arbeitsgerichte seien bei der Anwendung der gesetzlichen Vorschriften zum Kündigungsschutz unter zwei Voraussetzungen an die Vorgaben der Kirchen gebunden: Zum einen müssten diese Vorgaben den anerkannten Maßstäben der verfassten Kirchen Rechnung tragen, zum anderen dürften sich die Arbeitsgerichte durch die Anwendung dieser Vorgaben nicht in Widerspruch zu den Grundprinzipien der Rechtsordnung beeben, darunter das allgemeine Willkürverbot sowie die Begriffe der „guten Sitten“ und des „ordre public“. Es obliege also den Arbeitsgerichten sicherzustellen, dass die Kirchen keine unannehmbaren Anforderungen an die Loyalität ihrer Arbeitnehmer stellten.
15. Im vorliegenden Fall vertrat das Bundesarbeitsgericht die Auffassung, dass die Vor-gaben der Mormonenkirche bezüglich der ehelichen Treue nicht im Widerspruch zu den Grundprinzipien der Rechtsordnung stünden. Auch in den verfassten Kirchen und in den Weltreligionen habe die Ehe eine herausragende Bedeutung (insbesondere in der katholischen Kirche, im Judentum und im Islam); dieses Verständnis habe seinen Niederschlag im Grundgesetz gefunden, dessen Artikel 6 die Ehe unter besonderen Schutz stelle. Der Ehebruch werde jedoch weiterhin von der Rechtsordnung als schwerwiegendes Fehlverhalten betrachtet, selbst wenn dies in der Praxis anders gesehen werde.
16. Das Bundesarbeitsgericht fügte hinzu, die Kündigung verstoße auch nicht gegen den allgemeinen Grundsatz von Treu und Glauben bei Vertragsverhältnissen. Das Recht der Mormonenkirche, einem Angestellten zu kündigen, ergebe sich aus Artikel 2 Absatz 1 des Grundgesetzes und insbesondere aus Artikel 137 Absatz 3 der Weimarer Verfassung. Gleichwohl könne sich der Beschwerdeführer auf das sich aus demselben Artikel ergebende
- 7 -
Recht berufen, selbst zu entscheiden, welche Informationen über sein Privatleben offenbart werden könnten. Es habe also ihm oblegen zu entscheiden, ob und zu welchem Zweck er seinen Ehebruch gegenüber Dritten offenbaren wollte. Es treffe sicherlich zu, dass die Mormonenkirche ihre Entscheidung nur dann auf solche Informationen habe stützen können, wenn ihr diese durch den Betroffenen selbst zur Kenntnis gebracht worden seien. Nach den Feststellungen des Landesarbeitsgerichts habe der Beschwerdeführer S. nur in dessen Eigenschaft als Seelsorger informiert. Die Mormonenkirche habe aber durch N. von dem Ehebruch erfahren. Die Feststellung des Landesarbeitsgerichts, dass sich der Beschwerdeführer mit einem seelsorgerischen Anliegen an N. gewandt habe, dieser sich aber seines seelsorgerischen Beistands enthalten habe, belege nicht, dass der Beschwerdeführer N. nur in dessen Eigenschaft als Seelsorger in Anspruch genommen habe. Die Mormonenkirche habe diese Sichtweise im Übrigen bestritten und hervorgehoben, nach ihrem eigenen Verständnis sei N. auch nicht dafür zuständig gewesen, als Seelsorger für den Beschwerdeführer zu fungieren. Das Bundesarbeitsgericht vertrat die Auffassung, dass die Schlussfolgerung des Landesarbeitsgerichts, wonach das Anliegen des Beschwerdeführers seinen seelsorgerischen Charakter allein dadurch, dass S. ihn an N. weiterverwiesen habe, nicht verloren habe, nicht tatsachenmäßig belegt sei und im Widerspruch zu der nicht vorhandenen Kompetenz von N. stehe. Dessen Schweigepflicht, auf die das Landesarbeitsgericht seine Auffassung gestützt habe, habe also gar nicht vorgelegen. Da der Beschwerdeführer im Übrigen klargestellt habe, dass es eine Beichte in der Mormonenkirche nicht gebe, sei der Verweis des Landesarbeitsgerichts auf die Praxis der Beichte in der katholischen Kirche unerheblich. Zudem habe der Beschwerdeführer N. gegenüber nicht ausdrücklich zu verstehen gegeben, dass er sich nur in dessen Eigenschaft als Seelsorger an ihn wende. Er habe sich an S. und N. gewandt, um sein Eheproblem zu lösen, aber zu keinem Zeitpunkt zu erkennen gegeben, dass er im Sinne von Abschnitt 42 Vers 23 und 24 der Prophetenschrift1 „mit ganzem Herzen Umkehr“ üben und zu seiner Frau zurückkehren wolle.
17. Das Bundesarbeitsgericht stellte ferner fest, die in Rede stehende Kündigung sei auch zur Bewahrung der Glaubwürdigkeit der Mormonenkirche erforderlich gewesen; diese Glaubwürdigkeit sei angesichts der Aufgaben, die der Beschwerdeführer als Gebietsdirektor Europa in der Abteilung Öffentlichkeitsarbeit hatte, gefährdet gewesen. In dieser Eigenschaft sei er dafür verantwortlich gewesen, ein richtiges und wohlwollendes Verständnis für die Kirche zu fördern, die Missionierung zu unterstützen und etwa 170 Mitarbeiter aus dem Bereich Öffentlichkeitsarbeit zu schulen und zu motivieren. Die Vermittlung der unbedingten Treue
- 8 -
zum Ehepartner als wesentlicher Grundsatz und der Glaube daran würden erschwert, wenn derjenige, der diesen Grundsatz in herausgehobener Position im Namen der Mormonenkirche verbreite, ihn selbst nicht beachte. Die Tatsache, dass der Ehebruch zum Zeitpunkt der Unterredungen mit S. und N. noch nicht öffentlich bekannt gewesen sei, ändere nichts an dieser Feststellung. Der Mormonenkirche sei nämlich nicht zuzumuten gewesen, die Kündigung erst nach Eintritt eines Glaubwürdigkeitsverlustes auszusprechen, zumal nicht davon ausgegangen werden konnte, dass die Ehefrau und die neue Partnerin Stillschweigen bewahren würden.
18. Das Bundesarbeitsgericht stellt im Übrigen fest, dass es einer Abmahnung durch die Mormonenkirche im Übrigen nicht bedurft habe, weil es sich um eine Pflichtverletzung gehandelt habe, deren Schwere dem Beschwerdeführer angesichts seiner langen Zugehörigkeit zu der Kirche hätte bewusst sein müssen und die sein Arbeitgeber offensichtlich nur habe missbilligen können.
19. Das Bundesarbeitsgericht gelangte zu dem Schluss, dass es an einer Sachentscheidung gehindert sei, weil die Vorinstanzen keine angemessene Abwägung der betroffenen Interessen gemäß den in seinem Urteil aufgestellten Kriterien getroffen hätten. Hinzu komme, dass den Streitparteien ferner Gelegenheit gegeben werden müsse, zu einer Umdeutung der außerordentlichen in eine ordentliche Kündigung Stellung zu nehmen.
D. Das Verfahren nach der Zurückverweisung der Rechtssache
20. In seiner im Rahmen der Rückverweisung ergangenen Entscheidung vom 26. Januar 1998 folgte das Landesarbeitsgericht der Argumentation des Bundesarbeitsgerichts in Bezug auf die Einstufung des Ehebruchs als schwerwiegende Pflichtverletzung (gleichbedeutend mit der Begehung einer schweren Straftat durch einen Arbeitnehmer eines weltlichen Arbeitgebers) und den exponierten Charakter der vom Beschwerdeführer wahrgenommenen Funktionen. In Anbetracht des relativ jungen Lebensalters des Beschwerdeführers zum Zeitpunkt der Kündigung (vierunddreißig Jahre) und der Dauer seiner Beschäftigung (sieben Jahre) stehe der sich daraus durch die Kündigung für ihn ergebende Schaden nicht entgegen. Da er in der Mormonenkirche aufgewachsen sei und dort verschiedene Aufgaben wahrgenommen habe, hätte dem Beschwerdeführer bewusst sein müssen, für wie schwer-wiegend sein Arbeitgeber seine Handlungen bewerte, zumal es sich nicht um einen einmaligen Fehltritt, sondern um eine längere Zeit andauernde außereheliche Beziehung handele.
- 9 -
Hinsichtlich der Notwendigkeit einer Kündigungsfrist vertrat das Landesarbeitsgericht die Auffassung, dass die Mormonenkirche einen enormen Glaubwürdigkeitsverlust zu befürchten gehabt hätte, wenn die Person, die ihre Interessen in ganz Europa vertreten habe, sich selbst nicht an die Vorgaben gehalten hätte. Die Kirche sei daher nicht verpflichtet gewesen, die Dauer der ordentlichen Kündigungsfrist (drei Monate) einzuhalten und den Beschwerdeführer nach dem 27. Dezember 1993 – dem Kündigungsdatum – in seinen Ämtern weiterzubeschäftigen.
21. Unter Hinweis darauf, dass es die Begründetheit der Kündigung nur arbeitsrechtlich zu behandeln habe, äußerte sich das Landesarbeitsgericht nicht zu der Frage, ob das interne Disziplinarverfahren der Mormonenkirche, das den Beschwerdeführer ausschließlich in seiner Eigenschaft als Kirchenmitglied betreffe, fair war. Darüber hinaus betonte es, seine Schlussfolgerungen seien nicht so zu verstehen, dass Ehebruch an sich einen Grund zur Kündigung von kirchlichen Mitarbeitern darstelle. Die Besonderheit des Falles liege darin, dass die Mormonenkirche Ehebruch als besonders schwerwiegend ansehe und dass sich aus der wichtigen Stellung des Beschwerdeführers gesteigerte Loyalitätspflichten ergeben hätten.
22. Am 16. Dezember 1998 wies das Bundesarbeitsgericht die Beschwerde des Beschwerdeführers gegen die Nichtzulassung der Revision mit der Begründung zurück, eine Divergenz zu seiner Rechtsprechung liege nicht vor.
23. Am 27. Juni 2002 lehnte es das Bundesverfassungsgericht ab, die Verfassungsbeschwerde des Beschwerdeführers zur Entscheidung anzunehmen (- 2 BvR 356/99 -), weil sie keine hinreichende Aussicht auf Erfolg habe. Nach seiner Ansicht würden die angegriffenen Entscheidungen vor dem Hintergrund seiner Entscheidung vom 4. Juni 1985 keine verfassungsrechtlichen Bedenken begegnen.
- 10 -
II. DAS EINSCHLÄGIGE INNERSTAATLICHE UND GEMEINSCHAFTLICHE RECHT UND DIE EINSCHLÄGIGE INNERSTAATLICHE UND GEMEINSCHAFTLICHE PRAXIS
A. Das Grundgesetz
24. Artikel 140 des Grundgesetzes führt aus, dass die Artikel 136 bis 139 und Artikel 141 (sog. Kirchenartikel) der Weimarer Verfassung vom 11. August 1919 Bestandteil des Grundgesetzes sind. Der einschlägige Passus von Artikel 137 lautet im vorliegenden Fall wie folgt:
Artikel 137
„(1) Es besteht keine Staatskirche.
(2) Die Freiheit der Vereinigung zu Religionsgesellschaften wird gewährleistet. (...)
(3) Jede Religionsgesellschaft ordnet und verwaltet ihre Angelegenheiten selbständig innerhalb der Schranken des für alle geltenden Gesetzes. (...)“
B. Die Kündigungsvorschriften
25. Nach § 626 des Bürgerlichen Gesetzbuches kann ein Dienstverhältnis von jedem Vertragsteil aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist gekündigt werden, wenn Tatsachen vorliegen, auf Grund derer unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalles und der Interessen der Vertragsteile dessen Fortsetzung bis zum Ablauf der Kündigungsfrist oder bis zu der vereinbarten Beendigung des Dienstverhältnisses nicht zugemutet werden kann. Nach Absatz 2 wird eine Frist von zwei Wochen gesetzt, die mit dem Zeitpunkt beginnt, in dem der Arbeitgeber von den dafür maßgebenden Tatsachen Kenntnis erlangt.
- 11 -
In § 1 Absätze 1 und 2 des Kündigungsschutzgesetzes heißt es insbesondere, dass eine Kündigung sozial ungerechtfertigt ist, wenn sie nicht durch Gründe, die in der Person oder in dem Verhalten des Arbeitnehmers liegen, bedingt ist.
C. Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 4. Juni 1985
26. Das Bundesverfassungsgericht hat am 4. Juni 1985 eine Grundsatzentscheidung zur Wirksamkeit von Kündigungen erlassen, die kirchliche Einrichtungen gegen in ihren Diensten stehende Arbeitnehmer wegen Verletzung von Loyalitätsobliegenheiten ausgesprochen haben (- BvR 1703/83, 1718/83, 856/84 -, Beschluss veröffentlicht in der Sammlung der Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts, Bd. 70, S. 138-173). Gegenstand der in Rede stehenden Verfassungsbeschwerden war einerseits die Kündigung eines in einem katholischen Krankenhaus beschäftigten Arztes wegen seines Standpunkts zum Thema Abtreibung und andererseits die Kündigung eines kaufmännischen Angestellten eines Jugendwohnheimes, das von einer Ordensgemeinschaft der katholischen Kirche geführt wird, wegen seines Austritts aus der katholischen Kirche. Nachdem die Arbeitsgerichte den beiden gekündigten Personen Recht gegeben hatten, haben die Kirchen das Bundesverfassungsgericht angerufen. Dieses hatte ihren Beschwerden stattgegeben.
Das hohe Gericht hat daran erinnert, dass das Recht der Religionsgesellschaften, ihre Angelegenheiten selbständig innerhalb der Schranken des für alle geltenden Gesetzes nach Maßgabe des Artikels 137 Absatz 3 der Weimarer Reichsverfassung zu regeln, nicht nur für die Kirchen gelten würde, sondern ohne Rücksicht auf ihre Rechtsform auch für alle der Kirche in bestimmter Weise zugeordneten Einrichtungen, wenn sie ein Stück des Auftrags der Kirche wahrnehmen. Bestandteil dieser Verfassungsgarantie sei das Recht der Kirchen, das für die Erfüllung ihres Auftrags erforderliche Personal auszuwählen und somit Arbeitsverträge abzuschließen. Bedienen sich die Kirchen wie jedermann der Privatautonomie zur Begründung von Arbeitsverhältnissen, würde auf diese das staatliche Arbeitsrecht Anwendung finden. Die Anwendung des Arbeitsrechts würde aber nicht dazu führen, die Zugehörigkeit der Arbeitsverhältnisse zu den eigenen Angelegenheiten der Kirche aufzuheben. Die Verfassungsgarantie des Selbstbestimmungsrechts der Kirchen bleibe für die Gestaltung der Arbeitsverhältnisse wesentlich. So könne eine Kirche im Interesse der eigenen Glaubwürdigkeit ihre Arbeitsverträge auf das Leitbild einer christlichen Dienstgemeinschaft stützen und dem-nach von den ihr angehörenden Arbeitnehmern die Beachtung der tragenden Grundsätze der kirchlichen Glaubens- und Sittenlehre sowie der fundamentalen Verpflichtungen verlangen, die jedem Kirchenglied obliegen. Durch all das würde die Rechtsstellung des kirchlichen
- 12 -
Arbeitnehmers keineswegs „klerikalisiert“. Es ginge vielmehr ausschließlich um den Inhalt und Umfang der vertraglich begründeten Loyalitätsobliegenheiten. Dies führe nicht dazu, dass aus dem bürgerlich-rechtlichen Arbeitsverhältnis eine Art kirchliches Statusverhältnis wird, das die Person total ergreift und ihre private Lebensführung voll umfasst.
Das Bundesverfassungsgericht hat ebenfalls dargelegt, dass die Gestaltungsfreiheit der Kirchen unter dem Vorbehalt des für alle geltenden Gesetzes stehe, einschließlich der Vorschriften zum Schutz vor ungerechtfertigten Kündigungen, nämlich die §§ 1 des Kündigungsschutzgesetzes und 626 des Bürgerlichen Gesetzbuches. Dies würde aber nicht bedeuten, dass diese Bestimmungen den so genannten Kirchenartikeln der Weimarer Reichsverfassung vorgehen würden. Somit müsse eine Abwägung der unterschiedlichen Rechte vorgenommen und dem Selbstverständnis der Kirchen ein besonderes Gewicht beigemessen werden. Das Bundesverfassungsgericht führte weiter aus:
„Daraus folgt: Gewährleistet die Verfassungsgarantie des kirchlichen Selbstbestimmungsrechts, dass die Kirchen bei der arbeitsvertraglichen Gestaltung des kirchlichen Dienstes das Leitbild einer christlichen Dienstgemeinschaft zugrunde legen und die Verbindlichkeit kirchlicher Grundpflichten bestimmen können, so ist diese Gewährleistung bei der Anwendung des Kündigungsschutzrechts auf Kündigungen von Arbeitsverhältnissen wegen der Verletzung der sich daraus für die Arbeitnehmer ergebenden Loyalitätsobliegenheiten aus verfassungsrechtlichen Gründen zu berücksichtigen und ihre Tragweite festzustellen. Eine Rechtsanwendung, bei der die vom kirchlichen Selbstverständnis her gebotene Verpflichtung der kirchlichen Arbeitnehmer auf grundlegende Maximen kirchlichen Lebens arbeitsrechtlich ohne Bedeutung bliebe, widerspräche dem verfassungsverbürgten Selbstbestimmungsrecht der Kirchen.
Daraus ergibt sich: Im Streitfall haben die Arbeitsgerichte die vorgegebenen kirchlichen Maßstäbe für die Bewertung vertraglicher Loyalitätspflichten zugrunde zu legen, soweit die Verfassung das Recht der Kirchen anerkennt, hierüber selbst zu befinden. Es bleibt danach grundsätzlich den verfassten Kirchen überlassen, verbindlich zu bestimmen, was "die Glaubwürdigkeit der Kirche und ihrer Verkündigung erfordert", was "spezifisch kirchliche Aufgaben" sind, was "Nähe" zu ihnen bedeutet, welches die "wesentlichen Grundsätze der Glaubens- und Sittenlehre" sind und was als - gegebenenfalls schwerer - Verstoß gegen diese anzusehen ist. Auch die Entscheidung darüber, ob und wie innerhalb der im kirchlichen Dienst tätigen Mitarbeiter eine "Abstufung" der Loyalitätspflichten eingreifen soll, ist grundsätzlich eine dem kirchlichen Selbstbestimmungsrecht unterliegende Angelegenheit. Soweit diese kirchlichen Vorgaben den anerkannten Maßstäben der verfassten Kirchen Rechnung tragen, was in Zweifelsfällen durch entsprechende gerichtliche Rückfragen bei den zuständigen Kirchenbehörden aufzuklären ist, sind die Arbeitsgerichte
- 13 -
an sie gebunden, es sei denn, die Gerichte begäben sich dadurch in Widerspruch zu Grundprinzipien der Rechtsordnung, wie sie im allgemeinen Willkürverbot sowie in dem Begriff der "guten Sitten" und des ordre public ihren Niederschlag gefunden haben. Es bleibt in diesem Bereich somit Aufgabe der staatlichen Gerichtsbarkeit sicherzustellen, dass die kirchlichen Einrichtungen nicht in Einzelfällen unannehmbare Anforderungen - insoweit möglicherweise entgegen den Grundsätzen der eigenen Kirche und der daraus folgenden Fürsorgepflicht - an die Loyalität ihrer Arbeitnehmer stellen.
Kommen sie hierbei zur Annahme einer Verletzung solcher Loyalitätsobliegenheiten, so ist die weitere Frage, ob diese Verletzung eine Kündigung des kirchlichen Arbeitsverhältnisses sachlich rechtfertigt, nach den kündigungsschutzrechtlichen Vorschriften der §§ 1 KSchG, 626 BGB zu beantworten (...)“
. Die Richtlinie 2000/78/EG vom 27. November 2000
27. In der Richtlinie 2000/78/EG des Rates vom 27. November 2000 zur Festlegung eines allgemeinen Rahmens für die Verwirklichung der Gleichbehandlung in Beschäftigung und Beruf heißt es:
Erwägungsgrund (24)
„Die Europäische Union hat in ihrer der Schlussakte zum Vertrag von Amsterdam beigefügten Erklärung Nr. 11 zum Status der Kirchen und weltanschaulichen Gemeinschaften ausdrücklich anerkannt, dass sie den Status, den Kirchen und religiöse Vereinigungen oder Gemeinschaften in den Mitgliedstaaten nach deren Rechtsvorschriften genießen, achtet und ihn nicht beeinträchtigt und dass dies in gleicher Weise für den Status von weltanschaulichen Gemeinschaften gilt. Die Mitgliedstaaten können in dieser Hinsicht spezifische Bestimmungen über die wesentlichen, rechtmäßigen und gerechtfertigten beruflichen Anforderungen beibehalten oder vorsehen, die Vo-raussetzung für die Ausübung einer diesbezüglichen beruflichen Tätigkeit sein können.“
Artikel 4
Berufliche Anforderungen
„(1) (...) können die Mitgliedstaaten vorsehen, dass eine Ungleichbehandlung wegen [der Reli-
- 14 -
aufgrund der Art einer bestimmten beruflichen Tätigkeit oder der Bedingungen ihrer Ausübung eine wesentliche und entscheidende berufliche Anforderung darstellt, sofern es sich um einen rechtmäßigen Zweck und eine angemessene Anforderung handelt.
(2) Die Mitgliedstaaten können in Bezug auf berufliche Tätigkeiten innerhalb von Kirchen und anderen öffentlichen oder privaten Organisationen, deren Ethos auf religiösen Grundsätzen oder Weltanschauungen beruht, Bestimmungen in ihren (...) geltenden Rechtsvorschriften beibehalten oder in künftigen Rechtsvorschriften Bestimmungen vorsehen, die zum Zeitpunkt der Annahme dieser Richtlinie bestehende einzelstaatliche Gepflogenheiten widerspiegeln und wonach eine Ungleichbehandlung wegen der Religion oder Weltanschauung einer Person keine Diskriminierung darstellt, wenn die Religion oder die Weltanschauung dieser Person nach der Art dieser Tätigkeiten oder der Umstände ihrer Ausübung eine wesentliche, rechtmäßige und gerechtfertigte berufliche Anforderung angesichts des Ethos der Organisation darstellt. (...).
Sofern die Bestimmungen dieser Richtlinie im übrigen eingehalten werden, können die Kirchen und anderen öffentlichen oder privaten Organisationen, deren Ethos auf religiösen Grundsätzen oder Weltanschauungen beruht, im Einklang mit den einzelstaatlichen verfassungsrechtlichen Bestimmungen und Rechtsvorschriften von den für sie arbeitenden Personen verlangen, dass sie sich loyal und aufrichtig im Sinne des Ethos der Organisation verhalten.“
RECHTLCHE WÜRDIGUNG
I. DIE BEHAUPTETE VERLETZUNG DES ARTIKELS 8 DER KONVENTION
28. Der Beschwerdeführer behauptet, sein Ehebruch rechtfertige nicht seine fristlose Kündigung; ferner rügt er die Bestätigung dieser Kündigung durch die Arbeitsgerichte und das Bundesverfassungsgericht. Er beruft sich auf Artikel 8 der Konvention, dessen einschlägiger Passus wie folgt lautet:
„(1) Jede Person hat das Recht auf Achtung ihres Privat (...) -lebens (....)
(2) Eine Behörde darf in die Ausübung dieses Rechts nur eingreifen, soweit der Eingriff gesetzlich vorgesehen und in einer demokratischen Gesellschaft notwendig ist ... zum Schutz der Rechte und Freiheiten anderer.“
- 15 -
29. Die Regierung bestreitet diese Behauptung.
A. Zur Zulässigkeit
30. Der Gerichtshof stellt fest, dass die Beschwerde nicht offensichtlich unbegründet im Sinne von Artikel 35 Absatz 3 der Konvention ist. Er stellt ferner fest, dass in Bezug auf die Rüge kein anderer Unzulässigkeitsgrund vorliegt. Die Beschwerde ist daher für zulässig zu erklären.
B. Zur Hauptsache
1. Stellungnahmen der Parteien
a) Der Beschwerdeführer
31. Der Beschwerdeführer behauptet, die Arbeitsgerichte hätten die in Rede stehenden Interessen unzureichend gewürdigt und abgewogen. Dies führe zu einem Rechtsprechungs-Automatismus zugunsten der Kirchen, die dem Betroffenen zufolge im deutschen Recht einen privilegierten Status innehaben, den keine andere wohltätige Organisation genieße. Sein Recht auf Achtung seines Privatlebens oder seiner Intimsphäre seien von den Arbeitsgerichten nicht geprüft worden. Artikel 8 der Konvention verleihe ihm aber das Recht, ein Lebensmodell aufzugeben und ein neues zu wählen. Der Betroffene behauptet, dass dieses Recht, auch wenn es das Recht der Kirchen, ihre Angelegenheiten selbständig zu regeln, nicht in Frage stelle, dennoch nicht so weit gehen dürfe, dass sie ihre Beschäftigten zwingen können, Glaubenssätze über den beruflichen Bereich hinaus zu befolgen. Er trägt vor, dass die Arbeitsgerichte ihre Rechtsprechung in völlig unvorhersehbarer Weise ausgedehnt hätten, da bisher eine Kündigung seines Wissens nur im Falle einer Wiederverheiratung und nicht aufgrund einer außerehelichen intimen Beziehung ausgesprochen werden durfte. Angesichts der Vielzahl der kirchlichen Gebote mangele es in dieser Hinsicht an Vorhersehbarkeit; die Kündigung hänge schließlich allein von den Ansichten des jeweiligen Personalverantwortlichen ab. Die Rolle des Arbeitsgerichts beschränke sich somit darauf, den Willen des kirchlichen Arbeitgebers auszuführen. Nach Ansicht des Beschwerdeführers liegt die Folge dieser Tendenz darin, dass der Arbeitgeber und das Arbeitsgericht veranlasst werden, sich zunehmend in das Privatleben der Beschäftigten einzumischen, um die als Grundlage für die Kündigung dienenden Fakten zu ermitteln und zu würdigen. Im Übrigen werde die Glaubwürdig-
- 16 -
keit einer Kirche nicht dadurch erschüttert, dass der ein oder andere Beschäftigte einige kirchliche Regeln nicht genau beachte; darin manifestiere sich lediglich das typische Menschsein der fraglichen Person.
32. Der Beschwerdeführer hebt ferner hervor, dass er nicht auf seine Privatsphäre verzichtet habe, als er den Arbeitsvertrag mit der mormonischen Kirche unterzeichnet habe. Unter Hinweis auf die Macht, die jeder Arbeitgeber bei einer Einstellung besitze, fügt er hinzu, dass er jedenfalls keine Wahl gehabt habe, die pauschale Klausel in § 10 des Vertrags, abzulehnen. Außerdem behauptet er, er habe im Zeitpunkt der Unterzeichnung des Vertrags im Jahr 1986 nicht vorhersehen können, dass er sich eines Tages von seiner Frau trennen würde. Der Beschwerdeführer sieht Ehebruch nicht als das schwerste Vergehen nach Mord an, denn andere Verse des Buches Mormon erwähnten die Möglichkeit der Reue und der Vergebung. Sein Vorgesetzter S. habe ihn ferner gezwungen, N. seine außereheliche Beziehung zu offenbaren. Wie dem auch sei, er habe aufgrund seiner Stellung als einfacher Mitarbeiter, der lediglich den Gebietspräsidenten zuzuarbeiten hatte, der seinerseits die Mormonenkirche nach außen vertreten habe, keinen gesteigerten Loyalitätspflichten unterlegen.
33. Der Beschwerdeführer behauptet schließlich, dass die Grundsatzentscheidung des Bundesverfassungsgerichts von 1985 nicht seine Privatsphäre betreffe, dass der von der Regierung geltend gemachte Ermessensspielraum nicht gegeben sei, da die Öffentlichkeit in Deutschland sich immer weniger für Wiederverheiratungen interessiere und die europäische Richtlinie 2000/78/EG nur die Frage der Einstellung und nicht die der Kündigung nach langer Beschäftigungsdauer behandle.
b) Die Regierung
34. Die Regierung behauptet, dass die Mormonenkirche trotz ihres Status als öffentlich-rechtliche Körperschaft nicht zur öffentlichen Gewalt zählt. Es liege daher kein Eingriff durch die staatliche Gewalt in die Rechte des Beschwerdeführers vor. Die Regierung ist daher der Auffassung, dass die von den Arbeitsgerichten angeführte Verfehlung allein unter dem Blickwinkel der Schutzpflicht des Staates beurteilt werden könne. Da es keinen gemeinsamen Standard der Mitgliedstaaten gebe, sei der Gestaltungsspielraum weit, zumal es sich hier um einen Bereich handele, der mit religiösen Gefühlen, Traditionen und der Religion verbunden sei. Die Regierung ruft in Erinnerung, dass die Europäische Kommission für Menschenrechte im Übrigen die Erwägungsgründe im Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom
- 17 -
4. Juni 1985 bestätigt hatte, auf die das Bundesarbeitsgericht im vorliegenden Fall Bezug genommen hatte (R. ./. Deutschland, Nr. 12242/86, Entscheidung der Kommission vom 6. September 1989, Entscheidungen und Berichte 62, 151).
35. Die Regierung legt anschließend dar, dass die Arbeitsgerichte, die über einen Rechtsstreit zwischen zwei Rechteinhabern zu entscheiden hatten, die Interessen des Beschwerdeführers und das Recht der Mormonenkirche, ihre Angelegenheiten nach Artikel 137 der Weimarer Reichsverfassung autonom zu regeln, abzuwägen hatten. Sie vertritt die Auffassung, das Arbeitsgericht sei bei der Anwendung der Kündigungsvorschriften gehalten gewesen, den Grundsätzen der Mormonenkirche Rechnung zu tragen, da es den Kirchen und Religionsgemeinschaften selbst nach ihrem Selbstbestimmungsrecht obliege, die Loyalitätspflichten festzulegen, die ihre Arbeitnehmer zu beachten haben, um die Glaubwürdigkeit dieser Kirchen und Religionsgemeinschaften zu bewahren. Die Regierung führt aus, dass somit die Berücksichtigung kirchlicher Vorgaben nicht schrankenlos ist und die staatlichen Gerichte nicht eine Vorschrift anwenden dürfen, die den allgemeinen Grundsätzen der Rechtsordnung zuwiderläuft. Mit anderen Worten: Die kirchlichen Arbeitgeber können zwar ihren Beschäftigten Loyalitätspflichten auferlegen, doch ist es nicht ihre Aufgabe, Kündigungsgründe festzulegen, was durch die Auslegung der gesetzlichen Vorschriften zum Kündigungsschutz seitens des Gerichts erfolgt.
36. Das Bundesarbeitsgericht und anschließend das Landesarbeitsgericht hätten diese Grundsätze auf den vorliegenden Fall angewandt und die in Rede stehenden Interessen gebührend abgewogen, nämlich die Art der Stellung, die der Beschwerdeführer bekleidete (Ausbildung von 170 Mitarbeitern), die Schwere der Verfehlung nach der Wahrnehmung der Mormonenkirche (wiederholter Ehebruch), das Alter des Beschwerdeführers (34 Jahre) und die Dauer seiner Beschäftigung (sieben Jahre). Die Regierung fügt hinzu, dass eine Kündigung zwar tatsächlich die im deutschen Arbeitsrecht auszusprechende schwerste Sanktion sei (ultima ratio), doch eine weniger schwerwiegende Maßnahme, beispielsweise eine Abmahnung, vorliegend nicht geboten gewesen sei, da ihres Erachtens der Beschwerdeführer keinen Zweifel daran haben konnte, dass sein Arbeitgeber sein Verhalten nicht tolerieren würde. Sie weist darauf hin, dass der Beschwerdeführer freiwillig den Arbeitsvertrag mit der Mormonenkirche abgeschlossen habe, in dem für bestimmte Ämter gesteigerte Loyalitäts-pflichten vorgesehen waren. Der Beschwerdeführer habe somit der Beschränkung seiner Rechte zugestimmt, was nach den Bestimmungen der Konvention möglich sei (vorgenannte Entscheidung R.). Da er in der Mormonenkirche aufgewachsen sei, hätten ihm die grundle-
- 18 -
gende Bedeutung der Treue der Ehegatten innerhalb dieser Kirche und die etwaigen Folgen seines Ehebruchs bewusst sein müssen. Schließlich trägt die Regierung vor, dass die Tatsache, dass die Loyalitätspflichten sich auf das Privatleben des Arbeitnehmers auswirken können, für zwischen kirchlichen Arbeitgebern und ihren Mitarbeiter geschlossene Verträge bezeichnend sei.
c) Die Drittbeteiligte
37. Die Mormonenkirche pflichtet im Wesentlichen den Schlussfolgerungen der Regierung bei und betont, dass ihres Erachtens die Feststellung einer Verletzung der Konvention einen schweren Eingriff darstellt, der europaweit Folgen für die Arbeitsverhältnisse aller Religionsgemeinschaften hätte. Die Selbständigkeit dieser Gemeinschaften sei für den religiösen Pluralismus in einer demokratischen Gesellschaft unabdingbar. Es sei Aufgabe der Kirchen ihre Art der Organisation zu bestimmen und über die Bedeutung der Vorgaben für sie und ihre Mitglieder zu entscheiden. Diese Vorgaben müssten als Bestandteil der Identität der Kirche von den staatlichen weltlichen Behörden beachtet werden, selbst in den Fällen, in denen nicht so strenge Standards im Hinblick auf das weltliche Recht und die weltlichen Überzeugungen Anwendung finden könnten.
38. Die Mormonenkirche fügt hinzu, dass ihre Anforderungen an das Verhalten ihrer Gläubigen sicher hoch sind. Das Verbot des Ehebruchs sei nicht nur eine Regel unter zahl-reichen anderen, sondern eines der wichtigsten Gebote und stehe im Zentrum ihrer Glaubenslehre. Echte Reue gebiete es dem Betroffenen, seine Handlungen zu gestehen, die Absicht zu zeigen, die vorherige Situation wieder herzustellen, dem Ehebruch ein Ende zu setzen und die Folgen seiner Sünde, die beispielsweise in einem Arbeitsvertrag vorgesehen sind, zu tragen.
2. Die Würdigung durch den Gerichtshof
39. Der Gerichtshof ruft in Erinnerung, dass der Begriff „Privatleben“ weit gefasst ist und nicht abschließend definiert werden kann. Dieser Begriff bezieht sich auf die körperliche und moralische Unversehrtheit einer Person und umfasst gelegentlich Aspekte der physischen und sozialen Identität einer Person, darunter das Recht, Beziehungen zu anderen Menschen zu knüpfen und zu entwickeln, das Recht auf „persönliche Entfaltung“ oder das Recht auf
- 19 -
Selbstbestimmung als solches. Der Gerichtshof weist auch darauf hin, dass diese Aspekte, wie beispielsweise die sexuelle Identität, der Name, die sexuelle Ausrichtung und das Sexualleben zu der durch Artikel 8 geschützten Persönlichkeitssphäre zählen (E.B. ./. Frankreich [GK], Nr. 43546/02, Rdnr. 43, CEDH 2008-..., und Schlumpf ./. Schweiz, Nr. 29002/06, Rdnr. 100, 8. Januar 2009).
40. Der Gerichtshof stellt im vorliegenden Fall zunächst fest, dass der Beschwerdeführer nicht staatliches Handeln rügt, sondern den Umstand, dass dieser seine Privatsphäre nicht gegen den Eingriff seines Arbeitgebers geschützt hat. Hierzu macht er gleich zu Beginn darauf aufmerksam, dass die Mormonenkirche trotz ihres Status als öffentlich-rechtliche Körperschaft nach deutschen Recht keine hoheitlichen Rechte ausübt (vgl. vorgenannte Entscheidung R., Finska Församlingen i Stockholm und Teuvo Hautaniemi ./. Schweden, Entscheidung der Kommission vom 11. April 1996, Nr. 24019/94, und Predota ./. Österreich (Entsch.), Nr. 28962/95, 18. Januar 2000).
41. Der Gerichtshof macht anschließend deutlich, dass Artikel 8 zwar grundsätzlich zum Ziel hat, den Einzelnen vor willkürlichen behördlichen Eingriffen zu schützen, sich jedoch nicht darauf beschränkt, dem Staat aufzuerlegen, sich solcher Eingriffe zu enthalten: Zu dieser negativen Verpflichtung können positive Verpflichtungen hinzukommen, die Bestandteil einer wirksamen Achtung des Privat- und Familienlebens sind. Diese können Maßnahmen erforderlich machen, die der Achtung der Privatsphäre dienen und bis in die Beziehungen zwischen den Einzelnen untereinander reichen. Die Abgrenzung der positiven von den negativen Verpflichtungen des Staates aus Artikel 8 eignet sich zwar nicht für eine präzise Bestimmung, doch sind die anwendbaren Grundsätze durchaus vergleichbar. In beiden Fällen ist insbesondere das zwischen dem Allgemeininteresse und den Interessen des Einzelnen herzustellende ausgewogene Gleichgewicht zu berücksichtigen, wobei der Staat in jedem Fall über einen Ermessensspielraum verfügt (Evans ./. Vereinigtes Königreich [GK], Nr. 6339/05, Rdnrn. 75-76, CEDH 2007-IV, vorgenannte Entscheidung R.; siehe auch Fuentes Bobo ./. Spanien, Nr. 39293/98, Rdnr. 38, 29. Februar 2000).
42. Der Gerichtshof führt ferner aus, dass der dem Staat eingeräumte Gestaltungsspielraum weiter ist, wenn es innerhalb der Mitgliedstaaten des Europarats keinen Konsens über die Bedeutung der in Rede stehenden Interessen oder über die besten Mittel zu ihrem Schutz gibt. Der Spielraum ist ganz allgemein auch weit, wenn der Staat einen gerechten Ausgleich zwischen konkurrierenden privaten und öffentlichen Interessen oder verschiede-
- 20 -
nen konventionsrechtlich geschützten Rechten herbeizuführen hat (vorgenannte Rechtssache Evans, Rdnr. 77).
43. Die grundlegende Frage, die sich im vorliegenden Fall stellt, lautet demnach, ob der Staat im Rahmen seiner Schutzpflichten aus Artikel 8 verpflichtet war anzuerkennen, dass dem Beschwerdeführer im Zusammenhang mit der von der Mormonenkirche ausgesprochenen Kündigung das Recht auf Achtung seines Privatlebens zustand. Folglich hat der Gerichthof bei der Prüfung der von den deutschen Arbeitsgerichten vorgenommenen Abwägung dieses Rechts des Beschwerdeführers mit dem Recht der Mormonenkirche aus den Artikeln 9 und 11 zu ermitteln, ob das Maß des dem Beschwerdeführer gebotenen Schutzes ausreichend war oder nicht.
44. In dieser Hinsicht weist der Gerichtshof darauf hin, dass die Religionsgemeinschaften traditionell und weltweit in Form organisierter Strukturen existieren; wenn die Organisation einer solchen Gemeinschaft in Rede steht, ist also Artikel 9 im Lichte des Artikels 11 der Konvention auszulegen, der die Vereinigungsfreiheit vor jeglichem ungerechtfertigten staatlichen Eingriff schützt. Ihre für den Pluralismus in einer demokratischen Gesellschaft unverzichtbare Autonomie gehört nämlich zum Kernbestand des Schutzes, den Artikel 9 vermittelt. Der Gerichtshof legt ferner dar, dass das Recht auf Religionsfreiheit im Sinne der Konvention außer in extremen Ausnahmefällen jegliche Beurteilung seitens des Staates im Hinblick auf die Rechtmäßigkeit des religiösen Bekenntnisses oder die Art und Weise, in der es zum Ausdruck gebracht wird, ausschließt (Hassan und Tchaouch ./. Bulgarien [GK], Nr. 30985/96, Rdnrn. 62 und 78, CEDH 2000-XI). Geht es schließlich um Fragen über das Verhältnis zwischen Staat und Religionen, hinsichtlich derer in einer demokratischen Gesellschaft berechtigterweise tiefgreifende Divergenzen herrschen können, ist der Rolle der nationalen Entscheidungsträger besondere Bedeutung beizumessen (Leyla Þahin ./. Türkei [GK], Nr. 44774/98, Rdnr. 108, CEDH 2005-XI).
45. Der Gerichtshof stellt zunächst heraus, dass Deutschland, indem es ein Arbeitsgerichtssystem sowie ein Verfassungsgericht, das für die Kontrolle der durch die Arbeitsgerichte ergangenen Entscheidungen zuständig ist, eingerichtet hat, seine Schutzpflicht gegenüber den Rechtsuchenden im arbeitsrechtlichen Bereich erfüllt hat, in dem die Streitigkeiten ganz allgemein die Rechte der Betroffenen aus Artikel 8 der Konvention berühren. Folglich hatte der Beschwerdeführer im vorliegenden Fall die Möglichkeit, das Arbeitsgericht mit seinem Fall zu befassen, das die Rechtmäßigkeit der streitigen Kündigung unter dem Blickwinkel
- 21 -
des staatlichen Arbeitsrechts unter Berücksichtigung des kirchlichen Arbeitsrechts zu untersuchen und die widerstreitenden Interessen des Beschwerdeführers und des kirchlichen Arbeitgebers abzuwägen hatte.
46. Der Gerichtshof merkt danach an, dass das Bundesarbeitsgericht mit seinem Urteil vom 24. April 1997 sich umfassend auf die vom Bundesverfassungsgericht in seinem Urteil vom 4. Juni 1985 aufgestellten Grundsätze bezogen hat (Rdnr. 26 oben). Das Bundesarbeitsgericht hat insbesondere herausgestellt, dass die Anwendbarkeit des staatlichen Arbeitsrechts zwar nicht die Zugehörigkeit der Arbeitsverhältnisse zu den eigenen Angelegenheiten der Kirchen hindere, das Arbeitsgericht jedoch nur unter der Voraussetzung an die tragenden Grundsätze der Glaubens- und Sittenlehre kirchlicher Arbeitgeber gebunden sei, dass diese Lehre der Lehre der verfassten Kirchen Rechnung trägt und nicht im Widerspruch zu den Grundprinzipien der Rechtsordnung steht.
47. In Bezug auf die Anwendung dieser Kriterien auf den Fall des Beschwerdeführers stellt der Gerichtshof fest, dass das Bundesverfassungsgericht der Meinung war, dass die Vorgaben der Mormonenkirche hinsichtlich der ehelichen Treue den Grundprinzipien der Rechtsordnung nicht widersprechen, weil der Ehe auch in anderen Religionen und im Grundgesetz eine herausragende Bedeutung zukomme. Das Bundesarbeitsgericht betonte in diesem Zusammenhang, dass die Mormonenkirche die Kündigung nur deshalb auf den Ehebruch des Beschwerdeführer habe stützen können, weil der Betroffene selbst ihr die Informationen über den Ehebruch zur Kenntnis gebracht habe. Nachdem es die Argumente der Parteien geprüft hatte, gelangte es zu dem Schluss, dass der Beschwerdeführer aus eigenem Antrieb seinen Arbeitgeber über sein Verhalten, das die Kündigung bedingte, unterrichtet hat und dass insbesondere seine Behauptungen zum rein seelsorgerischen Charakter seiner Gespräche mit S., dann mit N., keine Grundlage in den erwiesenen Tatsachen fänden und im Widerspruch zu der nicht vorhandenen seelsorgerischen Kompetenz von N. stünden.
48. Daraufhin stellt der Gerichtshof fest, dass dem Bundesarbeitsgericht zufolge die Kündigung eine erforderliche Maßnahme war, um die Glaubwürdigkeit der Mormonenkirche zu bewahren, vor allem angesichts der Art der Position, die der Beschwerdeführer innehatte, und der Bedeutung, die der absoluten Treue zum Ehegatten in der Kirche zukommt. Das hohe Gericht hat auch ausgeführt, weshalb die Mormonenkirche nicht verpflichtet war, zunächst eine weniger schwere Sanktion, beispielsweise eine Abmahnung, auszusprechen. Der Gerichtshof führt weiterhin aus, dass nach Ansicht des Landesarbeitsgerichts der Scha-
- 22 -
den des Beschwerdeführers durch die Kündigung angesichts seines Alters, der Dauer seiner Beschäftigung und der Tatsache, dass dem Betroffenen, der in der Mormonenkirche aufgewachsen ist und dort verschiedene Ämter bekleidet hat, hätte bewusst sein müssen, für wie schwerwiegend sein Arbeitgeber seine Handlungen bewertet, zumal es sich nicht um einen einmaligen Fehltritt, sondern um eine länger andauernde außereheliche Beziehung handelte, begrenzt ist.
49. Der Gerichtshof weist auch darauf hin, dass sich die Arbeitsgerichte mit der Frage auseinandergesetzt haben, ob die Kündigung des Beschwerdeführers auf den zwischen dem Betroffenen und der Mormonenkirche geschlossenen Anstellungsvertrag gestützt werden konnte und ob sie in Einklang mit § 626 des Bürgerlichen Gesetzbuches stand. Sie haben alle sachdienlichen Aspekte berücksichtigt und die betroffenen Interessen eingehend und umfassend abgewogen. Dass sie der Mormonenkirche das Recht zuerkannt haben, ihren Beschäftigen Loyalitätspflichten aufzuerlegen, und dass sie schließlich den Interessen der Mormonenkirche mehr Gewicht beigemessen haben als den Interessen des Beschwerdeführers, kann eigentlich mit Blick auf die Konvention kein Problem aufwerfen. Hierzu stellt der Gerichtshof fest, dass dem Bundesarbeitsgericht zufolge die Arbeitsgerichte nicht uneingeschränkt an die Vorgaben der Kirchen und Religionsgemeinschaften gebunden waren, sondern dafür Sorge zu tragen hatten, dass diese nicht ihren Beschäftigen unannehmbare Loyalitätspflichten auferlegen.
50. Der Gerichtshof hält die Schussfolgerungen der Arbeitsgerichte, denen zufolge der Beschwerdeführer keinen unannehmbaren Verpflichtungen unterworfen wurde, für nicht unangemessen. Der Gerichtshof vertritt nämlich die Auffassung, dass dem Betroffenen, da er in der Mormonenkirche aufgewachsen war, bei der Unterzeichnung des Anstellungsvertrags und insbesondere des § 10 des Vertrags (über die Einhaltung „hoher moralischer Grundsätze“) bewusst war oder hätte bewusst sein müssen, welche Bedeutung sein Arbeitgeber der ehelichen Treue beimisst (siehe entsprechend Ahtinen ./. Finnland, Nr. 48907/99, Rdnr. 41, 23. September 2008) und dass seine außereheliche Beziehung, die er eingegangen war, mit den gesteigerten Loyalitätsobliegenheiten, zu denen er sich gegenüber der Mormonenkirche als Gebietsdirektor Europa in der Abteilung Öffentlichkeitsarbeit verpflichtet hatte, unvereinbar ist.
- 23 -
51. Nach Ansicht des Gerichtshofs ist die Tatsache, dass die Kündigung auf ein Verhalten aus der Privatsphäre des Beschwerdeführers gestützt wurde, und dies geschah, ohne dass der Fall in die Medien gelangte oder das fragliche Verhalten bedeutende öffentliche Auswirkungen hatte, im vorliegenden Fall nicht ausschlaggebend. Er stellt fest, dass sich die besondere Art der dem Beschwerdeführer auferlegten beruflichen Anforderungen aus der Tatsache ergeben, dass sie von einem Arbeitgeber festgelegt wurden, dessen Ethos auf religiösen Grundsätzen oder Weltanschauungen beruht (siehe Rdnr. 27 oben, Artikel 4 der Richtlinie 2000/78/EG; siehe auch Lombardi Vallauri ./. Italie, Nr. 39128/05, Rdnr. 41, CEDH 2009-... (Auszüge)). Er ist hierbei der Meinung, dass die Arbeitsgerichte hinlänglich nachgewiesen haben, dass die dem Beschwerdeführer auferlegten Loyalitätspflichten annehmbar waren, insofern als sie die Glaubwürdigkeit der Mormonenkirche bewahren sollten. Weiterhin stellt er heraus, dass das Landesarbeitsgericht eindeutig dargelegt hat, dass seine Schlussfolgerungen nicht so zu verstehen seien, als würden sie bedeuten, dass jeder Ehebruch an sich einen Grund für eine [fristlose] Kündigung eines kirchlichen Beschäftigten darstellt, sondern dass es aufgrund der Schwere des Ehebruchs in den Augen der Mormonenkirche und der herausragenden Position, die der Beschwerdeführer bekleidete und die ihn gesteigerten Loyalitätspflichten unterwarf, zu diesem Schluss gelangt sei.
52. Angesichts des Ermessensspielraums des Staates im vorliegenden Fall (Rdnr. 42 oben) und insbesondere der Tatsache, dass die Arbeitsgerichte einen gerechten Ausgleich zwischen mehreren privaten Interessen herbeiführen mussten, erachtet der Gerichtshof diese Aspekte für ausreichend, um zu dem Schluss zu gelangen, dass im vorliegenden Fall Artikel 8 der Konvention dem deutschen Staat nicht auferlegte, dem Beschwerdeführer einen höheren Schutz zu bieten.
53. Infolgedessen ist dieser Artikel vorliegend nicht verletzt worden.
- 24 -
AUS DIESEN GRÜNDEN ENTSCHEIDET DER GERICHTSHOF EINSTIMMIG:
1. Er erklärt die Beschwerde für zulässig.
2. Er entscheidet, dass Artikel 8 der Konvention nicht verletzt worden ist.
Ausgefertigt in französischer Sprache und anschließend am 23. September 2010 gemäß Artikel 77 Absätze 2 und 3 der Verfahrensordnung schriftlich übermittelt.
Claudia Westerdiek
Kanzlerin
Peer Lorenzen
Präsident
Weitere Auskünfte erteilen Ihnen gern:
 |
Dr. Martin Hensche Rechtsanwalt Fachanwalt für Arbeitsrecht Kontakt: 030 / 26 39 620 hensche@hensche.de |
 |
Christoph Hildebrandt Rechtsanwalt Fachanwalt für Arbeitsrecht Kontakt: 030 / 26 39 620 hildebrandt@hensche.de |
 |
Nina Wesemann Rechtsanwältin Fachanwältin für Arbeitsrecht Kontakt: 040 / 69 20 68 04 wesemann@hensche.de |