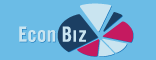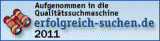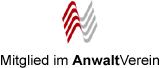- -> zur Mobil-Ansicht
- Arbeitsrecht aktuell
- Tipps und Tricks
- Handbuch Arbeitsrecht
- Gesetze zum Arbeitsrecht
- Urteile zum Arbeitsrecht
- Urteile 2023
- Urteile 2021
- Urteile 2020
- Urteile 2019
- Urteile 2018
- Urteile 2017
- Urteile 2016
- Urteile 2015
- Urteile 2014
- Urteile 2013
- Urteile 2012
- Urteile 2011
- Urteile 2010
- Urteile 2009
- Urteile 2008
- Urteile 2007
- Urteile 2006
- Urteile 2005
- Urteile 2004
- Urteile 2003
- Urteile 2002
- Urteile 2001
- Urteile 2000
- Urteile 1999
- Urteile 1998
- Urteile 1997
- Urteile 1996
- Urteile 1995
- Urteile 1994
- Urteile 1993
- Urteile 1992
- Urteile 1991
- Urteile bis 1990
- Arbeitsrecht Muster
- Videos
- Impressum-Generator
- Webinare zum Arbeitsrecht
-
Kanzlei Berlin
 030 - 26 39 62 0
030 - 26 39 62 0
 berlin@hensche.de
berlin@hensche.de
AnfahrtDetails -
Kanzlei Frankfurt
 069 - 71 03 30 04
069 - 71 03 30 04
 frankfurt@hensche.de
frankfurt@hensche.de
AnfahrtDetails -
Kanzlei Hamburg
 040 - 69 20 68 04
040 - 69 20 68 04
 hamburg@hensche.de
hamburg@hensche.de
AnfahrtDetails -
Kanzlei Hannover
 0511 - 89 97 701
0511 - 89 97 701
 hannover@hensche.de
hannover@hensche.de
AnfahrtDetails -
Kanzlei Köln
 0221 - 70 90 718
0221 - 70 90 718
 koeln@hensche.de
koeln@hensche.de
AnfahrtDetails -
Kanzlei München
 089 - 21 56 88 63
089 - 21 56 88 63
 muenchen@hensche.de
muenchen@hensche.de
AnfahrtDetails -
Kanzlei Nürnberg
 0911 - 95 33 207
0911 - 95 33 207
 nuernberg@hensche.de
nuernberg@hensche.de
AnfahrtDetails -
Kanzlei Stuttgart
 0711 - 47 09 710
0711 - 47 09 710
 stuttgart@hensche.de
stuttgart@hensche.de
AnfahrtDetails
BAG, Urteil vom 06.09.2007, 2 AZR 722/06
| Schlagworte: | Kündigungsschutzklage | |
| Gericht: | Bundesarbeitsgericht | |
| Aktenzeichen: | 2 AZR 722/06 | |
| Typ: | Urteil | |
| Entscheidungsdatum: | 06.09.2007 | |
| Leitsätze: | Der ohne Gegenleistung erklärte, formularmäßige Verzicht des Arbeitnehmers auf die Erhebung einer Kündigungsschutzklage stellt eine unangemessene Benachteiligung iSv. § 307 Abs. 1 Satz 1 BGB dar. | |
| Vorinstanzen: | Arbeitsgericht Stuttgart, Urteil vom 21.06.2005, 8 Ca 263/04 Landesarbeitsgericht Baden-Württemberg, urteil vom 19.07.2006, 2 Sa 123/05 |
|
BUNDESARBEITSGERICHT
2 AZR 722/06
2 Sa 123/05
Landesarbeitsgericht
Baden-Württemberg
Im Namen des Volkes!
Verkündet am
6. September 2007
URTEIL
Schmidt, Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle
In Sachen
Beklagte, Berufungsbeklagte und Revisionsklägerin,
pp.
Klägerin, Berufungsklägerin und Revisionsbeklagte,
hat der Zweite Senat des Bundesarbeitsgerichts auf Grund der mündlichen Verhandlung vom 6. September 2007 durch den Vorsitzenden Richter am Bundesarbeitsgericht Prof. Dr. Rost, die Richter am Bundesarbeitsgericht Dr. Bröhl und Schmitz-Scholemann sowie die ehrenamtlichen Richter Dr. Sieg und Löllgen für Recht erkannt:
- 2 -
Die Revision der Beklagten gegen das Urteil des Landesarbeitsgerichts Baden-Württemberg vom 19. Juli 2006 - 2 Sa 123/05 - wird auf Kosten der Beklagten zurückgewiesen.
Von Rechts wegen!
Tatbestand
Die Parteien streiten über die Wirksamkeit zweier fristloser und einer hilfsweisen ordentlichen Kündigung.
Die Klägerin war seit 1998 bei dem beklagten Drogerieunternehmen als Verkäuferin/Kassiererin angestellt. Sie war zuletzt mit 10 Wochenstunden in einer Verkaufsstelle in D eingesetzt bei einer monatlichen Bruttovergütung iHv. 456,00 Euro.
Am 16. April 2004 wurde festgestellt, dass die Tageseinnahmen der Verkaufsstelle vom 14./15. April 2004 iHv. 4.375,00 Euro verschwunden waren. Der genaue Zeitpunkt konnte nicht ermittelt werden. Die Tageseinnahmen werden in einem Tresor verwahrt. Jede der drei Mitarbeiterinnen der Verkaufsstelle hat abwechselnd den Tresorschlüssel für einen gewissen Zeitraum im Besitz, die Klägerin zuletzt vom 15. April abends bis zum 16. April um 8.45 Uhr. Da trotz einer längeren Befragung der drei Mitarbeiterinnen der Tathergang nicht aufgeklärt werden konnte, kündigte die Beklagte die Arbeitsverhältnisse aller drei Mitarbeiterinnen am 16. April 2004 fristlos. Die Kündigung wurde gegenüber der Klägerin auf einem Formular ausgesprochen, das zusätzlich folgenden Passus enthält:
„Kündigung akzeptiert und mit Unterschrift bestätigt. Auf Klage gegen die Kündigung wird verzichtet.“
Die Klägerin unterzeichnete das Formular an der für den Mitarbeiter vorgesehenen Stelle. Darunter wurde es von der Beklagten durch die Verkaufs- und Bezirksleitung ebenfalls unterzeichnet. Mit Schreiben vom 19. April 2004 kündigte die Beklagte nochmals fristlos, hilfsweise ordentlich zum 31. Juli 2004.
Die Klägerin hat gegen alle Kündigungen Kündigungsschutzklage erhoben. Sie hat jegliche Verantwortung für das Verschwinden der Tageseinnahmen bestritten. Es liege auch kein hinreichender Verdacht vor. Die Kündigung vom 16. April 2004 sei
- 3 -
schon mangels ordnungsgemäßer Schriftform unwirksam, da die Unterschrift der kündigungsberechtigten Verkaufsleiterin nicht unmittelbar an die Kündigungserklärung anschließe. Der Klageverzicht verstoße im Übrigen gegen §§ 305 ff. BGB wegen unangemessener Benachteiligung. Schließlich hat die Klägerin den Verzicht auch gem. § 123 BGB wegen widerrechtlicher Drohung angefochten.
Die Klägerin hat - soweit von Interesse - zuletzt beantragt:
1. Es wird festgestellt, dass die fristlose Kündigung vom 16. April 2004, zugegangen am 16. April 2004, rechtsunwirksam ist.
2. Es wird festgestellt, dass die ordentliche Kündigung vom 19. April 2004, zugegangen am 23. April 2004, rechtsunwirksam ist.
3. Es wird festgestellt, dass die fristlose Kündigung vom 19. April 2004, zugegangen am 23. April 2004, rechtsunwirksam ist.
Die Beklagte hat Klageabweisung beantragt. Sie hat den Klageverzicht als wirksam angesehen. Eine unangemessene Benachteiligung gem. § 307 BGB liege nicht vor. Es sei auch keine unzulässige Drohung ausgesprochen worden. Jedenfalls liege ein hinreichender Grund für eine Verdachtskündigung vor. Es sei ihr nicht zuzumuten, mit den drei Mitarbeiterinnen, von denen eine die Gelder entwendet haben müsse, weiter zusammenzuarbeiten.
Das Arbeitsgericht hat die Klage wegen des Klageverzichts abgewiesen. Das Landesarbeitsgericht hat ihr auf die Berufung der Klägerin in vollem Umfang stattgegeben. Mit der vom Landesarbeitsgericht zugelassenen Revision erstrebt die Beklagte die Wiederherstellung des arbeitsgerichtlichen Urteils, während die Klägerin Zurückweisung der Revision beantragt.
Entscheidungsgründe
Die Revision der Beklagten ist unbegründet. Das Landesarbeitsgericht hat zu Recht erkannt, dass die Klage nicht wegen wirksamen Klageverzichts abzuweisen ist und die streitgegenständlichen Kündigungen vom 16. April 2004 und 19. April 2004 rechtsunwirksam sind.
- 4 -
A. Das Landesarbeitsgericht hat seine Entscheidungen - kurz zusammengefasst - wie folgt begründet: Der Klageverzicht bezüglich der Kündigung vom 16. April 2004 sei unwirksam, weil die formularmäßige Verzichtserklärung einer Inhaltskontrolle gem. § 307 Abs. 1 Satz 1 BGB unterliege und ohne kompensatorische Gegenleistung der Beklagten eine unangemessene Benachteiligung der Klägerin darstelle. Die Voraussetzungen einer begründeten - außerordentlichen wie ordentlichen - Verdachtskündigung seien gleichfalls nicht gegeben. Den Vortrag der Beklagten unterstellt, dass niemand sonst als die drei Mitarbeiterinnen einen Tresorschlüssel gehabt habe, bestehe für die Täterschaft der Klägerin lediglich ein Verdachtsgrad von 33,3 %. Dies rechtfertige eine Verdachtskündigung nicht.
B. Diesen Ausführungen folgt der Senat im Ergebnis und in weiten Teilen der Begründung. Die zulässige Kündigungsschutzklage ist begründet.
I. Das Landesarbeitsgericht hat durch Auslegung des Klageantrags unter Berücksichtigung der Klagebegründung zu Recht angenommen, dass es sich trotz der etwas missverständlichen Formulierung der Anträge in den Vorinstanzen lediglich um Kündigungsschutzanträge handelt.
II. Die Klage ist auch begründet. Die Klägerin hat auf ihr Recht, eine Kündigungsschutzklage gegen die Kündigung vom 16. April 2004 zu erheben, nicht wirksam verzichtet. Zu Recht hat das Landesarbeitsgericht ebenfalls angenommen, dass die Kündigung vom 16. April 2004 den Anforderungen an eine außerordentliche Verdachtskündigung nicht genügt.
1. Das Landesarbeitsgericht hat zutreffend erkannt, dass die Klägerin auf ihr Recht, eine Kündigungsschutzklage gegen die Kündigung vom 16. April 2004 zu erheben, nicht wirksam verzichtet hat. Zwar ist der Verzicht auf die Erhebung einer Kündigungsschutzklage nach Ausspruch der Kündigung zulässig. Das Landesarbeitsgericht hat die Vereinbarung auch zutreffend als formgerechten Klageverzichtsvertrag angesehen. Dieser Klageverzichtsvertrag benachteiligt die Klägerin aber iSv. § 307 Abs. 1 BGB unangemessen und ist deshalb unwirksam.
a) Nach der Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts (grundlegend Senat 3. Mai 1979 - 2 AZR 679/77 - BAGE 32, 6, zu II 2 a der Gründe) und der überwiegenden Auffassung in der Literatur (v. Hoyningen-Huene/Linck KSchG 14. Aufl. § 1 Rn. 15 ff.; KR-Friedrich 8. Aufl. § 4 KSchG Rn. 297; Stahlhacke/Preis/Vossen-Preis
- 5 -
Kündigung und Kündigungsschutz im Arbeitsverhältnis 9. Aufl. Rn. 1253) kann ein Arbeitnehmer nach Ausspruch der Kündigung durch den Arbeitgeber auf die Erhebung oder Durchführung einer Kündigungsschutzklage verzichten.
Die Zulässigkeit eines solchen Verzichts ergibt sich bereits daraus, dass das Kündigungsschutzgesetz im Gegensatz zu anderen Gesetzen, die einen Verzicht auf bestimmte Rechte für unzulässig erklären (vgl. § 4 Abs. 4 TVG, § 13 Abs. 1 Satz 3 BUrlG, § 12 EFZG, § 77 Abs. 4 BetrVG), keine Regelung getroffen hat, die dem Arbeitnehmer den Verzicht auf den Kündigungsschutz untersagt. Hinzu kommt, dass der Arbeitnehmer aus Rechtsgründen nicht gehalten ist, eine ihm ausgesprochene schriftliche Kündigung mit der Kündigungsschutzklage anzugreifen, sondern untätig bleiben und die Kündigung hinnehmen kann mit der Folge, dass diese wirksam wird (§ 7 KSchG). Vor allem ist der Arbeitnehmer berechtigt, sein Arbeitsverhältnis jederzeit durch Aufhebungsvertrag zu beenden (Senat 3. Mai 1979 - 2 AZR 679/77 - BAGE 32, 6, zu II 2 a der Gründe; 19. April 2007 - 2 AZR 208/06 -, zu B I 2 a der Gründe).
b) Die Vereinbarung „Kündigung akzeptiert und mit Unterschrift bestätigt, auf Klage gegen die Kündigung wird verzichtet“ im Kündigungsschreiben vom 16. April 2004 stellt eine Allgemeine Geschäftsbedingung iSv. § 305 Abs. 1 BGB dar.
Nach § 305 Abs. 1 BGB sind Allgemeine Geschäftsbedingungen alle für eine Vielzahl von Verträgen vorformulierten Vertragsbedingungen, die eine Vertragspartei (Verwender) der anderen Vertragspartei bei Abschluss des Vertrags stellt. Aus dem Inhalt und der äußeren Gestaltung der in einem Vertrag verwendeten Bedingungen kann sich ein vom Verwender zu widerlegender Anschein dafür ergeben, dass sie zur Mehrfachverwendung formuliert worden sind (BGH 24. November 2005 - VII ZR 87/04 - WM 2006, 247, zu II 2 a aa der Gründe). Vertragsbedingungen sind für eine Vielzahl von Verträgen bereits dann vorformuliert, wenn ihre dreimalige Verwendung beabsichtigt ist (BAG 1. März 2006 - 5 AZR 363/05 - BAGE 117, 155, zu II 2 a der Gründe; BGH 11. Dezember 2003 - VII ZR 31/03 - NJW 2004, 1454, zu II 1 a der Gründe).
Allgemeine Geschäftsbedingungen liegen nach § 305 Abs. 1 Satz 3 BGB nicht vor, soweit die Vertragsbedingungen zwischen den Vertragsparteien im Einzelnen ausgehandelt sind. „Aushandeln“ iSv. § 305 Abs. 1 Satz 3 BGB bedeutet mehr als verhandeln. Es genügt nicht, dass der Vertragsinhalt lediglich erläutert oder erörtert wird und den Vorstellungen des Vertragspartners entspricht. „Ausgehandelt“ iSv. § 305 Abs. 1 Satz 3 BGB ist eine Vertragsbedingung nur, wenn der Verwender die be-
- 6 -
treffende Klausel inhaltlich ernsthaft zur Disposition stellt und dem Verhandlungspartner Gestaltungsfreiheit zur Wahrung eigener Interessen einräumt mit der realen Möglichkeit, die inhaltliche Ausgestaltung der Vertragsbedingungen zu beeinflussen. Das setzt voraus, dass sich der Verwender deutlich und ernsthaft zu gewünschten Änderungen der zu treffenden Vereinbarung bereit erklärt (BAG 27. Juli 2005 - 7 AZR 486/04 - BAGE 115, 274, zu B II 1 b bb (2) der Gründe; zu § 310 Abs. 3 Nr. 2 BGB: 25. Mai 2005 - 5 AZR 572/04 - BAGE 115, 19, zu VII 2 der Gründe; BGH 3. November 1999 - VIII ZR 269/98 - BGHZ 143, 104, zu II 2 b aa der Gründe).
Gemessen hieran, stellt der von der Beklagten verwandte Passus eine Allgemeine Geschäftsbedingung iSv. § 305 Abs. 1 BGB dar. Bereits die äußere Erscheinungsform begründet eine tatsächliche Vermutung dafür, dass der Passus von der Beklagten vorformuliert und seine Verwendung erkennbar für eine Vielzahl von Fällen vorgesehen war und von der Beklagten bei Ausspruch von außerordentlichen Kündigungen generell genutzt wird.
Soweit die Revision unter Berufung auf das Urteil des Senats vom 27. November 2003 (- 2 AZR 135/03 - BAGE 109, 22, zu B IV 1 der Gründe) die Auffassung vertritt, es lägen keine Allgemeinen Geschäftsbedingungen vor, weil die Klägerin und die für die Beklagte handelnde stellvertretende Verkaufsleiterin den Klageverzicht individuell ausgehandelt hätten, überzeugt dies nicht. Zum einen handelt es sich bei den Ausführungen in der Revisionsbegründung um neuen, in der Revisionsinstanz grundsätzlich unzulässigen Sachvortrag. Selbst bei Berücksichtigung des von der Beklagten gehaltenen neuen Sachvortrags ergäbe sich kein anderes Ergebnis. Die Beklagte beschränkt sich darauf darzulegen, dass der Klägerin die Tragweite der Unterschrift deutlich vor Augen geführt wurde. Dass die Klägerin bestimmenden Einfluss auf die inhaltliche Ausgestaltung der Vertragsklausel hatte, trägt die Beklagte selbst nicht vor.
c) Die Vereinbarung „Kündigung akzeptiert und mit Unterschrift bestätigt, auf Klage gegen die Kündigung wird verzichtet“ ist Vertragsbestandteil geworden. Dem steht § 305c Abs. 1 BGB nicht entgegen.
Nach § 305c Abs. 1 BGB werden Bestimmungen in Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die nach den Umständen, insbesondere nach dem äußeren Erscheinungsbild des Vertrags so ungewöhnlich sind, dass der Vertragspartner des Verwenders mit ihnen nicht zu rechnen braucht, nicht Vertragsbestandteil. Weder erforderlich noch genügend ist es, wenn eine Bestimmung inhaltlich unbillig ist (Ulmer in
- 7 -
Ulmer/Brandner/Hensen AGB-Recht 10. Aufl. § 305c BGB Rn. 12). Das Überraschungsmoment kann sich auch aus dem ungewöhnlichen äußeren Zuschnitt einer Klausel oder ihrer Unterbringung an unerwarteter Stelle ergeben (BAG 31. August 2005 - 5 AZR 545/04 - BAGE 115, 372, zu I 5 b bb (1) der Gründe; 15. Februar 2007 - 6 AZR 286/06 - AP BGB § 620 Aufhebungsvertrag Nr. 35 = EzA BGB 2002 § 611 Aufhebungsvertrag Nr. 6, zu II 1 der Gründe).
Diese Voraussetzungen können hier nicht angenommen werden, denn nach dem Erscheinungsbild der Kündigung und der in ihr auch enthaltenen Klageverzichtsvereinbarung stellt diese keine Überraschungsklausel dar. Der Passus ist vom übrigen Text deutlich abgesetzt und enthält erkennbar eine eigenständige Regelung. Dies wird dadurch unterstrichen, dass nicht auch noch der Erhalt der Kündigung als solcher bestätigt werden soll, sondern vielmehr erklärt wird, die Kündigung werde akzeptiert, dies werde mit der Unterschrift bestätigt und auf eine Klage gegen die Kündigung werde verzichtet.
Entgegen der Auffassung der Revision steht einer Anwendung des Rechts der Allgemeinen Geschäftsbedingungen nach §§ 305 ff. BGB vorliegend auch die Regelung des § 310 Abs. 4 Satz 2 BGB nicht entgegen. Die Revision legt nicht dar, welche Besonderheiten des Arbeitsrechts ihrer Auffassung nach einer Anwendung der §§ 305 ff. BGB auf den formularmäßigen Klageverzichtsvertrag entgegenstehen sollen. Solche sind auch nicht erkennbar. Die pauschal und inhaltsleer ohne Begründung angeführten Schlagworte der Rechtssicherheit und Rechtsklarheit helfen nicht weiter. Dem Arbeitgeberinteresse nach alsbaldiger Rechtssicherheit und Rechtsklarheit ist bereits durch die Einführung der generellen Drei-Wochen-Frist des § 4 Satz 1 KSchG Rechnung getragen. Es ist nicht zu verkennen, dass der Arbeitgeber auch schon vorher ein Interesse daran haben kann zu wissen, ob die Kündigung das Arbeitsverhältnis rechtswirksam beenden wird, wozu auch ein Klageverzicht dienen kann. Eine Besonderheit des Arbeitsrechts, die bei der Anwendung der §§ 305 ff. BGB zu berück-sichtigen ist, liegt darin jedoch nicht. Die Revision möchte letztlich den unzutreffenden Anschein erwecken, das Landesarbeitsgericht hätte einen Klageverzicht nach Ausspruch der Kündigung generell für unwirksam angesehen.
d) Die Auslegung des Landesarbeitsgerichts, die Vereinbarung „Kündigung akzeptiert und mit Unterschrift bestätigt, auf Klage gegen die Kündigung wird verzichtet“ stelle einen Klageverzichtsvertrag dar, ist zutreffend und begegnet keinen rechtlichen Bedenken.
- 8 -
Das Revisionsgericht hat die Auslegung Allgemeiner Geschäftsbedingungen selbständig nach den Grundsätzen der Auslegung von Normen vorzunehmen. All-gemeine Geschäftsbedingungen sind nach ihrem objektiven Inhalt und typischen Sinn einheitlich so auszulegen, wie sie von verständigen und redlichen Vertragspartnern unter Abwägung der Interessen der normalerweise beteiligten Verkehrskreise verstanden werden, wobei die Verständnismöglichkeiten des durchschnittlichen Vertragspartners des Verwenders zugrunde zu legen sind (BAG 31. August 2005 - 5 AZR 545/04 - BAGE 115, 372, zu II 2 b der Gründe; 9. November 2005 - 5 AZR 128/05 - BAGE 116, 185, zu II 2 a der Gründe; BGH 21. September 2005 - VIII ZR 284/04 - NJW 2005, 3567, zu II 1 a aa der Gründe mwN).
Die Erklärung, auf Kündigungsschutz zu verzichten, kann je nach Lage des Falls ein Aufhebungsvertrag, ein Vergleich, ein Klageverzichtsvertrag oder ein vertragliches Klagerücknahmeversprechen sein, sofern eine Kündigungsschutzklage bereits rechtshängig ist (Stahlhacke/Preis/Vossen-Preis Kündigung und Kündigungsschutz im Arbeitsverhältnis 9. Aufl. Rn. 1254). Die Erklärung „Kündigung akzeptiert und mit Unterschrift bestätigt, auf Klage gegen die Kündigung wird verzichtet“ stellt hier einen Klageverzichtsvertrag dar, denn mit dieser Vereinbarung sollte die Klägerin vertraglich verpflichtet sein, gegen die ihr gegenüber mit gleichem Schreiben erklärte außerordentliche Kündigung des Arbeitsverhältnisses keine Kündigungsschutzklage zu erheben, sondern auf deren Erhebung zu verzichten und die Beklagte wollte diesen Verzicht auch annehmen. Die Formularerklärung stellte demgegenüber keinen Aufhebungsvertrag dar. Die vertragliche Regelung sollte nicht selbständig zur Beendigung des Arbeitsverhältnisses der Parteien führen, sondern „lediglich“ die Rechtswirksamkeit der Kündigung außer Streit stellen. Für die Annahme eines eigenständigen Beendigungstatbestandes bestehen auf Grundlage der Feststellungen des Landesarbeitsgerichts keine Anhaltspunkte (vgl. zu einer solchen Konstellation etwa Senat 19. April 2007 - 2 AZR 208/06 -).
e) Der nach Zugang der Kündigungserklärung der Beklagten von der Klägerin erklärte Verzicht auf die Erhebung einer Klage gegen die Kündigung ist unwirksam. Der formularmäßige Verzicht auf eine Kündigungsschutzklage hält nach Inkrafttreten des Gesetzes zur Modernisierung des Schuldrechts am 1. Januar 2002 und der dadurch erfolgten Einbeziehung des Arbeitsrechts in die AGB-Kontrolle einer Inhaltskontrolle nach § 307 Abs. 1 Satz 1 BGB nicht stand. Ohne kompensatorische Gegen-
- 9 -
leistung des Arbeitgebers stellt ein solcher Klageverzicht eine unangemessene Benachteiligung des Arbeitnehmers dar.
aa) Nach § 307 Abs. 3 Satz 1 BGB gelten § 307 Abs. 1 und 2 sowie §§ 308 und 309 BGB nur für Bestimmungen in Allgemeinen Geschäftsbedingungen, durch die von Rechtsvorschriften abweichende oder diese ergänzende Regelungen vereinbart werden. Der von der Klägerin erklärte Verzicht auf die Erhebung einer Kündigungsschutzklage stellt eine Bestimmung dar, durch die von der gesetzlichen Regelung Abweichendes vereinbart wird.
Nach § 4 Satz 1 KSchG muss ein Arbeitnehmer, der geltend machen will, dass eine Kündigung sozial ungerechtfertigt oder aus anderen Gründen rechtsunwirksam ist, innerhalb von drei Wochen nach Zugang der schriftlichen Kündigung Klage beim Arbeitsgericht auf Feststellung erheben, dass das Arbeitsverhältnis durch die Kündigung nicht aufgelöst worden ist. Nach § 13 Abs. 1 Satz 2 KSchG kann die Rechtswirksamkeit einer außerordentlichen Kündigung nur nach Maßgabe des § 4 Satz 1 KSchG und §§ 5 bis 7 KSchG geltend gemacht werden.
Der von der Klägerin erklärte Verzicht, eine Klage gegen die Kündigung vom 16. April 2004 zu erheben, weicht von der gesetzlichen Regelung des § 4 Satz 1 KSchG und § 13 Abs. 1 Satz 2 KSchG ab, indem der Klägerin die Drei-Wochen-Frist vollständig genommen wird.
bb) Nach § 307 Abs. 1 Satz 1 BGB sind Bestimmungen in Allgemeinen Geschäftsbedingungen unwirksam, wenn sie den Vertragspartner entgegen Treu und Glauben unangemessen benachteiligen. Eine formularmäßige Vertragsbestimmung ist unangemessen, wenn der Verwender durch einseitige Vertragsgestaltung missbräuchlich eigene Interessen auf Kosten seines Vertragspartners durchzusetzen versucht, ohne auch dessen Belange hinreichend zu berücksichtigen und ihm einen an-gemessenen Ausgleich zu gewähren. Die typischen Interessen der Vertragspartner sind unter besonderer Berücksichtigung grundrechtlich geschützter Rechtspositionen wechselseitig zu bewerten. Die Unangemessenheit richtet sich nach einem generellen typisierenden, vom Einzelfall losgelösten Maßstab unter Berücksichtigung von Gegen-stand, Zweck und Eigenart des jeweiligen Geschäfts innerhalb der beteiligten Verkehrskreise (BAG 10. Januar 2007 - 5 AZR 84/06 - AP BGB § 611 Ruhen des Arbeitsverhältnisses Nr. 6 = EzA BGB 2002 § 307 Nr. 16, zu I 2 c cc (1) der Gründe; 11. April 2006 - 9 AZR 557/05 - AP BGB § 307 Nr. 17 = EzA BGB 2002 § 308 Nr. 5, zu
- 10 -
A I 2 b bb (2.1) der Gründe mwN). Eine unangemessene Benachteiligung ist im Zweifel anzunehmen, wenn eine Bestimmung mit wesentlichen Grundgedanken der gesetzlichen Regelung, von der abgewichen wird, nicht zu vereinbaren ist oder wesentliche Rechte oder Pflichten, die sich aus der Natur des Vertrags ergeben, so einschränkt, dass die Erreichung des Vertragszwecks gefährdet ist (§ 307 Abs. 2 BGB).
cc) Gemessen hieran stellt der formularmäßige Verzicht auf die Erhebung einer Kündigungsschutzklage ohne Gegenleistung eine unangemessene Benachteiligung iSv. § 307 Abs. 1 Satz 1 BGB dar.
Ein formularmäßiger Verzicht auf eine Kündigungsschutzklage ist nach § 307 Abs. 1 Satz 1 BGB voll überprüfbar (ErfK/Preis 7. Aufl. §§ 305 - 310 BGB Rn. 74b). Es handelt sich bei dem Klageverzicht nicht um die Hauptabrede eines selbständigen Vertrags, die nach § 307 Abs. 1 Satz 2 BGB nur auf Transparenz kontrollierbar wäre (vgl. Senat 27. November 2003 - 2 AZR 135/03 - BAGE 109, 22). Der bloße Verzicht des Arbeitnehmers auf eine Kündigungsschutzklage ohne kompensatorische Gegenleistung stellt lediglich eine Nebenabrede zu dem ursprünglichen Arbeitsvertrag dar, nicht aber die Hauptleistung aus einem gesondert abgeschlossenen Vertrag.
Die unangemessene Benachteiligung ist allerdings nicht schon nach § 307 Abs. 2 Nr. 1 BGB im Zweifel zu vermuten. Es kann nicht angenommen werden, dass ein Klageverzicht nach Zugang einer Kündigung als solcher mit wesentlichen Grundgedanken des Kündigungsschutzgesetzes nicht zu vereinbaren ist, denn nach der Rechtsprechung des Senats ist ein Verzicht auf die Erhebung einer Kündigungs-schutzklage gerade auch während des Ablaufs der Drei-Wochen-Frist des § 4 Satz 1 KSchG zulässig (3. Mai 1979 - 2 AZR 679/77 - BAGE 32, 6, zu II 2 a der Gründe; 19. April 2007 - 2 AZR 208/06 -, zu B I 2 b der Gründe).
Die unangemessene Benachteiligung des Arbeitnehmers, der formularmäßig auf die Erhebung einer Kündigungsschutzklage verzichtet, liegt aber in dem Versuch des Arbeitgebers, seine Rechtsposition ohne Rücksicht auf die Interessen des Arbeitnehmers zu verbessern, indem er dem Arbeitnehmer die Möglichkeit einer gerichtlichen Überprüfung der Kündigung entzieht. Die Belange des Arbeitnehmers werden nicht ausreichend berücksichtigt, da diesem durch den Verzicht ohne jede Gegenleistung das Recht einer gerichtlichen Überprüfung der Kündigung genommen wird. In diesem Zusammenhang kann nicht unberücksichtigt bleiben, dass im Rahmen der arbeitgeberseitig veranlassten Beendigung von Arbeitsverhältnissen auch der Grundrechtsschutz des Arbeitnehmers aus Art. 12 Abs. 1 GG nicht leerlaufen darf. Ohne eine
- 11 -
Kompensation für den Verzicht auf den eigentlich bestehenden gesetzlichen Kündigungsschutz benachteiligt der Klageverzicht den Arbeitnehmer regelmäßig unangemessen iSv. § 307 Abs. 1 Satz 1 BGB. Der reine Klageverzicht ohne jede arbeitgeberseitige Kompensation (etwa in Bezug auf den Beendigungszeitpunkt, die Beendigungsart, Zahlung einer Entlassungsentschädigung, Verzicht auf eigene Ersatzansprüche, etc.) ist unangemessen (so auch APS/Dörner 3. Aufl. § 1 KSchG Rn. 15; ErfK/Preis §§ 305 - 310 BGB Rn. 74b; v. Hoyningen-Huene/Linck § 1 Rn. 35; HWK/ Quecke 2. Aufl. Vor § 1 KSchG Rn. 29; KR-Friedrich § 4 KSchG Rn. 311a; Reinecke DB 2002, 583 [586]; Stahlhacke/Preis/Vossen-Preis Rn. 1255; LAG Schleswig-Holstein 24. September 2003 - 3 Sa 6/03 - NZA-RR 2004, 74, zu III 2 b der Gründe; LAG Hamburg 29. April 2004 - 1 Sa 47/03 - NZA-RR 2005, 151, zu 3 der Gründe).
Mit einem Verzicht begibt sich der gekündigte Arbeitnehmer jeder Möglichkeit, die Rechtswirksamkeit der Beendigung seines Arbeitsverhältnisses durch die Arbeitgeberkündigung gerichtlich überprüfen zu lassen. Die Beendigung des Arbeitsverhältnisses zu dem in der Kündigung genannten Zeitpunkt steht damit fest. Der Arbeitgeber demgegenüber, der ein besonderes Interesse an der baldigen Herbeiführung von Rechtssicherheit hinsichtlich der von ihm ausgesprochenen Kündigung hat, muss bei einem innerhalb der Drei-Wochen-Frist des § 4 Satz 1 KSchG erklärten Klageverzicht den Ablauf der Klagefrist nicht mehr abwarten, sondern kann bereits zuvor davon ausgehen, dass seine Kündigung das Arbeitsverhältnis rechtswirksam beendet hat bzw. beenden wird. Durch den wirksam erklärten Klageverzicht kann er seine weiteren Dispositionen treffen, ohne die Unsicherheit hinsichtlich der Wirksamkeit seiner Kündigung am Ende eines möglicherweise langjährigen Prozesses zu fürchten.
2. Soweit das Landesarbeitsgericht angenommen hat, die Kündigung vom 16. April 2004 ermangele unter dem Gesichtspunkt der außerordentlichen Verdachtskündigung eines wichtigen Grundes, ist die Entscheidung des Landesarbeitsgerichts ebenfalls nicht zu beanstanden.
a) Gem. § 626 Abs. 1 BGB kann das Arbeitsverhältnis aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist gekündigt werden, wenn Tatsachen vorliegen, auf Grund derer dem Kündigenden unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls und unter Abwägung der Interessen beider Vertragsteile die Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses bis zum Ablauf der Kündigungsfrist nicht zugemutet werden kann. Da der in § 626 Abs. 1 BGB verwandte Begriff des wichtigen Grundes ein unbestimmter Rechtsbegriff ist, kann seine Anwendung durch die Tatsachengerichte im Revisions-
- 12 -
verfahren nur darauf überprüft werden, ob das Berufungsgericht den Rechtsbegriff selbst verkannt hat, ob es bei der Unterordnung des Sachverhalts unter die Rechtsnormen Denkgesetze oder allgemeine Erfahrungssätze verletzt und ob es alle vernünftigerweise in Betracht kommenden Umstände, die für oder gegen die außerordentliche Kündigung sprechen, widerspruchsfrei beachtet hat (ständige Rechtsprechung, statt vieler: Senat 21. Juni 1995 - 2 ABR 28/94 - BAGE 80, 185, zu B II 1 der Gründe; 20. August 1997 - 2 AZR 620/96 - AP BGB § 626 Verdacht strafbarer Handlung Nr. 27 = EzA BGB § 626 Verdacht strafbarer Handlung Nr. 7, zu II 1 d der Gründe). Diesem eingeschränkten Prüfungsmaßstab hält die angefochtene Entscheidung des Landesarbeitsgerichts stand.
b) Nach der ständigen Senatsrechtsprechung, von der auch das Landesarbeitsgericht ausgeht, kann nicht nur eine erwiesene Vertragsverletzung, sondern schon der schwerwiegende Verdacht einer strafbaren oder sonstigen Verfehlung einen wichtigen Grund zur außerordentlichen Kündigung gegenüber dem verdächtigten Arbeitnehmer darstellen. § 626 Abs. 1 BGB lässt eine Verdachtskündigung dann zu, wenn starke Verdachtsmomente auf objektive Tatsachen gründen, wenn die Verdachtsmomente geeignet sind, das für die Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses erforderliche Vertrauen zu zerstören und wenn der Arbeitgeber alle zumutbaren Anstrengungen zur Aufklärung des Sachverhalts unternommen, insbesondere dem Arbeitnehmer Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben hat (vgl. etwa Senat 14. September 1994 - 2 AZR 164/94 - BAGE 78, 18; 5. April 2001 - 2 AZR 217/00 - AP BGB § 626 Verdacht strafbarer Handlung Nr. 34 = EzA BGB § 626 Verdacht strafbarer Handlung Nr. 10, zu II 1 der Gründe).
c) Unter Anwendung dieser Grundsätze ist das Landesarbeitsgericht zutreffend zu dem Ergebnis gelangt, dass die streitgegenständliche Kündigung nicht gerechtfertigt ist. Ein wichtiger Grund iSv. § 626 Abs. 1 BGB lag nicht vor. Entgegen der Auffassung der Revision hat das Landesarbeitsgericht bei seiner Würdigung nicht gegen Denkgesetze verstoßen.
Das Landesarbeitsgericht hat angenommen, die außerordentliche Kündigung vom 16. April 2004 sei wegen des Verdachts der Entwendung der Tageseinnahmen der Verkaufsstelle D vom 14. und 15. April 2004 in Höhe von insgesamt 4.375,00 Euro nicht gerechtfertigt; der von der Beklagten gehaltene Vortrag sei nicht ausreichend, einen starken oder gar dringenden Verdacht gegen die Klägerin wegen der Entwendung der Tageseinnahmen zu begründen. Da die Beklagte nicht von einer Mit-
- 13 -
täterschaft der drei Mitarbeiterinnen ausgehe, die im fraglichen Zeitraum über Zugriffsmöglichkeiten auf den Tresor verfügt hätten, sondern davon, dass eine der drei Mitarbeiterinnen allein für das Entwenden der Tageseinnahmen verantwortlich sei, bestehe für eine Täterschaft der Klägerin lediglich eine Wahrscheinlichkeit von einem Drittel. Der damit zu begründende Verdachtsgrad sei weder ein starker noch ein dringender.
Demgegenüber macht die Revision geltend, bei dem vorliegenden Sachverhalt stehe fest, dass entweder die Klägerin oder eine ihrer beiden Kolleginnen oder mehrere der drei Mitarbeiterinnen der Verkaufsstelle im Zusammenwirken die Tageseinnahmen vom 14. und 15. April 2004 unterschlagen hätten; damit sei bereits der vom Landesarbeitsgericht angenommene Wahrscheinlichkeitsgrad von einem Drittel fehlerhaft errechnet. Unabhängig davon bestehe aber ein konkreter, auf Tatsachen begründeter und erheblicher Verdacht, dass die Klägerin die Unterschlagung begangen habe. Es sei ihr nicht zuzumuten, mit drei Mitarbeiterinnen zusammenzuarbeiten, von denen sie sicher wisse, dass eine der drei Mitarbeiterinnen ein Vermögensdelikt zu ihrem Nachteil begangen habe. Dies zerstöre das Vertrauensverhältnis zu allen drei Mitarbeiterinnen.
Diese Einwendungen der Revision greifen nicht durch. Bereits der von der Revision gewählte Ansatz ist unzutreffend. Die Beklagte hat schon in ihrer Klageerwiderung erklärt, für sie sei nicht nachvollziehbar, wann das Geld abhanden gekommen sei und wem die Verantwortung dafür zuzuschreiben sei. Damit lag aus ihrer Sicht der Verdacht vor, dass entweder die Klägerin verantwortlich für den Verlust des Geldes zeichnete oder aber die anderen Mitarbeiterinnen, die an dem fraglichen Tagen Schlüsselgewalt hatten. Von einem möglichen Zusammenwirken der Klägerin mit anderen Mitarbeitern ging die Beklagte in den Vorinstanzen selbst nicht aus. Auf Grund welcher Tatsachen die Beklagte nunmehr auch die Möglichkeit einer gemeinschaftlichen Tatbegehung der drei Mitarbeiterinnen, ggf. in unterschiedlicher personeller Zusammensetzung in Betracht zieht, erschließt sich nicht. Dies erscheint eher dem Um-stand geschuldet, dass die Beklagte selbst erkennt, eine Wahrscheinlichkeit von einem Drittel für die Täterschaft der Klägerin bei damit gleichzeitig bestehender Wahrscheinlichkeit von zwei Dritteln für ihre Unschuld könne keinen starken und dringenden Verdacht begründen.
Ohnehin kann eine Verdachtskündigung aber nicht mit mathematischen Wahrscheinlichkeitsgraden und Berechnungen begründet werden. Erforderlich ist, wie
- 14 -
der Senat bereits mehrfach entschieden hat, der auf Tatsachen begründete dringende Verdacht einer Straftat. Die in den Vorinstanzen dafür vorgetragenen Umstände hat das Landesarbeitsgericht widerspruchsfrei gewertet und ist ohne Rechtsfehler zu dem Schluss gekommen, der Vortrag der Beklagten könne keinen hinreichend dringenden Verdacht gegen die Klägerin begründen.
III. Die außerordentliche Kündigung vom 19. April 2004 ist ebenfalls rechtsunwirksam. Insoweit kann auf die vorstehenden Ausführungen zur außerordentlichen Kündigung vom 16. April 2004 verwiesen werden. Zwar hat das Landesarbeitsgericht ausweislich der Entscheidungsgründe diese außerordentliche Kündigung nicht expressis verbis beschieden. Es ergibt sich aber eindeutig, dass das Landesarbeitsgericht auch hinsichtlich dieser Kündigung das Vorliegen eines wichtigen Grundes verneint hat. Hiervon geht offensichtlich auch die Revision aus.
IV. Zu Recht hat das Landesarbeitsgericht entschieden, dass auch die hilfsweise erklärte ordentlich Kündigung vom 19. April 2004 zum 31. Juli 2004 das Arbeitsverhältnis zwischen den Parteien nicht beendet hat. Diese Kündigung ist sozial ungerechtfertigt und damit rechtsunwirksam. Das Landesarbeitsgericht hat ohne erkennbare Rechtsfehler angenommen, der von der Beklagten vorgetragene Sachverhalt könne auch eine ordentliche Kündigung nicht rechtfertigen. Es kann auch insoweit auf die Ausführungen zur außerordentlichen Verdachtskündigung verwiesen werden.
V. Die Beklagte hat die Kosten der Revision gem. § 97 Abs. 1 ZPO zu tragen.
Rost
Bröhl
Schmitz-Scholemann
Sieg
F. Löllgen
Weitere Auskünfte erteilen Ihnen gern:
 |
Dr. Martin Hensche Rechtsanwalt Fachanwalt für Arbeitsrecht Kontakt: 030 / 26 39 620 hensche@hensche.de |
 |
Christoph Hildebrandt Rechtsanwalt Fachanwalt für Arbeitsrecht Kontakt: 030 / 26 39 620 hildebrandt@hensche.de |
 |
Nina Wesemann Rechtsanwältin Fachanwältin für Arbeitsrecht Kontakt: 040 / 69 20 68 04 wesemann@hensche.de |