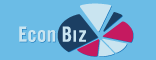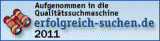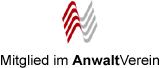- -> zur Mobil-Ansicht
- Arbeitsrecht aktuell
- Tipps und Tricks
- Handbuch Arbeitsrecht
- Gesetze zum Arbeitsrecht
- Urteile zum Arbeitsrecht
- Urteile 2023
- Urteile 2021
- Urteile 2020
- Urteile 2019
- Urteile 2018
- Urteile 2017
- Urteile 2016
- Urteile 2015
- Urteile 2014
- Urteile 2013
- Urteile 2012
- Urteile 2011
- Urteile 2010
- Urteile 2009
- Urteile 2008
- Urteile 2007
- Urteile 2006
- Urteile 2005
- Urteile 2004
- Urteile 2003
- Urteile 2002
- Urteile 2001
- Urteile 2000
- Urteile 1999
- Urteile 1998
- Urteile 1997
- Urteile 1996
- Urteile 1995
- Urteile 1994
- Urteile 1993
- Urteile 1992
- Urteile 1991
- Urteile bis 1990
- Arbeitsrecht Muster
- Videos
- Impressum-Generator
- Webinare zum Arbeitsrecht
-
Kanzlei Berlin
 030 - 26 39 62 0
030 - 26 39 62 0
 berlin@hensche.de
berlin@hensche.de
AnfahrtDetails -
Kanzlei Frankfurt
 069 - 71 03 30 04
069 - 71 03 30 04
 frankfurt@hensche.de
frankfurt@hensche.de
AnfahrtDetails -
Kanzlei Hamburg
 040 - 69 20 68 04
040 - 69 20 68 04
 hamburg@hensche.de
hamburg@hensche.de
AnfahrtDetails -
Kanzlei Hannover
 0511 - 89 97 701
0511 - 89 97 701
 hannover@hensche.de
hannover@hensche.de
AnfahrtDetails -
Kanzlei Köln
 0221 - 70 90 718
0221 - 70 90 718
 koeln@hensche.de
koeln@hensche.de
AnfahrtDetails -
Kanzlei München
 089 - 21 56 88 63
089 - 21 56 88 63
 muenchen@hensche.de
muenchen@hensche.de
AnfahrtDetails -
Kanzlei Nürnberg
 0911 - 95 33 207
0911 - 95 33 207
 nuernberg@hensche.de
nuernberg@hensche.de
AnfahrtDetails -
Kanzlei Stuttgart
 0711 - 47 09 710
0711 - 47 09 710
 stuttgart@hensche.de
stuttgart@hensche.de
AnfahrtDetails
LAG Schleswig-Holstein, Urteil vom 14.09.2011, 3 Sa 241/11
| Schlagworte: | Schadensersatz, Haftpflichtversicherung | |
| Gericht: | Landesarbeitsgericht Schleswig-Holstein | |
| Aktenzeichen: | 3 Sa 241/11 | |
| Typ: | Urteil | |
| Entscheidungsdatum: | 14.09.2011 | |
| Leitsätze: | ||
| Vorinstanzen: | Arbeitsgericht Neumünster, Urteil vom 31.03.2011, 2 Ca 1492 c/10 | |
Landesarbeitsgericht Schleswig-Holstein
Aktenzeichen: 3 Sa 241/11
2 Ca 1492 c/10 ArbG Neumünster (Bitte bei allen Schreiben angeben!)
Verkündet am 14.09.2011
Gez. ...
als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle
Urteil
Im Namen des Volkes
In dem Rechtsstreit pp.
hat die 3. Kammer des Landesarbeitsgerichts Schleswig-Holstein auf die mündliche Verhandlung vom 14.09.2011 durch die Vizepräsidentin des Landesarbeitsgerichts ... als Vorsitzende und d. ehrenamtliche Richterin ... als Beisitzerin und d. ehrenamtlichen Richter ... als Beisitzer
für Recht erkannt:
- 2 -
Auf die Berufung des Beklagten wird das Urteil des Arbeitsgerichts Neumünster vom 31.03.2011 – 2 Ca 1492 c/10 – unter Zurückweisung der Berufung im Übrigen teilweise abgeändert und zur Klarstellung insgesamt wie folgt neu gefasst:
I. Der Beklagte wird verurteilt, an die Klägerin 2.885,-- EUR nebst Jahreszinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit dem 26. Oktober 2010 zu zahlen.
II. Es wird festgestellt, dass der Beklagte verpflichtet ist, der Klägerin jeglichen weitergehenden Schaden aus dem Unfallereignis vom 20. Juli 2010 bis zu einem Betrag aus I und II in Höhe von insgesamt 5.200,-- EUR zu ersetzen.
III. Im Übrigen wird die Klage abgewiesen.
IV. Von den Kosten erster Instanz trägt die Klägerin 83 %, der Beklagte 17 %.
Von den Kosten zweiter Instanz trägt die Klägerin 2/3, der Beklagte 1/3.
V. Die Revision wird nicht zugelassen.
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
Gegen dieses Urteil ist das Rechtsmittel der Revision nicht gegeben; im Übrigen wird auf § 72 a ArbGG verwiesen.
- 3 -
Tatbestand:
Die Parteien streiten um Schadensersatzansprüche aus einem Unfall vom 20. Juli 2010.
Die Klägerin betreibt eine Spedition.
Der jetzt 24-jährige Beklagte war knapp 4 Wochen für die Klägerin als Fahrer beschäftigt. Am 01.07.2010 nahm er seine Arbeit auf. Am 20.07.2010 verursachte er während der Arbeit mit dem ihm zur Verfügung gestellten Lastkraftwagen einen Verkehrsunfall. Infolge dessen beendete die Klägerin das Arbeitsverhältnis am 28.07.2010 fristlos.
Der Beklagte hat bei der Klägerin 1.300,00 EUR brutto monatlich verdient. Die Fahrerlaubnis zur Führung eines Lastkraftwagens besitzt er seit dem 23. Februar 2009.
Am 20. Juli 2010 verursachte der Beklagte mit einem Sattelzug der Klägerin, bestehend aus einer Zugmaschine und einem 14 Jahre alten Auflieger, einen Verkehrsunfall. Um ca. 14.00 Uhr dieses Tages fuhr er mit einer Geschwindigkeit von 93 km/h auf der Landstraße 2... (S...-H...-Straße/Ecke H... Weg) in eine Linkskurve. Zulässig war eine Geschwindigkeit von 60 km/h. Der Beklagte verlor die Kontrolle über den Sattelzug und kam von der Straße ab. Der Sattelzug stürzte um. Die Zugmaschine, der Auflieger, die transportierte Ware und das Grundstück, auf das der Sattelzug kippte, wurden beschädigt. Der Beklagte wurde leicht verletzt. Die Versicherung der Klägerin hat einen Großteil des Schadens reguliert, der Beklagte ein Bußgeld von 35,00 EUR bezahlt.
Der Sattelzug war vollkaskoversichert. Die Klägerin zahlte insoweit eine Selbstbeteiligung in Höhe von 1.000,00 EUR, deren Erstattung sie von dem Beklagten begehrt.
- 4 -
Der 14 Jahre alte Sattelauflieger war altersbedingt nicht mehr vollkaskoversichert. Die Haftpflichtversicherung hat Kosten für die Bergung des Aufliegers in Höhe von 3.175,00 EUR nicht übernommen. Deren Erstattung wird vom Beklagten begehrt.
An dem Sattelauflieger entstand Totalschaden. Dessen Restwert vor dem Unfall hat das Arbeitsgericht - von der Klägerin zweitinstanzlich nicht mehr beanstandet – auf 5.000,00 EUR geschätzt. Der beschädigte Auflieger ist einem Zirkus zur Verschrottung kostenlos übereignet worden. So hat die Klägerin Entsorgungskosten gespart. Auch die Erstattung dieses Restwertes begehrt die Klägerin von dem Beklagten.
Hinsichtlich der ansonsten versicherten Ware macht die Klägerin gegenüber dem Beklagten ihre Selbstbeteiligung in Höhe von 250,00 EUR geltend.
Des Weiteren begehrt die Klägerin Ersatz der für das Jahr 2010 zu erwartenden Malauszahlung – angegeben mit rund 7.600,00 EUR – sowie des Höherstufungsschadens in der Haftpflichtversicherung für das Jahr 2011 – angegeben mit rund 4.200,00 EUR. Beides war zum Zeitpunkt der Berufungsverhandlung noch nicht fällig gestellt.
Die Klägerin hat stets die Ansicht vertreten, der Beklagte habe grob fahrlässig gehandelt, weil der Beklagte das Fahrzeug mit Maximalgeschwindigkeit in der Kurve gefahren hat. Allein deshalb sei der Sattelzug umgestürzt. Er habe den vollen Schaden zu ersetzen.
Die Klägerin hat beantragt,
1. den Beklagten zu verurteilen, an die Klägerin 29.689,42 EUR nebst Jahreszinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz gemäß § 247 BGB seit dem 26. Oktober 2010 zu zahlen und
2. festzustellen, dass der Beklagte verpflichtet ist, der Klägerin jeglichen weitergehenden Schaden aus dem Unfallereignis vom 20. Juli 2010 zu ersetzen.
- 5 -
Der Beklagte hat beantragt,
die Klage abzuweisen.
Er hat stets vertreten, die überhöhte Geschwindigkeit sei nicht Ursache des Abkommens des LKWs von der Fahrbahn in der Linkskurve gewesen. Er sei mit geöffnetem Fenster gefahren. Durch einen Windstoß seien die auf dem Armaturenbrett liegenden Papiere aufgewirbelt worden und in sein Sichtfeld geraten. Bei dem Versuch, sie einzufangen, sei er von der Fahrbahn abgekommen.
Das Arbeitsgericht hat dem Zahlungsbegehren in Höhe von 9.425,00 EUR stattgegeben und darüber hinaus festgestellt, dass der Beklagte der Klägerin in Bezug auf noch nicht fällige weitere Schäden zu weiterem Schadensersatz bis zu einem Gesamtbetrag in Höhe von insgesamt 15.600,00 EUR (12 Monatsgehälter) verpflichtet sei. Der Beklagte habe den Verkehrsunfall grob fahrlässig verursacht. Gleichwohl ergebe sich eine Schadensbegrenzung unter Abwägung der Gesamtumstände auf die Höhe eines Jahresverdienstes. Der Beklagte habe daher die Kosten der Selbstbeteiligungen in Höhe von 1.000,00 EUR sowie weiterer 250,00 EUR zu zahlen. Ferner müsse er die Bergungskosten mit 3.175,00 EUR sowie den Restwert des Aufliegers mit 5.000,00 EUR erstatten. Eine Malauszahlung für 2010 und der Höherstufungsschaden für 2011 seien mangels Fälligkeit vom Feststellungsantrag erfasst. Der Schadensersatzanspruch sei jedoch insgesamt aufgrund des innerbetrieblichen Schadensausgleichs auf maximal 1 Jahreseinkommen des Beklagten, damit 15.600,00 EUR beschränkt.
Hinsichtlich der Einzelheiten wird auf Tatbestand, Anträge und Entscheidungsgründe des erstinstanzlichen Urteils vom 31.03.2011 verwiesen.
Gegen diese dem Beklagten am 18.05.2011 zugestellte Entscheidung hat er am 15.06.2011 unter Anerkennung eines Betrages in Höhe von 1.250,00 EUR Berufung eingelegt, die am 13.07.2011 begründet wurde.
- 6 -
Er ergänzt und vertieft im Wesentlichen sein erstinstanzliches Vorbringen. Er habe nicht grob fahrlässig den Schaden verursacht, sich vielmehr über einen etwaigen Schadenseintritt keinerlei Gedanken gemacht. In Bezug auf die Führung eines LKWs habe er kaum Fahrerfahrung gehabt. Die Belastung mit Bergungskosten in Höhe von 3.175,00 EUR sowie mit dem Restwert des Aufliegers vor dem Unfall mit 5.000,00 EUR könnten ihm nicht in Rechnung gestellt werden. Die Klägerin habe insoweit eine Vollkaskoversicherung abschließen müssen und durch den Nichtabschluss Versicherungsprämien erspart, was nun zu seinen Lasten gehe. Er könne nur in Anspruch genommen werden, wie für ein einheitliches Fahrzeug, da es sich um ein zwingend zusammenhängendes Fahrzeuggespann gehandelt habe. Für etwaige Höherstufungskosten hafte er bereits deshalb nicht, weil er auf die versicherungsrechtliche Ausgestaltung als Arbeitnehmer keinen Einfluss habe.
Der Beklagte beantragt,
unter Aufhebung des Urteils des Arbeitsgerichts Neumünster vom 31.03.2011 wird die Klage insoweit abgewiesen, als der Beklagte zu einem Betrag von mehr als 1.250,00 EUR nebst Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit dem 25.10.2010 verurteilt wurde.
Die Klägerin beantragt,
die Berufung zurückzuweisen.
Sie hält das angefochtene Urteil sowohl in tatsächlicher als auch in rechtlicher Hinsicht für zutreffend.
Hinsichtlich des weiteren Vorbringens wird auf den mündlich vorgetragenen Inhalt der gewechselten Schriftsätze nebst Anlagen verwiesen.
- 7 -
Entscheidungsgründe:
I. Die Berufung ist zulässig. Sie ist form- und fristgerecht eingelegt und innerhalb der Berufungsbegründungsfrist auch begründet worden. In der Sache hatte sie teilweise Erfolg. Unter Berücksichtigung der Leistungsfähigkeit des Beklagten, seines bei der Klägerin erzielten Arbeitsentgeltes, seiner Unerfahrenheit, des Grades des Verschuldens auch in Bezug auf den Schadenseintritt, aber auch der entstandenen Schadenshöhe bei der Klägerin, des diese treffenden Betriebsrisikos sowie der Möglichkeit einer Risikovorsorge war der Schadensausgleichsanspruch der Klägerin auf 4 Monatsverdienste zu beschränken.
1. Das Handeln des Beklagten war durch den Betrieb der Klägerin veranlasst. Es geschah aufgrund des Arbeitsverhältnisses zwischen den Parteien. Der Beklagte hat, wie von ihm arbeitsvertraglich geschuldet, einen Lastkraftwagen, bestehend aus Zugmaschine und Auflieger gefahren und im Auftrag der Klägerin Ware transportiert. Dabei hat er einen Verkehrsunfall verursacht.
2. Das betrieblich veranlasste Handeln des Beklagten ist nach den Grundsätzen über die beschränkte Arbeitnehmerhaftung zu beurteilen. Nach den vom Bundesarbeitsgericht entwickelten Grundsätzen hat ein Arbeitnehmer vorsätzlich verursachte Schäden in vollem Umfang zu tragen, bei leichtester Fahrlässigkeit haftet er dagegen nicht. Bei normaler Fahrlässigkeit ist der Schaden in aller Regel zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber zu verteilen, bei grober Fahrlässigkeit hat der Arbeitnehmer in aller Regel den gesamten Schaden zu tragen, jedoch können Haftungserleichterungen, die von einer Abwägung im Einzelfall abhängig sind, in Betracht kommen.
Die Beteiligung des Arbeitnehmers an den Schadensfolgen ist durch eine Abwägung der Gesamtumstände zu bestimmen, wobei insbesondere Schadensanlass, Schadensfolgen, Billigkeits- und Zumutbarkeitsgesichtspunkte eine Rolle spielen. Eine möglicherweise vorliegende Gefahrgeneigtheit der Arbeit ist ebenso zu berücksichtigen wie die Schadenshöhe, ein vom Arbeitgeber einkalkuliertes Risiko, eine Risikodeckung durch eine Versicherung, die Stellung des Arbeitnehmers im Betrieb und die
- 8 -
Höhe der Vergütung, die möglicherweise eine Risikoprämie enthalten kann. Auch die persönlichen Verhältnisse des Arbeitnehmers und die Umstände des Arbeitsverhältnisses, wie die Dauer der Betriebszugehörigkeit, das Lebensalter, die Familienverhältnisse und sein bisheriges Verhalten können zu berücksichtigen sein (BAG vom 28.10.2010 – 8 AZR 418/09 – zitiert nach Juris, Rz. 17 f).
Die Haftung ist mithin entscheidend davon abhängig, welcher Verschuldensgrad zur Last zu legen ist. Vorsatz ist dann zu bejahen, wenn der Arbeitnehmer den Schaden in seiner konkreten Höhe zumindest als möglich voraussieht und ihn für den Fall des Eintritts billigend in Kauf nimmt. Über die Erkenntnis der Möglichkeit des Eintritts eines Schaden stiftenden Erfolges hinaus ist erforderlich, dass der Schädiger den als möglich vorgestellten Erfolg auch in seinen Willen aufnimmt und mit ihm für den Fall seines Eintritts einverstanden ist. Dagegen handelt lediglich grob fahrlässig, wer die im Verkehr erforderliche Sorgfalt nach den gesamten Umständen in ungewöhnlich hohem Maße verletzt und unbeachtet lässt, was im gegebenen Fall jedem hätte einleuchten müssen. Im Gegensatz zum rein objektiven Maßstab bei einfacher Fahrlässigkeit sind bei grober Fahrlässigkeit auch subjektive Umstände zu berücksichtigen. Dazu gehört auch, ob die Gefahr erkennbar und der Erfolg vorhersehbar und vermeidbar war. Abzustellen ist auch darauf, ob der Schädigende nach seinen individuellen Fähigkeiten die objektiv gebotene Sorgfalt erkennen und erbringen konnte (BAG vom 18.04.2002 – 8 AZR 348/01 – zitiert nach Juris, Rz. 24 m. w. N). Zu berücksichtigen ist in diesem Zusammenhang auch, dass sich in Fällen der betrieblich veranlassten Arbeitnehmerhaftung das Verschulden nicht nur auf die Pflichtverletzung, sondern auch auf den Eintritt eines Schadens beziehen muss (BAG a.a.O., Rz. 27; Rz. 39 f.). Sinn und Zweck der beschränkten Arbeitnehmerhaftung gebieten es, das hohe Risiko der Schadensentstehung bei betrieblichen Tätigkeiten dem Schädiger nur dann aufzubürden, wenn er den Schaden selbst, also das den Arbeitgeber finanziell belastende Ereignis vorsätzlich oder (mit Einschränkung) grob fahrlässig herbeigeführt hat. Der Schädiger soll nur dann haften, wenn sein Verhalten gerade im Hinblick auf die Herbeiführung des Schadens zu missbilligen ist. Der an ihn zu richtende Vorwurf ist nicht ausreichend, wenn sich die Schuld nicht gerade auch auf den Eintritt des Schadens beziehen lässt (BAG a.a.O., Rz. 40 m. w. N.).
- 9 -
4. Vor diesem rechtlichen Hintergrund wertet die Berufungskammer das Verhalten des Beklagten hinsichtlich der Pflichtverletzung – mit dem Arbeitsgericht – als grob fahrlässig. Er ist mit stark überhöhter Geschwindigkeit in die Linkskurve gefahren und hat die vorgegebene Geschwindigkeitsbegrenzung von 60 km/h nicht beachtet. Es hätte ihm ohne weiteres einleuchten müssen, dass eine Geschwindigkeitsüberschreitung um 33 km/h gerade in einer Kurve zu einem Ausbrechen des Fahrzeuges führen kann. Das gilt umso mehr bei einem zweigliedrigen Fahrzeug, was der Beklagte, der erst seit 15 Monaten eine Fahrerlaubnis für Lastkraftwagen hatte, unter Umständen unterschätzt haben mag. Dass in einer Kurve die Kontrolle über ein Fahrzeug gerade bei zu hoher Geschwindigkeit verloren werden kann, wird in jeder Fahrschule gelehrt. Insoweit kann es dahinstehen, ob sich das vom Beklagten durch die Geschwindigkeitsüberhöhung eingegangene Unfallrisiko durch in der Führerkabine herumfliegende Zettel potenziert hat. Abgesehen davon, dass lose Zettel nicht auf die Ablagefläche gehören, weiß jeder, dass sie auch ohne Wind in einer Kurve hin und her rutschen. Die Gefahr, dass unkalkulierbare Ereignisse eintreten, Papiere umher rutschen oder fliegen potenziert sich, wenn das Fenster gleichzeitig geöffnet ist, die Geschwindigkeitsbegrenzung um ein Vielfaches überschritten wird und dann noch eine Kurve genommen werden muss. Angesichts dessen hätte der Beklagte bei dieser Fallkonstellation – die Richtigkeit seines Vorbringens zu seinen Gunsten unterstellt – unter jedem erdenklichen Gesichtspunkt die Geschwindigkeit vor Einfahren in die Linkskurve reduzieren müssen. Indem er dieses unterlassen hat, hat er eine grob fahrlässige Pflichtverletzung begangen.
Hinsichtlich des daraus resultierenden Schadenseintrittes spricht nach der Überzeugung der Kammer sehr viel dafür, dass der Beklagte sich insoweit auf der Grenze zwischen grober und mittlerer Fahrlässigkeit befunden hat. Er war relativ unerfahren und hat sich über die mögliche Ursachenkette zwischen Wind, Papieren, zweigliedrigem Fahrzeug und Geschwindigkeitsüberschreitung zu wenig Gedanken gemacht; dieses unterschätzt; nicht vorausschauend gehandelt.
5. Selbst grobe Fahrlässigkeit führt nicht zu einer uneingeschränkten Zuweisung des Haftungsrisikos für alle Schäden. Die Haftungsprivilegierung des Arbeitnehmers ver-
- 10 -
folgt gerade das Ziel, ihn vom Risiko hoher Schäden zu entlasten. Das geschieht nicht zuletzt deshalb, weil Schäden infolge von Tätigkeiten entstehen können, deren Schadensrisiko so hoch ist, dass der Arbeitnehmer typischerweise schon von seinem Arbeitsentgelt her nicht in der Lage ist, Risikovorsorge zu betreiben und einen eingetretenen Schaden zu ersetzen. Hier drückt sich das zu Lasten des Arbeitgebers ins Gewicht fallende Betriebsrisiko unter anderem darin aus, dass der im Schadensfall zu erwartende Vermögensverlust des Arbeitgebers in einem groben Missverhältnis zudem als Grundlage in Betracht kommenden Arbeitslohn steht (BAG vom 18.04.2002 – 8 AZR 348/01 – zitiert nach Juris, Rz. 36 m. w. N.). Auf Seiten des Arbeitnehmers ist insbesondere die Höhe des Arbeitsentgelts, die weiteren mit seiner Leistungsfähigkeit zusammenhängenden Umstände und der Grad des Verschuldens in die Abwägung einzubeziehen. Auf Seiten des Arbeitgebers wird ein durch das schädigende Ereignis eingetretener hoher Vermögensverlust umso mehr dem Betriebsrisiko zuzurechnen sein, als dieser einzukalkulieren oder durch Versicherungen ohne Rückgriffsmöglichkeit gegen den Arbeitnehmer abzudecken war (BAG vom 28.10.2010 – 8 AZR 418/09 – zitiert nach Juris, Rz. 25). Zwar ist ein Arbeitgeber nicht verpflichtet, das Unfallfahrzeug gegen Kaskoschäden zu versichern. Insoweit hat ein Arbeitnehmer auch keinen Anspruch darauf, ohne weiteres so gestellt zu werden, als ob eine Kaskoversicherung bestünde, es sei denn, dies wiederum sei besonders vereinbart. Der Arbeitnehmer ist insoweit durch die Haftungserleichterungen angemessen geschützt. Das kann dazu führen, dass sich der Arbeitgeber im Schadensfall entgegenhalten lassen muss, er habe sein Eigentum an dem Fahrzeug nicht durch den Abschluss einer Kaskoversicherung geschützt. Das ist dann anzunehmen, wenn die Abwägung aller für die Schadensteilung in Betracht kommenden Umstände ergibt, dass dem Arbeitnehmer auch die quotale Schadensbeteiligung nicht in voller Höhe zuzumuten ist (BAG vom 24.11.1987 – 8 AZR 66/82 – zitiert nach Juris, Rz. 21, 23, 24).
6. Unter Berücksichtigung all dieser Faktoren ergibt sich für den Beklagten folgende Schadensbeteiligung:
a. Er hat – wie auch von ihm angesichts der eingeschränkten Berufungseinlegung akzeptiert – die Selbstbeteiligungsbeträge bezüglich der Zugmaschine in Höhe von
- 11 -
1.000,00 EUR und bezüglich der versicherten Ware in Höhe von 250,00 EUR voll zu tragen.
b) In Bezug auf den Auflieger ist er mit 20 % an den durch den Verkehrsunfall verursachten Schäden zu beteiligen. Eine weitergehende Beteiligung seinerseits ist unverhältnismäßig. Der Beklagte war jung, unerfahren und hatte erst 15 Monate seine Fahrerlaubnis. Das wusste die Klägerin. Damit konnte zwangsläufig die ggfs. von einem 50-jährigen Berufskraftfahrer zu erwartende vorausschauende Fahrweise nicht erwartet werden. Die Klägerin hat dem Beklagten auch „nur“ eine Vergütung von 1.300,00 EUR brutto monatlich zugesagt. Sie hat in der Berufungsverhandlung hervorgehoben, dass Fahrer auch mehr verdienen können. Damit hat sie offensichtlich der Unerfahrenheit des Klägers Rechnung getragen und den Wert seiner Arbeitsleistung – noch – nicht höher eingestuft. Insoweit hat sie gespart. Gleichzeitig war ihr ein etwaiges erhöhtes Risiko aufgrund der Unerfahrenheit des Beklagten bekannt. Dem ist Rechnung zu tragen.
Der Beklagte ist einkommenslos. Selbst wenn er weiterhin ein monatliches Gehalt von 1.300,00 EUR hätte, steht das materielle Risiko, das sich für ihn durch diesen Unfall realisiert hat, in keinem Verhältnis zu seinen Einkommensverhältnissen, von denen er seinen Lebensunterhalt bestreiten muss. Er würde aufgrund eines einzigen Fehlers jahrzehntelang Schadensersatz leisten müssen.
Dem gegenüber ist zu berücksichtigen, dass die Klägerin ein Speditionsunternehmen betreibt. Es ist gerade ihr klassisches Betriebsrisiko, dass mit den in ihrem Eigentum stehenden Fahrzeugen Verkehrsunfälle herbeigeführt werden. Die ihren Arbeitnehmern zur Verfügung gestellten Fahrzeuge sind ihr „Betriebskapital“. Entsteht an diesem Betriebskapital ein Schaden, kann dieser nicht vollen Umfangs auf die Arbeitnehmer abgewälzt werden, anderenfalls wäre die Klägerin in der Lage, ihr volles Betriebsrisiko auf ihre Arbeitnehmer weiterzuleiten.
Die Klägerin hat sich dafür entschieden, den 14 Jahre alten Auflieger nicht mehr Vollkasko zu versichern. Hierdurch hat sie monatliche Prämien erspart. Insoweit ist sie das Risiko eingegangen, dass „sich das nicht rechnet“; ggfs. die ersparten Versi-
- 12 -
cherungsbeiträge unterhalb eines möglichen Schadens liegen könnten. Gegen dieses eingegangene Risiko konnte sich der Beklagte nicht versichern. Es ist dem Beklagten nicht zuzumuten, dass er für dieses Risiko vollends oder überwiegend in Anspruch genommen wird und dieses Risiko ausgleichen soll.
Die Klägerin betreibt ein Fuhrunternehmen. Insoweit geht sie eine hohe Gefahr ein, dass im Straßenverkehr ihre Fahrzeuge beschädigt werden.
Die Klägerin hat dem Beklagten ein zweiteiliges Fahrzeug zur Verfügung gestellt, von dem das eine vollkaskoversichert war, der Auflieger hingegen nicht. Durch die Tatsache, dass sie ältere Fahrzeuge nicht vollkaskoversichert, erhöht sie für den Arbeitnehmer von diesem nicht steuerbar das Haftungsrisiko. Er kann es nicht beeinflussen, ob ihm ein vollkaskoversichertes oder ein altes Fahrzeug ohne jegliche Kaskoversicherung zur Erbringung seiner Arbeitsleistung zur Verfügung gestellt wird. Das aufzufangen, ist ihm nicht zuzumuten.
Angesichts all dieser Kriterien sowie der Tatsache, dass der Beklagte lediglich 3 Wochen für die Klägerin gearbeitet hat, insgesamt noch nicht einmal eine volle Monatsvergütung in Höhe von 1.300,00 EUR bei ihr verdient hat und mit ursprünglich begehrten rund 30.000,00, EUR, nach erstinstanzlicher Verurteilung mehr als 15.000,00 EUR haften soll, ohne dass auf Seiten der Klägerin ein Restrisiko verbleibt, erscheint eine quotale Schadensbeteiligung des Beklagten in Höhe von 20 % an den nicht von den Kaskoversicherungen abgedeckten Schäden angemessen, aber auch ausreichend.
Aus den genannten Gründen war der Beklagte neben den bereits anerkannten 1.250,00 EUR zur Zahlung von weiteren 1.635,00 EUR zu verurteilen. Dieser Betrag entspricht einer 20%-igen Beteiligungsquote an den Bergungskosten sowie den Restwertkosten des Aufliegers.
c) Die Maluszahlung für 2010 sowie der Höherstufungsschaden für 2011 waren nach dem Vorbringen der Klägerin in der Berufungsverhandlung nach wie vor noch nicht fällig. Angesichts dessen wird diese Schadensposition, wie vom Arbeitsgericht zutref-
- 13 -
fend festgestellt, vom Feststellungsantrag erfasst. Unter Berücksichtigung der quotalen Schadensbeteiligung von 20 % ergibt sich die ausgeurteilte Schadensbegrenzung auf insgesamt 5.200,00 EUR. Das entspricht einem Betrag von 4 Monatsgehältern. Das weitergehende Schadensersatzbegehren der Klägerin aus Anlass des Verkehrsunfalls vom 20. Juli 2011 war zurückzuweisen.
7. Nach alledem war das erstinstanzliche Urteil aufgrund der Berufung des Beklagten in dem oben dargelegten Umfang abzuändern. Die weitergehende Berufung war zurückzuweisen.
Die Kostenentscheidung folgt aus §§ 97, 92 ZPO und entspricht dem Verhältnis von Obsiegen und Unterliegen.
Die Voraussetzungen des § 72 Abs. 2 ArbGG liegen nicht vor, so dass die Revision nicht zuzulassen war. Vorliegend handelt es sich ausschließlich um eine Einzelfallentscheidung.
gez. ... gez. ... gez. ...
Weitere Auskünfte erteilen Ihnen gern:
 |
Dr. Martin Hensche Rechtsanwalt Fachanwalt für Arbeitsrecht Kontakt: 030 / 26 39 620 hensche@hensche.de |
 |
Christoph Hildebrandt Rechtsanwalt Fachanwalt für Arbeitsrecht Kontakt: 030 / 26 39 620 hildebrandt@hensche.de |
 |
Nina Wesemann Rechtsanwältin Fachanwältin für Arbeitsrecht Kontakt: 040 / 69 20 68 04 wesemann@hensche.de |