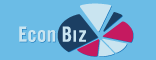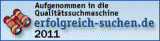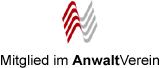- -> zur Mobil-Ansicht
- Arbeitsrecht aktuell
- Tipps und Tricks
- Handbuch Arbeitsrecht
- Gesetze zum Arbeitsrecht
- Urteile zum Arbeitsrecht
- Urteile 2023
- Urteile 2021
- Urteile 2020
- Urteile 2019
- Urteile 2018
- Urteile 2017
- Urteile 2016
- Urteile 2015
- Urteile 2014
- Urteile 2013
- Urteile 2012
- Urteile 2011
- Urteile 2010
- Urteile 2009
- Urteile 2008
- Urteile 2007
- Urteile 2006
- Urteile 2005
- Urteile 2004
- Urteile 2003
- Urteile 2002
- Urteile 2001
- Urteile 2000
- Urteile 1999
- Urteile 1998
- Urteile 1997
- Urteile 1996
- Urteile 1995
- Urteile 1994
- Urteile 1993
- Urteile 1992
- Urteile 1991
- Urteile bis 1990
- Arbeitsrecht Muster
- Videos
- Impressum-Generator
- Webinare zum Arbeitsrecht
-
Kanzlei Berlin
 030 - 26 39 62 0
030 - 26 39 62 0
 berlin@hensche.de
berlin@hensche.de
AnfahrtDetails -
Kanzlei Frankfurt
 069 - 71 03 30 04
069 - 71 03 30 04
 frankfurt@hensche.de
frankfurt@hensche.de
AnfahrtDetails -
Kanzlei Hamburg
 040 - 69 20 68 04
040 - 69 20 68 04
 hamburg@hensche.de
hamburg@hensche.de
AnfahrtDetails -
Kanzlei Hannover
 0511 - 89 97 701
0511 - 89 97 701
 hannover@hensche.de
hannover@hensche.de
AnfahrtDetails -
Kanzlei Köln
 0221 - 70 90 718
0221 - 70 90 718
 koeln@hensche.de
koeln@hensche.de
AnfahrtDetails -
Kanzlei München
 089 - 21 56 88 63
089 - 21 56 88 63
 muenchen@hensche.de
muenchen@hensche.de
AnfahrtDetails -
Kanzlei Nürnberg
 0911 - 95 33 207
0911 - 95 33 207
 nuernberg@hensche.de
nuernberg@hensche.de
AnfahrtDetails -
Kanzlei Stuttgart
 0711 - 47 09 710
0711 - 47 09 710
 stuttgart@hensche.de
stuttgart@hensche.de
AnfahrtDetails
BAG, Urteil vom 25.11.2010, 2 AZR 323/09
| Schlagworte: | Kündigungsschutz, Kündigungsschutzprozess, Verwirkung | |
| Gericht: | Bundesarbeitsgericht | |
| Aktenzeichen: | 2 AZR 323/09 | |
| Typ: | Urteil | |
| Entscheidungsdatum: | 25.11.2010 | |
| Leitsätze: | ||
| Vorinstanzen: | Arbeitsgericht München, Urteil vom 18.09.2008, 23 Ca 6803/06 Landesarbeitsgericht München, Urteil vom 10.02.2009, 8 Sa 892/08 |
|
BUNDESARBEITSGERICHT
2 AZR 323/09
8 Sa 892/08
Landesarbeitsgericht
München
Im Namen des Volkes!
Verkündet am
25. November 2010
URTEIL
Schmidt, Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle
In Sachen
Kläger, Berufungsbeklagter und Revisionskläger,
pp.
Beklagte, Berufungsklägerin und Revisionsbeklagte,
hat der Zweite Senat des Bundesarbeitsgerichts aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 25. November 2010 durch den Vorsitzenden Richter am Bundesarbeitsgericht Kreft, den Richter am Bundesarbeitsgericht Schmitz-
- 2 -
Scholemann, die Richterin am Bundesarbeitsgericht Berger sowie die ehren-amtlichen Richter Dr. Bartz und Dr. Grimberg für Recht erkannt:
1. Auf die Revision des Klägers wird das Urteil des Landesarbeitsgerichts München vom 10. Februar 2009 - 8 Sa 892/08 - aufgehoben.
2. Die Sache wird zur neuen Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten der Revision, an das Landesarbeitsgericht zurückverwiesen.
Von Rechts wegen!
Tatbestand
Die Parteien streiten noch über die Wirksamkeit einer fristlosen, hilfsweise ordentlichen Kündigung und zweier Abmahnungen.
Der 1958 geborene Kläger war seit April 2000 bei der konzernangehörigen Beklagten als Leiter Rechnungswesen beschäftigt. Durch E-Mail vom April 2002 teilte er seinen Kollegen mit, für ihn werde Mitte des Jahres der Zeitpunkt seines Austritts kommen, „um plangemäß in die A Hauptverwaltung zurückzukehren“. Seit Anfang August 2002 war er auf eigenen Wunsch von der Arbeitsleistung freigestellt.
Mit Schreiben vom 28. November 2002 kündigte die Beklagte das Arbeitsverhältnis ordentlich zum 31. Dezember 2002. Dagegen erhob der Kläger am 19. Dezember 2002 Kündigungsschutzklage und begehrte seine Weiterbeschäftigung. Am 22. Januar 2003 erklärte die Beklagte die Kündigung „verbindlich für gegenstandlos“ und forderte den Kläger auf, die Arbeit bei ihr wieder aufzunehmen. Dieser erklärte mit Schreiben vom 24. Januar 2003, die einseitige „Zurücknahme“ der Kündigung sei nicht möglich. Ihm sei eine Überlegungsfrist von einer Woche einzuräumen, binnen derer er sich erklären werde. Eine Arbeitsaufnahme scheide aus tatsächlichen und rechtlichen Gründen aus. In Erfüllung seiner Verpflichtung aus § 11 KSchG habe er
- 3 -
zwischenzeitlich - unstreitig - ein anderweitiges - bis Juni 2008 währendes - Arbeitsverhältnis begründet.
Mit Schreiben vom 31. Januar und 10. Februar 2003 verlangte die Beklagte - jeweils unter Fristsetzung - der Kläger möge sich abschließend zur Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses erklären und ggf. die Arbeit bei ihr wieder aufnehmen. Das Schreiben vom 10. Februar 2003 verband sie mit einer Abmahnung. Da der Kläger hierauf nicht reagierte, mahnte sie ihn mit Schreiben vom 13. Februar 2003 erneut ab und setzte ihm eine Frist zur Arbeitsaufnahme bis zum 17. Februar 2003. Nachdem der Kläger wiederum nicht zur Arbeit erschienen war, kündigte sie das Arbeitsverhältnis mit Schreiben vom 25. Februar 2003 fristlos, hilfsweise fristgerecht zum 31. März 2003.
Am 11. März 2003 fand im Verfahren über die Kündigung vom 28. November 2002 die Güteverhandlung vor dem Arbeitsgericht statt. Im Sitzungsprotokoll heißt es: „Die Parteien erörtern den Sach- und Streitstand“ und im Anschluss daran: „Im Einverständnis mit den Parteien verkündet der Vorsitzende folgenden Beschluss: Neuer Termin wird auf Antrag einer Partei bestimmt“.
Nach Terminsende, aber noch am selben Tag, ging beim Arbeitsgericht ein auf den 10. März 2003 datierter Schriftsatz des Klägers ein, mit dem dieser sich gegen die Kündigung vom 25. Februar 2003 und die beiden Abmahnungen wandte. Er bat um „förmliche Zustellung dieser Klageerweiterung“ und kündigte an, „im Termin der mündlichen Verhandlung“ die im Schriftsatz enthaltenen Anträge zu stellen. Der Schriftsatz wurde der Beklagten am 4. April 2003 gegen Empfangsbekenntnis zugestellt. Einen Termin hat das Arbeitsgericht nicht bestimmt. Mit Schriftsatz vom 21. Oktober 2003 regte die Beklagte an, beim Kläger anzufragen, ob er die Klage aufrecht erhalte. Das Arbeitsgericht sandte das Schreiben formlos an dessen Prozessbevollmächtigten. Eine Antwort blieb aus.
Mit Schriftsatz vom 14. März 2006 beantragte der Kläger, dem Verfahren Fortgang zu geben und Termin zur Kammerverhandlung anzuberaumen. Im Kammertermin vom 16. November 2006 erklärte die Beklagte die Kündigung
- 4 -
vom 28. November 2002 erneut „für gegenstandslos“. Der Kläger erklärte seine dagegen gerichtete Kündigungsschutzklage daraufhin „für erledigt“. Die Klage gegen die Kündigung vom 25. Februar 2003 hat er aufrechterhalten und geltend gemacht, die Kündigung sei rechtsunwirksam. Es fehle an Kündigungsgründen und an einer ordnungsgemäßen Anhörung des Betriebsrats. Die Abmahnungen seien unberechtigt. Er habe seine arbeitsvertraglichen Pflichten nicht verletzt.
Der Kläger hat - soweit noch von Bedeutung - beantragt
1. festzustellen, dass das Arbeitsverhältnis der Parteien durch die Kündigung vom 25. Februar 2003 nicht aufgelöst worden ist, sondern unverändert fortbesteht;
2. die Beklagte - hilfsweise für den Fall des Obsiegens - zu verurteilen, ihn zu unveränderten Bedingungen als Leiter Rechnungswesen weiterzubeschäftigen;
3. die Beklagte zu verurteilen, die Abmahnungen vom 10. Februar 2003 und vom 13. Februar 2003 aus der Personalakte zu entfernen.
Die Beklagte hat beantragt, die Klage abzuweisen. Sie hat die Auffassung vertreten, dem Kläger fehle die „Klagebefugnis“. Er habe den Kündigungsschutzprozess für die Dauer von etwas mehr als drei Jahren nicht betrieben. Dadurch habe er den Eindruck erweckt, er habe sich mit der Beendigung des Arbeitsverhältnisses abgefunden. Das gelte erst recht unter Beachtung seiner vorgerichtlichen Äußerungen. Außerdem habe er im Gütetermin erklärt, die Klage nach erfolgreicher Probezeit im neuen Arbeitsverhältnis zurücknehmen zu wollen. Nachdem eine Reaktion auf ihren Schriftsatz vom Oktober 2003 ausgeblieben sei, habe sie zum 31. Dezember 2003 Rückstellungen für einen möglichen Prozessverlust aufgelöst. Außerdem habe sie die früheren Aufgaben des Klägers mehrfach innerbetrieblich umverteilt, seine Position in zwei Stellen aufgespalten und nachbesetzt. Im Übrigen sei die Kündigung vom 25. Februar 2003 gerechtfertigt. Der Kläger habe sich nach „Rücknahme“ ihrer vorangegangenen Kündigung illoyal verhalten. Er habe sie pflichtwidrig über eine Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses im Unklaren gelassen.
- 5 -
Mit Urteil vom September 2008 hat das Arbeitsgericht der Klage stattgegeben. Das Landesarbeitsgericht hat die Klage abgewiesen. Mit der Revision begehrt der Kläger die Wiederherstellung des erstinstanzlichen Urteils.
Entscheidungsgründe
Die Revision ist begründet. Sie führt zur Aufhebung des Berufungsurteils (§ 562 Abs. 1 ZPO) und zur Zurückverweisung der Sache an das Landesarbeitsgericht (§ 563 Abs. 1 Satz 1 ZPO). Anders als dieses angenommen hat, hat der Kläger sein „Recht“, die Unwirksamkeit der Kündigung vom 25. Februar 2003 geltend zu machen, nicht verwirkt. Ob die Kündigung wirksam ist, steht noch nicht fest.
I. Die Klage ist im noch interessierenden Umfang ordnungsgemäß erhoben. Eine Klagerücknahme liegt nicht vor.
1. Die Klageerweiterung vom 10. März 2003 war wirksam. Der Schriftsatz ist der Beklagten förmlich gegen Empfangsbekenntnis zugestellt worden (§ 174 Abs. 1 ZPO). Ob dem im Hinblick auf § 251 ZPO iVm. § 249 Abs. 2 ZPO Hindernisse entgegen standen, kann dahinstehen. Die Beklagte hat einen solchen Mangel nicht gerügt; sie hat vielmehr die Zustellung gegen sich gelten lassen (§ 295 ZPO).
2. Die Rechtshängigkeit ist nicht durch Klagerücknahme (§ 269 ZPO) entfallen.
a) Die Klage gilt nicht nach § 54 Abs. 5 Satz 4 ArbGG iVm. § 269 Abs. 3 ZPO als zurückgenommen.
aa) Nach § 54 Abs. 5 Satz 4 ArbGG iVm. § 269 Abs. 3 ZPO wird die Klagerücknahme fingiert, wenn in der Güteverhandlung oder im Anschluss daran das Ruhen des Verfahrens angeordnet wurde, weil beide Parteien nicht erschienen
- 6 -
sind oder nicht „verhandelt“ haben, und wenn binnen sechs Monaten kein Terminsantrag gestellt wird.
bb) Die Parteien sind zum Gütetermin vom 11. März 2003 erschienen und haben im Sinne von § 54 Abs. 5 Satz 4 ArbGG verhandelt. Dafür reicht aus, dass eine dem Zweck der Güteverhandlung entsprechende Erörterung statt-gefunden hat (BAG 22. April 2009 - 3 AZB 97/08 - EzA ArbGG 1979 § 54 Nr. 3; zur Säumnis durch „Nichtverhandeln“ BAG 23. Januar 2007 - 9 AZR 492/06 - BAGE 121, 67). Das ist im Streitfall laut Sitzungsprotokoll geschehen. Eine analoge Anwendung von § 54 Abs. 5 ArbGG auf Fälle einer gezielten vorübergehenden Abstandnahme von der Weiterführung des Rechtsstreits kommt nicht in Betracht (BAG 22. April 2009 - 3 AZB 97/08 - aaO). Das betrifft nicht nur den Fall außergerichtlicher Vergleichsverhandlungen. Die Fiktion der Klagerücknahme wird auch nicht dadurch ausgelöst, dass zunächst die Entwicklung eines bestimmten Lebenssachverhalts, etwa der Verlauf eines neuen Arbeitsverhältnisses abgewartet werden soll (vgl. AnwK/Kloppenburg ArbGG 2. Aufl. § 54 Rn. 44; GMPM/Germelmann ArbGG 7. Aufl. § 54 Rn. 62; GK-ArbGG/Schütz Stand September 2010 § 54 Rn. 71; Schwab/Weth/Korinth ArbGG 3. Aufl. § 54 Rn. 42; aA BCF/Creutzfeldt ArbGG 5. Aufl. § 54 Rn. 17). Darum ging es hier. Ob sich die Wirkungen des § 54 Abs. 5 ArbGG auf eine erst nach dem Gütetermin erhobene Klageerweiterung erstrecken können, hinsichtlich derer das Verfahren nicht weiter betrieben wird, kann dahinstehen.
b) Soweit die Beklagte - nicht unwidersprochen - behauptet hat, der Kläger habe im Gütetermin in Aussicht gestellt, die Klage nach erfolgreicher Probezeit in seinem neuen Arbeitsverhältnis zurücknehmen, folgt daraus nichts anderes. Eine solche Aussage ist schon angesichts der Bedingungsfeindlichkeit der Klagerücknahme (vgl. BGH 19. Oktober 1988 - IVa ZR 234/87 - BGHR ZPO § 269 Abs. 1 Einwilligung Nr. 1) nicht geeignet, die Wirkungen des § 269 Abs. 3 ZPO auszulösen.
II. Der Kläger hat weder sein Klagerecht noch ein materielles „Recht“, sich auf die Unwirksamkeit der Kündigung zu berufen, verwirkt.
- 7 -
1. Die Verwirkung ist ein Sonderfall der unzulässigen Rechtsausübung (§ 242 BGB). Mit ihr wird ausgeschlossen, Rechte illoyal verspätet geltend zu machen (Senat 25. März 2004 - 2 AZR 295/03 - zu II 3 b der Gründe, AP MuSchG 1968 § 9 Nr. 36 = EzA MuSchG § 9 nF Nr. 40). Ein Recht darf nicht mehr ausgeübt werden, wenn seit der Möglichkeit, es in Anspruch zu nehmen, längere Zeit verstrichen ist (Zeitmoment) und besondere Umstände hinzutreten, die die verspätete Inanspruchnahme als Verstoß gegen Treu und Glauben erscheinen lassen (Umstandsmoment). Letzteres ist der Fall, wenn der Verpflichtete bei objektiver Betrachtung aus dem Verhalten des Berechtigten entnehmen durfte, dass dieser sein Recht nicht mehr geltend machen werde; der Berechtigte muss unter Umständen untätig geblieben sein, unter denen vernünftigerweise etwas zur Wahrung des Rechts unternommen zu werden pflegt (BVerfG 26. Januar 1972 - 2 BvR 255/67 - zu II 2 a der Gründe, BVerf-GE 32, 305). Ferner muss sich der Verpflichtete im Vertrauen auf das Verhalten des Berechtigten in seinen Vorkehrungen und Maßnahmen so eingerichtet haben, dass ihm durch die verspätete Durchsetzung des Rechts ein unzumutbarer Nachteil entstehen würde (BAG 10. Oktober 2007 - 7 AZR 487/06 - Rn. 19; 15. Februar 2007 - 8 AZR 431/06 - Rn. 42, BAGE 121, 289; 12. Dezember 2006 - 3 AZR 806/05 - Rn. 27, BAGE 120, 345).
2. Die Verwirkung beschränkt sich nicht auf materiell-rechtliche Rechtspositionen des Berechtigten. Auch die Möglichkeit zur gerichtlichen Klärung einer Rechtsposition ist eine eigenständige Befugnis, die verwirken kann (st. Rspr., Senat 2. November 1961 - 2 AZR 66/61 - BAGE 11, 353; 6. November 1997 - 2 AZR 162/97 - zu II 3 b der Gründe, AP BGB § 242 Verwirkung Nr. 45 = EzA BGB § 242 Prozessverwirkung Nr. 2; BAG 24. Mai 2006 - 7 AZR 365/05 - Rn. 20, EzAÜG AÜG § 10 Fiktion Nr. 114). Das gilt auch für die Befugnis zur Fortsetzung eines bereits rechtshängigen Verfahrens, das längere Zeit nicht betrieben wurde. In der Klageerhebung allein erschöpft sich das Recht zur gerichtlichen Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Kündigung nicht (BAG 26. März 1987 - 8 AZR 54/86 - zu II 1 der Gründe; BGH 22. September 1983 - IX ZR 90/82 - zu 2 c aa der Gründe, MDR 1984, 226).
- 8 -
3. Geht es um eine Verwirkung des Klagerechts, muss aus rechtsstaatlichen Gründen (Art. 19 Abs. 4 GG) darauf geachtet werden, dass durch die Annahme einer Verwirkung der Weg zu den Gerichten nicht in unzumutbarer, aus Sachgründen nicht mehr zu rechtfertigenden Weise erschwert wird. Im anhängigen Rechtsstreit kann der Verlust des Klagerechts nur in begrenzten Ausnahmefällen in Betracht kommen. Dies ist bei den Anforderungen an das Zeit- und Umstandsmoment zu berücksichtigen (BVerfG 26. Januar 1972 - 2 BvR 255/67 - zu II 2 b der Gründe, BVerfGE 32, 305; BAG 24. Mai 2006 - 7 AZR 365/05 - Rn. 20, EzAÜG AÜG § 10 Fiktion Nr. 114).
4. Ob ausgehend von diesen Grundsätzen im Streitfall eine „Prozessverwirkung“ in Rede steht oder die Verwirkung eines materiellen „Rechts“ des Klägers, sich auf die Unwirksamkeit der Kündigung zu berufen, bedarf keiner Entscheidung (offen gelassen für den Fall der verspätet erhobenen Kündigungsschutzklage Senat 28. Mai 1998 - 2 AZR 615/97 - zu II 4 a der Gründe mwN, BAGE 89, 48; vgl. auch BAG 21. August 2008 - 8 AZR 201/07 - AP BGB § 613a Nr. 353 = EzA BGB 2002 § 613a Nr. 95; KR/Rost 9. Aufl. § 7 KSchG Rn. 38 mwN). Die Beklagte kann sich unter keinem Gesichtspunkt auf Verwirkung berufen.
a) Der Kläger hat sein Klagerecht nicht durch Untätigkeit im Kündigungsschutzprozess verloren.
aa) Allerdings ist das erforderliche Zeitmoment erfüllt. Der Kläger hat seine Klageerweiterung unmittelbar im Anschluss an den Termin vom 11. März 2003 und im Bewusstsein der dortigen gerichtlichen Anordnungen eingereicht. Unter diesen Umständen musste sein Begehren dahin verstanden werden, dass die Terminlosstellung des Verfahrens - nach Zustellung - auf die mit der Klageerweiterung verfolgten Anträge ausgedehnt werden sollte. Jedenfalls musste der Kläger erkennen, dass das Arbeitsgericht sein Anliegen in diesem Sinn verstanden hat. Er hat folglich auch selbst das Verfahren drei Jahre nicht betrieben.
- 9 -
bb) Es fehlt jedoch an dem Umstandsmoment. Die Untätigkeit des Klägers war nicht geeignet, bei der Beklagten ein schutzwürdiges Vertrauen dahin-gehend zu begründen, er werde seine Kündigungsschutzklage nicht mehr verfolgen und habe sich mit der Beendigung des Arbeitsverhältnisses endgültig abgefunden.
(1) Der Arbeitgeber hat auch nach Klageerhebung ein anerkennenswertes Interesse an einer zügigen Entscheidung über die Wirksamkeit einer Kündigung. Dem trägt das Gesetz insbesondere durch die Verpflichtung der Gerichte zur besonderen Prozessförderung in Kündigungsverfahren (§ 61a ArbGG) Rechnung. Gleichwohl duldet das Prozessrecht einen längeren Schwebezustand, wenn es deshalb nicht zu einer gerichtlichen Entscheidung kommt, weil das Gericht auf Antrag oder im Einvernehmen mit den Parteien das Ruhen des Verfahrens anordnet (§ 251 ZPO) oder - was dem praktisch gleich steht - auf deren Wunsch zunächst keinen Verhandlungstermin anberaumt. Dem Interesse der Parteien, den Rechtsstreit nicht auf unabsehbare Zeit in der Schwebe zu belassen, ist dadurch Rechnung getragen, dass jede von ihnen die Möglichkeit hat, das Verfahren durch Terminsantrag wieder in Gang zu setzen und eine gerichtliche Entscheidung herbeizuführen. Wird ein solcher Antrag nicht gestellt, erlischt die Rechtshängigkeit auch dann nicht, wenn das Verfahren längere Zeit nicht betrieben wird. Eine Verjährung der Rechtshängigkeit ist dem geltenden Verfahrensrecht fremd (vgl. BGH 22. September 1983 - IX ZR 90/82 - zu 2 c aa der Gründe, MDR 1984, 226).
(2) Angesichts dieser Prozesslage hat der Arbeitgeber selbst bei langjährigem Verfahrensstillstand grundsätzlich keinen Anlass darauf zu vertrauen, nicht mehr gerichtlich auf die Feststellung der Unwirksamkeit der Kündigung in Anspruch genommen zu werden. Für eine Prozessverwirkung ist allenfalls in engen Grenzen Raum. Es müssen zur Untätigkeit des Arbeitnehmers besondere Umstände hinzutreten, die unzweifelhaft darauf hindeuten, er werde trotz der ihm eröffneten Möglichkeit einer ggf. späten Verfahrensaufnahme auf Dauer von der Durchführung des Rechtsstreits absehen. Daran fehlt es.
- 10 -
(a) Das Verhalten des Klägers vor dem Gütetermin ist kein solcher Umstand. Die gegenteilige Würdigung des Landesarbeitsgerichts nimmt nicht ausreichend auf die prozessuale Lage Bedacht.
Nach den Feststellungen des Landesarbeitsgerichts ist davon auszugehen, dass die Parteien seit Mitte des Jahres 2002 eine „Trennung“ zum Jahresende anstrebten. Allerdings hatten sie dabei ein einvernehmliches Ausscheiden des Klägers unter Rückkehr zur Konzern-Hauptverwaltung im Blick, worauf sie sich später ersichtlich nicht mehr verständigen konnten. Dies war offenbar der Grund dafür, dass die Beklagte eine Beendigung des Arbeitsverhältnisses durch die Kündigung vom 28. November 2002 anstrebte. Ob der Kläger seine Pflicht zur Rücksichtnahme (§ 241 Abs. 2 BGB) verletzt hat, als er sich zur „Kündigungsrücknahme“ und dem darin liegenden Angebot der Beklagten, das Arbeitsverhältnis einvernehmlich fortzusetzen, nicht äußerte, ist für die Frage der Verwirkung ohne Belang. Selbst wenn eine Erklärungspflicht des Klägers bestanden hätte, konnte die Beklagte seinem Schweigen - auch unter Berücksichtigung des mehrjährigen Nichtbetreibens des Kündigungsschutzprozesses - nicht entnehmen, er habe sich mit der Beendigung seines Arbeitsverhältnisses endgültig abgefunden. Dagegen spricht, dass er sich nach dem Ergebnis des Gütetermins die jederzeitige Aufnahme des Verfahrens vorbehalten hat. Selbst wenn es dem Kläger - wie die Beklagte meint - in erster Linie um das „Wie“ der Beendigung gegangen sein sollte, ändert dies nichts daran, dass er gerade nicht bereit war, sich mit seinem Ausscheiden aufgrund arbeitgeberseitiger Kündigung abzufinden. Das gilt erst recht für die weitere Kündigung vom 25. Februar 2003 und die ihr vorausgegangen Abmahnungen. Weshalb der Kläger von einer Verteidigung gegen diese hätte Abstand nehmen wollen, ist nicht ersichtlich.
(b) Es kann offen bleiben, ob der Kläger - was er bestreitet - im Gütetermin erklärt hat, er werde die Klage bei „Überstehen“ der Probezeit im neuen Arbeitsverhältnis zurücknehmen. Ebenso wenig kommt es darauf an, ob ihn das Schreiben der Beklagten vom 21. Oktober 2003 erreicht hat; der Kläger hat auch dies bestritten. Selbst wenn beides zugunsten der Beklagten unterstellt
- 11 -
wird, konnte die - weitere - Untätigkeit des Klägers bei ihr nicht die berechtigte Erwartung auslösen, er werde gegen die Kündigung(en) nicht weiter vorgehen. Das Schweigen des Klägers kann ebenso gut dahin verstanden werden, dass er den Kündigungsschutzprozess bewusst möglichst lange in der Schwebe halten wollte. Soweit dies den Interessen der Beklagten zuwider lief, hätte auch sie die Möglichkeit gehabt, dem Verfahren Fortgang zu geben.
cc) Die Beklagte hat zudem nicht dargetan, dass sie im Hinblick auf die Untätigkeit des Klägers Dispositionen getroffen hätte, aufgrund derer es ihr unzumutbar gewesen wäre, sich auf die Kündigungsschutzklage noch im Jahr 2006 einzulassen. Die Neubesetzung der Stelle des Klägers hatte sie bereits Mitte des Jahres 2002 in die Wege geleitet, ohne sich mit ihm zuvor über die Modalitäten einer Vertragsbeendigung rechtsverbindlich verständigt zu haben. Soweit die Beklagte sich darauf beruft, Ende des Jahres 2003 Rückstellungen zur Abdeckung der Prozessrisiken aufgelöst zu haben, geschah dies ersichtlich nicht erst mit Rücksicht auf den folgenden jahrelangen Verfahrensstillstand. Im Übrigen rechtfertigt das Fehlen von Rückstellungen nicht die Annahme, der Beklagten sei die Fortsetzung des Kündigungsrechtsstreits wegen möglicher Folgeansprüche wirtschaftlich unzumutbar (vgl. dazu BAG 10. Oktober 2007 - 7 AZR 487/06 - Rn. 29; 24. Mai 2006 - 7 AZR 365/05 - Rn. 37, EzAÜG AÜG § 10 Fiktion Nr. 114).
b) Die Voraussetzungen einer materiell-rechtlichen Verwirkung liegen nicht vor. Zwar können - vorbehaltlich der Umstände des Einzelfalls - materielle Ansprüche und Rechte auch noch nach Rechtshängigkeit verwirken (Münch-KommBGB/Roth 5. Aufl. § 242 Rn. 300 mwN). Im Hinblick auf ein etwaiges materielles „Recht“ des Arbeitnehmers, sich auf die Unwirksamkeit einer Kündigung zu berufen, ist aber zu beachten, dass der Verwirkungstatbestand (§ 242 BGB) durch die Dreiwochenfrist konkretisiert wird (Senat 23. Februar 2010 - 2 AZR 659/08 - Rn. 16, AP SGB IX § 85 Nr. 8 = EzA SGB IX § 85 Nr. 6). Im Fall der Fristversäumnis gilt die Kündigung - vorbehaltlich der sich aus §§ 5, 6 KSchG ergebenden Einschränkungen - als wirksam (§ 7 KSchG). Hat dagegen der Arbeitnehmer fristgerecht Klage erhoben, ist während der Dauer des
- 12 -
Kündigungsschutzprozesses für eine Verwirkung des „Rechts“, die Unwirksamkeit der Kündigung geltend zu machen, grundsätzlich kein Raum. Jedenfalls stehen im Streitfall die gegen eine Prozessverwirkung sprechenden Gesichtspunkte auch der Annahme einer materiell-rechtlichen Verwirkung entgegen.
III. Das Berufungsurteil stellt sich nicht aus anderen Gründen als richtig dar (§ 561 ZPO). Der Senat vermag über die Wirksamkeit der Kündigung vom 25. Februar 2003 und der Abmahnungen nicht abschließend entscheiden. Das Landesarbeitsgericht hat - von seinem Standpunkt aus konsequent - nicht geprüft, ob ein wichtiger Grund iSv. § 626 BGB vorliegt oder die Kündigung nach § 1 KSchG sozial gerechtfertigt ist. Dementsprechend fehlt es an hinreichenden Feststellungen. Unabhängig davon hat der Kläger auch die ordnungsgemäße Anhörung des Betriebsrats gerügt, ohne dass dazu Feststellungen getroffen worden wären.
Kreft
Schmitz-Scholemann
Berger
Grimberg
Bartz
Weitere Auskünfte erteilen Ihnen gern:
 |
Dr. Martin Hensche Rechtsanwalt Fachanwalt für Arbeitsrecht Kontakt: 030 / 26 39 620 hensche@hensche.de |
 |
Christoph Hildebrandt Rechtsanwalt Fachanwalt für Arbeitsrecht Kontakt: 030 / 26 39 620 hildebrandt@hensche.de |
 |
Nina Wesemann Rechtsanwältin Fachanwältin für Arbeitsrecht Kontakt: 040 / 69 20 68 04 wesemann@hensche.de |