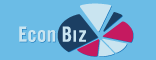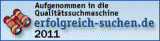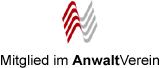- -> zur Mobil-Ansicht
- Arbeitsrecht aktuell
- Tipps und Tricks
- Handbuch Arbeitsrecht
- Gesetze zum Arbeitsrecht
- Urteile zum Arbeitsrecht
- Urteile 2023
- Urteile 2021
- Urteile 2020
- Urteile 2019
- Urteile 2018
- Urteile 2017
- Urteile 2016
- Urteile 2015
- Urteile 2014
- Urteile 2013
- Urteile 2012
- Urteile 2011
- Urteile 2010
- Urteile 2009
- Urteile 2008
- Urteile 2007
- Urteile 2006
- Urteile 2005
- Urteile 2004
- Urteile 2003
- Urteile 2002
- Urteile 2001
- Urteile 2000
- Urteile 1999
- Urteile 1998
- Urteile 1997
- Urteile 1996
- Urteile 1995
- Urteile 1994
- Urteile 1993
- Urteile 1992
- Urteile 1991
- Urteile bis 1990
- Arbeitsrecht Muster
- Videos
- Impressum-Generator
- Webinare zum Arbeitsrecht
-
Kanzlei Berlin
 030 - 26 39 62 0
030 - 26 39 62 0
 berlin@hensche.de
berlin@hensche.de
AnfahrtDetails -
Kanzlei Frankfurt
 069 - 71 03 30 04
069 - 71 03 30 04
 frankfurt@hensche.de
frankfurt@hensche.de
AnfahrtDetails -
Kanzlei Hamburg
 040 - 69 20 68 04
040 - 69 20 68 04
 hamburg@hensche.de
hamburg@hensche.de
AnfahrtDetails -
Kanzlei Hannover
 0511 - 89 97 701
0511 - 89 97 701
 hannover@hensche.de
hannover@hensche.de
AnfahrtDetails -
Kanzlei Köln
 0221 - 70 90 718
0221 - 70 90 718
 koeln@hensche.de
koeln@hensche.de
AnfahrtDetails -
Kanzlei München
 089 - 21 56 88 63
089 - 21 56 88 63
 muenchen@hensche.de
muenchen@hensche.de
AnfahrtDetails -
Kanzlei Nürnberg
 0911 - 95 33 207
0911 - 95 33 207
 nuernberg@hensche.de
nuernberg@hensche.de
AnfahrtDetails -
Kanzlei Stuttgart
 0711 - 47 09 710
0711 - 47 09 710
 stuttgart@hensche.de
stuttgart@hensche.de
AnfahrtDetails
BAG, Urteil vom 14.01.2009, 3 AZR 20/07
| Schlagworte: | AGG | |
| Gericht: | Bundesarbeitsgericht | |
| Aktenzeichen: | 3 AZR 20/07 | |
| Typ: | Urteil | |
| Entscheidungsdatum: | 14.01.2009 | |
| Leitsätze: | Eingetragene Lebenspartner sind in der betrieblichen Altersversorgung hinsichtlich der Hinterbliebenenversorgung Ehegatten gleichzustellen, soweit am 1. Januar 2005 zwischen dem Versorgungsberechtigten und dem Versorgungsschuldner noch ein Rechtsverhältnis bestand. |
|
| Vorinstanzen: | Arbeitsgericht Bonn, Landesarbeitsgericht Köln | |
BUNDESARBEITSGERICHT
3 AZR 20/07
7 Sa 139/06
Landesarbeitsgericht
Köln
Im Namen des Volkes!
Verkündet am
14. Januar 2009
URTEIL
Kaufhold, Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle
In Sachen
Kläger, Berufungskläger und Revisionskläger,
pp.
Beklagte, Berufungsbeklagte und Revisionsbeklagte,
hat der Dritte Senat des Bundesarbeitsgerichts aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 14. Januar 2009 durch den Vorsitzenden Richter am Bundesarbeitsgericht Dr. Reinecke, die Richter am Bundesarbeitsgericht Kremhelmer und Dr. Zwanziger sowie die ehrenamtlichen Richter Oberhofer und Stemmer für Recht erkannt:
- 2 -
1. Die Revision des Klägers gegen das Urteil des Landesarbeitsgerichts Köln vom 19. Juli 2006 - 7 Sa 139/06 - wird zurückgewiesen.
2. Der Kläger hat die Kosten des Revisionsverfahrens zu tragen.
Von Rechts wegen!
Tatbestand
Die Parteien streiten darüber, ob dem Kläger als eingetragenem Lebenspartner des früher bei der Beklagten beschäftigten Arbeitnehmers S eine Hinterbliebenenversorgung zusteht.
Der Kläger lebte seit dem Jahr 1977 mit Herrn S bis zu dessen Tod zusammen. Beide begründeten miteinander am 2. August 2001 eine eingetragene Lebenspartnerschaft. Herr S wurde am 1. Dezember 1947 geboren und verstarb am 25. August 2001. Er war vom 1. Januar 1973 bis 12. November 1999 bei der Beklagten beschäftigt. Der betrieblichen Altersversorgung bei der Beklagten lag schon während dieser Zeit der Versorgungstarifvertrag der Deutschen Welle zugrunde (hiernach: Versorgungstarifvertrag). Dessen § 13 sieht ua. vor:
„Witwen- und Witwerrente
(1) Der überlebende Ehegatte des Berechtigten erhält, wenn die Ehe bis zum Tode des Berechtigten bestanden hat, eine Witwen- oder Witwerrente, falls der Berechtigte im Zeitpunkt seines Todes Altersrente oder Rente wegen verminderter Erwerbsfähigkeit erhalten hat oder zu beanspruchen gehabt hätte.“
Der Kläger begehrt die Zahlung einer Witwerrente in unstreitiger Höhe von 197,29 Euro für die Zeit ab September 2001. Er hat die Auffassung vertreten, ihm stehe die im Tarifvertrag vorgesehene Witwerversorgung zu. Das
- 3 -
ergebe sich aus einer ergänzenden Auslegung des Versorgungstarifvertrages, jedenfalls aber aus Gleichbehandlungsgesichtspunkten unter Berücksichtigung europarechtlicher Vorgaben.
Der Kläger hat zuletzt sinngemäß beantragt,
die Beklagte zu verurteilen, an ihn für die Zeit ab September 2001, hilfsweise seit Januar 2005 Witwerrente iHv. 197,29 Euro monatlich zu zahlen.
Die Beklagte hat beantragt, die Klage abzuweisen. Sie hat die Auffassung vertreten, Ansprüche auf Hinterbliebenenversorgung hätte der Kläger nicht.
Das Arbeitsgericht hat die Klage abgewiesen. Die dagegen gerichtete Berufung hat das Landesarbeitsgericht zurückgewiesen. Mit der Revision verfolgt der Kläger seinen zuletzt gestellten Antrag weiter. Die Beklagte begehrt die Zurückweisung der Revision.
Entscheidungsgründe
Die Revision ist nicht begründet. Die Klage ist zulässig, der einheitlich zu verstehende Antrag aber unbegründet.
A. Gegen die Zulässigkeit der Klage bestehen keine durchgreifenden Bedenken: Der Kläger hat für die von ihm verlangten monatlichen Zahlungen keinen Fälligkeitstermin genannt, begehrt jedoch ersichtlich Zahlung nach Ablauf des Kalendermonats. Damit ist der Antrag bestimmt genug (§ 253 Abs. 2 Nr. 2 ZPO). Soweit sich danach die Klage auf künftige Zeiträume richtet, ist sie lediglich an den Eintritt eines Kalendertages geknüpft und nicht von einer Gegenleistung abhängig. Dies ist nach §§ 257, 258 ZPO zulässig. Aus dem Vortrag des Klägers ergibt sich, dass er künftige Leistungen begrenzt auf seine Lebensdauer verlangt.
- 4 -
B. Die Klage ist nicht begründet. Dabei ist entsprechend den Feststellungen des Landesarbeitsgerichts und mit den Parteien davon auszugehen, dass auf das Arbeitsverhältnis der Beklagten mit dem verstorbenen Lebenspartner des Klägers der Versorgungstarifvertrag anzuwenden war. Dem Kläger stehen die von ihm geltend gemachten Ansprüche dennoch nicht zu. Eine - ergänzende - Auslegung des Versorgungstarifvertrages zu seinen Gunsten kommt nicht in Betracht. Im vorliegenden Fall ergeben sich Ansprüche zudem weder aus dem AGG noch aus allgemeinen Grundsätzen der Gleichbehandlung. Weitergehende Ansprüche können auch nicht aus dem europäischen Recht abgeleitet werden.
I. Der Kläger kann sich nicht auf eine - ergänzende - Auslegung des Versorgungstarifvertrages stützen.
Nach § 13 des Versorgungstarifvertrages wird unter den dort genannten Voraussetzungen eine „Witwen- oder Witwerrente“ an den „überlebenden Ehegatten des Berechtigten“ gezahlt. Voraussetzung der Hinterbliebenenrente ist dabei nicht, dass der berechtigte Arbeitnehmer bei Eintritt seines Todes schon eine betriebliche Altersrente bezogen hat, vielmehr erfasst die Formulierung „zu beanspruchen gehabt hätte“ in § 13 Abs. 1 des Versorgungstarifvertrages auch Rentenanwartschaften. Dass der verstorbene Herr S vor seinem Tod bei der Beklagten ausgeschieden ist, steht dabei einem Anspruch nicht entgegen, da er bereits eine unverfallbare Versorgungsanwartschaft erworben hatte (§ 2 Abs. 1 und 5, § 30f BetrAVG). Darüber bestehen zwischen den Parteien auch keine unterschiedlichen Auffassungen. Die tarifliche Regelung nimmt jedoch hinsichtlich der Anspruchsvoraussetzungen auf die Ehe Bezug, nicht auf eine eingetragene Lebenspartnerschaft. Beide sind zu unterscheiden (vgl. BAG 29. April 2004 - 6 AZR 101/03 - zu 2 b der Gründe mwN, BAGE 110, 277).
Der Tarifvertrag ist auch nicht deshalb lückenhaft geworden und ergänzend auszulegen, weil während seiner Laufzeit mit Wirkung vom 1. August 2001 durch das Lebenspartnerschaftsgesetz (hiernach: LPartG) das Rechtsinstitut der eingetragenen Lebenspartnerschaft eingeführt wurde (Art. 1, 5 des
- 5 -
Gesetzes zur Beendigung der Diskriminierung gleichgeschlechtlicher Gemeinschaften: Lebenspartnerschaften vom 16. Februar 2001, BGBl. I S. 266). Eine ergänzende Tarifauslegung scheidet aus. Hier hatten die Tarifvertragsparteien nicht das Ziel, umfassend für den gesamten als Hinterbliebene in Betracht kommenden Personenkreis eine Hinterbliebenenversorgung sicherzustellen. Sie wollten erkennbar nur eine Vorschrift für die tatsächlich geregelten Fälle, ua. für den Fall der Ehe, schaffen (anders für den Ortszuschlag nach dem BAT: BAG 29. April 2004 - 6 AZR 101/03 - BAGE 110, 277).
II. Bei der hier vorliegenden Fallgestaltung folgt der Anspruch des Klägers auch nicht aus dem AGG.
1. Allerdings gebietet dieses Gesetz die Gleichstellung von Ehegatten und Partnern einer eingetragenen Lebenspartnerschaft hinsichtlich der Hinterbliebenenversorgung bei betrieblicher Altersversorgung.
a) § 2 Abs. 2 Satz 2 AGG steht nicht entgegen. Er enthält keine „Bereichsausnahme“ für die betriebliche Altersversorgung, sondern lediglich eine Kollisionsregel: Wenn und soweit das Betriebsrentengesetz bestimmte Unterscheidungen enthält, die einen Bezug zu den in § 1 AGG erwähnten Merkmalen haben, hat das AGG keinen Vorrang, sondern es verbleibt bei den Regelungen im Betriebsrentengesetz (BAG 11. Dezember 2007 - 3 AZR 249/06 - zu II 1 a der Gründe, AP AGG § 2 Nr. 1 = EzA AGG § 2 Nr. 1). Eine solche Fallgestaltung liegt hier nicht vor. „Hinterbliebene“ im Sinne des Betriebsrentengesetzes können jedenfalls solche Personen sein, die nach dem Recht der gesetzlichen Rentenversicherung als Berechtigte einer „Rente wegen Todes“ in Betracht kommen (vgl. BAG 18. November 2008 - 3 AZR 277/07 - zu B I 2 a der Gründe). Daher fallen eingetragene Lebenspartner schon deshalb unter den Hinterbliebenenbegriff, weil sie nach § 46 Abs. 4 SGB VI in der gesetzlichen Rentenversicherung Ehegatten gleichgestellt sind. Der Senat kann deshalb offenlassen, ob eine über das Recht der gesetzlichen Rentenversicherung hinausgehende Erweiterung des Kreises der Hinterbliebenen im Sinne des BetrAVG überhaupt in Betracht kommt (ebenso bereits BAG 18. November 2008 - 3 AZR 277/07 - aaO).
- 6 -
b) Eine europarechtskonforme Auslegung des AGG ergibt, dass eingetragenen Lebenspartnern in der betrieblichen Altersversorgung im selben Umfange wie Ehegatten eine Hinterbliebenenversorgung zusteht.
aa) Das AGG erging als Art. 1 des Gesetzes zur Umsetzung europäischer Richtlinien zur Verwirklichung des Grundsatzes der Gleichbehandlung (vom 14. August 2006, BGBl. I S. 1897). Entsprechend seinem Titel und nach dem Willen des historischen Gesetzgebers (BT-Drucks. 16/1780 S. 23) soll es der Umsetzung der EG-Richtlinien dienen, die die Gleichbehandlung regeln. Dazu gehört auch die Richtlinie 2000/78/EG des Rates vom 27. November 2000 zur Festlegung eines allgemeinen Rahmens für die Verwirklichung der Gleichbehandlung in Beschäftigung und Beruf (ABl. EG Nr. L 303 vom 2. Dezember 2000, S. 16; hiernach: Rahmenrichtlinie). Diese Richtlinie soll nach ihrem Art. 1 einen allgemeinen Rahmen zur Bekämpfung der Diskriminierung ua. wegen der sexuellen Ausrichtung bzw., wie es in § 1 AGG heißt, sexuellen Identität schaffen. Das AGG ist deshalb in Übereinstimmung mit der Richtlinie auszulegen. Das entspricht dem EG-rechtlichen Gebot der gemeinschaftskonformen Auslegung nationalen Rechts (vgl. dazu nur EuGH 5. Oktober 2004 - C-397/01 bis C-403/01 - [Pfeiffer ua.] Rn. 114, Slg. I 2004, 8835).
bb) Nach der Rahmenrichtlinie sind überlebende eingetragene Lebenspartner und überlebende Ehegatten dann gleichzubehandeln, wenn sie sich in einer vergleichbaren Situation befinden. Das ist auch für die Auslegung des AGG zugrunde zu legen. Eine Vorlage an den EuGH, den Großen Senat des BAG oder den Gemeinsamen Senat der obersten Gerichtshöfe des Bundes ist nicht erforderlich.
(1) Die insoweit auftretenden Rechtsfragen hat der Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften mit Urteil vom 1. April 2008 (- C-267/06 - [Maruko] AP Richtlinie 2000/78/EG Nr. 9 = EzA EG-Vertrag 1999 Richtlinie 2000/78 Nr. 4; hiernach: Maruko-Urteil) entschieden. Danach gilt:
Es liegt eine unmittelbare Diskriminierung wegen der sexuellen Ausrichtung iSv. Art. 2 Abs. 2 Buchst. a der Rahmenrichtlinie vor, wenn sich über-
- 7 -
lebende Ehegatten und überlebende Lebenspartner eines Arbeitnehmers in einer vergleichbaren Situation im Hinblick auf die Hinterbliebenenversorgung befinden, eingetragenen Lebenspartnern im Gegensatz zu Ehepartnern aber keine Hinterbliebenenversorgung zusteht. Maßgeblich für die Vergleichbarkeit ist dabei, ob die Lebenspartnerschaft nach nationalem Recht Personen gleichen Geschlechts in eine Situation versetzt, die in Bezug auf die Hinterbliebenenversorgung der Situation von Ehegatten vergleichbar ist (EuGH 1. April 2008 - C-267/06 - [Maruko] Rn. 72 f., aaO). Etwas anderes folgt auch nicht aus dem 22. Erwägungsgrund der Rahmenrichtlinie, wonach die Richtlinie die einzelstaatlichen Rechtsvorschriften über den Familienstand und davon abhängige Leistungen unberührt lässt. Insoweit soll nur klargestellt werden, dass die Richtlinie die Zuständigkeit der Mitgliedstaaten für familienrechtliche Regelungen nicht berührt, ohne jedoch Diskriminierungen zu ermöglichen, die von der Richtlinie verboten sind (EuGH 1. April 2008 - C-267/06 - [Maruko] Rn. 59, aaO).
Das ist auch für die Auslegung des AGG maßgeblich und vom Senat seiner Entscheidung zugrunde zu legen.
(2) Es bedarf weder einer Vorlage an den Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften nach Art. 234 EG noch einer solchen an den Großen Senat des Bundesarbeitsgerichts nach § 45 Abs. 2 ArbGG oder an den Gemeinsamen Senat der obersten Gerichtshöfe des Bundes nach § 2 Abs. 1 iVm. § 11 RsprEinhG.
Die EG-rechtlichen Fragen sind aufgrund des Maruko-Urteils eindeutig zu beantworten, eine Vorlage ist daher entbehrlich (vgl. EuGH 6. Oktober 1982 - C-283/81 - [Srl CILFIT] Slg. I 1982, 3415). Ebenso wenig bedarf es einer Vorlage an den Großen Senat des Bundesarbeitsgerichts oder an den Gemeinsamen Senat der obersten Gerichtshöfe des Bundes:
Allerdings hat der Sechste Senat des Bundesarbeitsgerichts (26. Oktober 2006 - 6 AZR 307/06 - zu II 5 e der Gründe, AP BGB § 611 Kirchendienst Nr. 49 = EzA BGB 2002 § 611 Kirchliche Arbeitnehmer Nr. 9, insoweit nicht abgedruckt in BAGE 120, 55) angenommen, die Rahmenricht-
- 8 -
linie sei so auszulegen, dass eine Anknüpfung von Leistungen an die unterschiedlichen Familienstände Ehe und eingetragene Lebenspartnerschaft dem nicht entgegenstehe. Dies werde durch die Begründungserwägung in Nr. 22 klargestellt. Ferner haben sowohl der Vierte Zivilsenat des Bundesgerichtshofs (14. Februar 2007 - IV ZR 267/04 - zu II 3 b bb der Gründe, NJW-RR 2007, 1441) als auch der Sechste Senat des Bundesverwaltungsgerichts mit Urteil vom 25. Juli 2007 (- 6 C 27.06 - zu 1 b dd (2) der Gründe, BVerwGE 129, 129) angenommen, bei einer derartigen unterschiedlichen Behandlung liege allen-falls eine mittelbare Benachteiligung im Sinne der Richtlinie vor. Es sei wegen eines typisierten geringeren Versorgungsbedarfs von überlebenden Lebenspartnern einer eingetragenen Lebenspartnerschaft gerechtfertigt, wenn Ehe-gatten und eingetragene Lebenspartner hinsichtlich der Hinterbliebenenversorgung unterschiedlich behandelt würden. Der BGH hat ferner angenommen, Erwägungsgrund 22 dieser Richtlinie bestätige diese Annahme, da eine Anknüpfung nicht an die sexuelle Orientierung, sondern an den Familienstand vorliege. In gleicher Weise hat das Bundesverwaltungsgericht mit Urteil vom 26. Januar 2006 (- 2 C 43.04 - BVerwGE 125, 79) den Erwägungsgrund aufgefasst.
Diese Entscheidungen sind jedoch vor dem klärenden Maruko-Urteil des EuGH vom 1. April 2008 ergangen, in dem das EG-Recht nunmehr anders ausgelegt wurde. Dadurch sind die Voraussetzungen einer Vorlage an den Großen Senat und an den Gemeinsamen Senat entfallen. Sowohl die Divergenzvorlage nach § 45 Abs. 2 ArbGG als auch die Vorlage an den Gemeinsamen Senat der obersten Gerichtshöfe des Bundes dient der „Wahrung der Einheitlichkeit der Rechtsprechung“ (so die Formulierung in Art. 95 Abs. 3 Satz 1 GG für den Gemeinsamen Senat). Dieser Zweck erfordert eine Anrufung des Großen Senats des Bundesarbeitsgerichts oder des Gemeinsamen Senats nicht, soweit der EuGH in seiner aus dem Vorlageverfahren nach Art. 234 EG folgenden Zuständigkeit europarechtliche Fragen geklärt hat. Die Einheitlichkeit der Rechtsprechung ist dann bereits durch die Entscheidung des EuGH gewährleistet.
- 9 -
Fragen nationalen Rechts, auch solche mit europarechtlichem Bezug, die eine Vorlegung erforderlich machen würden, stellen sich vorliegend nicht. Der Sechste Senat des Bundesarbeitsgerichts hat sich in seiner Entscheidung nicht mit der Auslegung des AGG befasst, weil es für den dort streitbefangenen Zeitraum noch nicht in Kraft getreten war (26. Oktober 2006 - 6 AZR 307/06 - zu II 5 c der Gründe, AP BGB § 611 Kirchendienst Nr. 49 = EzA BGB 2002 § 611 Kirchliche Arbeitnehmer Nr. 9, insoweit nicht abgedruckt in BAGE 120, 55). Der Vierte Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat in seinem Urteil (14. Februar 2007 - IV ZR 267/04 - zu II 3 b cc der Gründe, NJW-RR 2007, 1441) angenommen, das AGG gehe nicht über die Richtlinie hinaus. Das Bundesverwaltungsgericht ist in der genannten Entscheidung vom 25. Juli 2007 außerdem davon ausgegangen, es liege allenfalls eine sachlich gerechtfertigte mittelbare Benachteiligung iSv. § 3 Abs. 2 AGG vor, die gerechtfertigt sei (- 6 C 27/06 - zu 1 b cc (2) (2.2) der Gründe, BVerwGE 129, 129). Weder der Bundesgerichtshof noch das Bundesverwaltungsgericht haben einen Rechtssatz dahingehend aufgestellt, dass das AGG nicht europarechtskonform im Sinne der Rahmenrichtlinie auszulegen ist; sie haben vielmehr diese Richtlinie herangezogen und das AGG und die Richtlinie gleichgerichtet ausgelegt.
Mit Urteil vom 15. November 2007 (- 2 C 33/06 - zu 1 c der Gründe, NJW 2008, 868) hat das Bundesverwaltungsgericht zwar Ausführungen zum AGG gemacht, sich jedoch auf die Regelung des § 24 AGG gestützt. Nach dieser Vorschrift gilt das Gesetz ua. für Beamte nur „unter Berücksichtigung ihrer besonderen Rechtsstellung“ und nur „entsprechend“. Das Bundesverwaltungsgericht hat angenommen, das Bundesbesoldungsgesetz gehe dem AGG vor. Eine Aussage zum Arbeitsrecht ist damit nicht getroffen.
cc) Hinterbliebene Lebenspartner eines Arbeitnehmers befinden sich nach deutschem Recht in Bezug auf die Hinterbliebenenversorgung in einer Situation, die mit der Situation von hinterbliebenen Ehegatten eines Arbeitnehmers vergleichbar ist. Ihr Ausschluss von der Hinterbliebenenversorgung stellt des-halb im Rahmen der betrieblichen Altersversorgung eine unmittelbare Benachteiligung des Versorgungsberechtigten wegen der sexuellen Identität (§§ 1,
- 10 -
3 Abs. 1 Satz 1 AGG) dar, wenn - wie hier - dem überlebenden Ehegatten eines Versorgungsberechtigten eine Hinterbliebenenversorgung zugesagt ist.
(1) Eine Vergleichbarkeit der Hinterbliebenenversorgung von Ehegatten und eingetragenen Lebenspartnern scheidet nicht bereits deshalb aus, weil nach Art. 6 Abs. 1 GG die Ehe unter dem besonderen Schutz der staatlichen Ordnung steht.
Diese Verfassungsnorm verwehrt es zwar dem Gesetzgeber, andere Lebensformen gegenüber der Ehe zu begünstigen, enthält jedoch keine Verpflichtung, andere Lebensformen gegenüber der Ehe zu benachteiligen. Es besteht kein „Abstandsgebot“ zwischen der Ehe und anderen Lebensformen (BVerfG 17. Juli 2002 - 1 BvF 1/01, 1 BvF 2/01 - zu B II 1 c cc der Gründe, BVerfGE 105, 313). Damit ist es Sache des einfachen Gesetzgebers zu bestimmen, ob und inwieweit er zwischen der Ehe und der eingetragenen Lebenspartnerschaft eine vergleichbare Situation schafft.
Etwas anderes ergibt sich auch nicht aus dem Nichtannahmebeschluss der Ersten Kammer des Zweiten Senats des Bundesverfassungsgerichts vom 20. September 2007 (- 2 BvR 855/06 - zu B II 1 b aa der Gründe, NJW 2008, 209). Auch danach „bleibt es“ dann, „wenn die Verfassung selbst eine Unterscheidung vornimmt“, „Sache des Gesetzgebers, wie er diese Unterscheidung handhabt“. Dass in dem Nichtannahmebeschluss von einem „Differenzierungsgebot“ die Rede ist, drückt hinsichtlich der Regelungszuständigkeit des einfachen Gesetzgebers nichts anderes aus.
(2) Der einfache Gesetzgeber hat für Arbeitsverhältnisse hinsichtlich der Hinterbliebenenversorgung eine vergleichbare Lage zwischen Ehegatten und eingetragenen Lebenspartnern geschaffen.
Das geschah jedoch nicht bereits durch das LPartG in der ursprünglichen, am 1. August 2001 in Kraft getretenen Fassung. Allerdings sah bereits dieses Gesetz in § 5 eine Unterhaltspflicht für Lebenspartner untereinander vor und erklärte insoweit die für Eheleute geltenden Regelungen der §§ 1360a und 1360b BGB für entsprechend anwendbar. Das Gesetz hatte aber Fragen der
- 11 -
Altersversorgung für eingetragene Lebenspartner nicht zum Gegenstand. Insbesondere sah es für den Fall der Aufhebung der Lebenspartnerschaft, anders als das BGB bei der Ehescheidung (dazu §§ 1587 ff. BGB), keinen Versorgungsausgleich vor.
Das änderte sich jedoch durch das Gesetz zur Überarbeitung des Lebenspartnerschaftsrechts (vom 15. Dezember 2004, BGBl. I S. 3396; hiernach: Überarbeitungsgesetz), das nach seinem Art. 7 Abs. 1 am 1. Januar 2005 in Kraft trat. Mit dem Gesetz soll nach dem Willen des historischen Gesetzgebers „das Recht der Lebenspartnerschaft weitgehend an das Recht der Ehe an-geglichen werden“ (BT-Drucks. 15/3445). Im Bereich der Altersversorgung ist dieses Ziel, soweit es Arbeitnehmer betrifft, umfassend umgesetzt worden: Die Einführung von § 20 LPartG durch Art. 1 Überarbeitungsgesetz schuf die Voraussetzungen dafür, dass bei Aufhebung der Lebenspartnerschaft ein Versorgungsausgleich nach dem Modell, wie es auch für die Ehescheidung gilt, durchgeführt wird. Durch Art. 3 Überarbeitungsgesetz wurde das SGB VI entsprechend angepasst und § 46 Abs. 4 SGB VI in das Recht der gesetzlichen Rentenversicherung eingefügt. Danach gilt für den Anspruch auf Witwen- oder Witwerrente als Heirat auch die Begründung einer Lebenspartnerschaft und als Ehe auch eine Lebenspartnerschaft, als Witwe und Witwer auch ein überlebender Lebenspartner und als Ehegatte auch ein Lebenspartner. Nunmehr ist das bei Beschäftigung im Sinne des Sozialversicherungsrechts und damit „insbesondere in einem Arbeitsverhältnis“ (§ 7 Abs. 1 Satz 1 SGB IV) geltende Rentenrecht für Eheleute und eingetragene Lebenspartner übereinstimmend geregelt.
Eine Änderung des Betriebsrentengesetzes war zur Schaffung einer vergleichbaren Rechtslage bezogen auf Arbeitnehmer nicht erforderlich. Dieses Gesetz macht keine näheren Vorgaben für die Ausgestaltung von Versorgungszusagen; es sieht weder einen Anspruch auf betriebliche Altersversorgung noch einen solchen auf Hinterbliebenenversorgung vor.
(3) Diese vom Gesetzgeber geschaffene Vergleichbarkeit zwischen Ehe und eingetragener Lebenspartnerschaft ist für die Beurteilung betriebsrenten-
- 12 -
rechtlicher Regelungen zur Hinterbliebenenversorgung der maßgebliche An-knüpfungspunkt.
Leistungen der betrieblichen Altersversorgung sind in erster Linie Vergütung des berechtigten Arbeitnehmers, die er als Gegenleistung für die im Arbeitsverhältnis zurückgelegte Betriebszugehörigkeit erhält. Der Arbeitnehmer erwirbt für sich selbst und, falls zugesagt, zu Gunsten seiner Hinterbliebenen Versorgungsansprüche, die im Versorgungsfall zu erfüllen sind. Ob sich ein Arbeitnehmer hinsichtlich der Hinterbliebenenversorgung mit einem anderen Arbeitnehmer in einer vergleichbaren Lage befindet, ist danach zu beurteilen, ob eine unterschiedliche Vergütungshöhe gerechtfertigt ist, der Arbeitnehmer also eine Kürzung seines Arbeitsentgelts hinnehmen muss (vgl. BAG 5. September 1989 - 3 AZR 575/88 - zu II 1 b der Gründe, BAGE 62, 345; zustimmend BGH 20. September 2006 - IV ZR 304/04 - zu II 3 b der Gründe; BGHZ 169, 122). Maßgeblich ist dabei das Versorgungsinteresse des Arbeitnehmers, der die Betriebszugehörigkeit zurückgelegt und die Arbeitsleistung erbracht hat. Das knüpft an das Näheverhältnis zwischen dem Arbeitnehmer und den durch die Hinterbliebenenversorgung begünstigen Personen an. Dabei können sich zwar zu einer Differenzierung berechtigende Unterscheidungen auch aus einer unterschiedlichen gesetzlichen Ausgestaltung dieses Näheverhältnisses ergeben (vgl. BAG 18. November 2008 - 3 AZR 277/07 - zu B I 2 b der Gründe). Ist die gesetzliche Ausgestaltung - wie hier - jedoch gerade nicht unterschiedlich sondern vergleichbar, kann sie eine unterschiedliche Behandlung im Arbeits- und im daran anknüpfenden Versorgungsverhältnis nicht rechtfertigen.
Die Erste Kammer des Zweiten Senats des Bundesverfassungsgerichts hat in ihrem Nichtannahmebeschluss vom 6. Mai 2008 (- 2 BvR 1830/06 - zu III 2 b der Gründe, EzA EG-Vertrag 1999 Richtlinie 2000/78 Nr. 5) für das öffentliche Dienstrecht angenommen, für die Ausgestaltung der Beamtenbesoldung sei nicht die zivilrechtliche Situation zwischen den eingetragenen Lebenspartnern entscheidend. Diese Annahme ist für den vorliegenden Fall nicht einschlägig. Anders als im Arbeitsrecht gilt im Beamtenrecht das Alimentationsprinzip. Ebenso ist es unerheblich, dass nach Ansicht des
- 13 -
Bundesverwaltungsgerichts landesrechtlich geschaffene Versorgungseinrichtungen für Freiberufler nicht an die bundesrechtliche Regelung der Hinterbliebenenversorgung in der gesetzlichen Rentenversicherung anknüpfen müssen (dazu BVerwG 25. Juli 2007 - 6 C 27.06 - zu 1 b bb (3) der Gründe, BVerwGE 129, 129).
dd) Es bestehen auch keine tatsächlichen Unterschiede, die die Annahme rechtfertigen, die Situation sei nicht vergleichbar. Auch insoweit ergibt sich aus dem Nichtannahmebeschluss der Ersten Kammer des Zweiten Senats des Bundesverfassungsgerichts vom 6. Mai 2008 (- 2 BvR 1830/06 - zu III 2 b der Gründe, EzA EG-Vertrag 1999 Richtlinie 2000/78 Nr. 5) nichts anderes.
Der Beschluss geht für das Besoldungsrecht der Beamten davon aus, die dort vorgenommene Unterscheidung beim Verheiratetenzuschlag sei auch nach der Rahmenrichtlinie in der Auslegung durch das Maruko-Urteil des Europäischen Gerichtshofs vom 1. April 2008 gerechtfertigt. Das folge aus dem in der Lebenswirklichkeit anzutreffenden typischen Befund, dass in der Ehe ein Ehegatte namentlich wegen der Aufgabe der Kindererziehung und hierdurch bedingter Einschränkungen bei der eigenen Erwerbstätigkeit tatsächlich Unterhalt vom Ehegatten erhalte und so ein erweiterter Alimentationsbedarf entstehe. Der Gesetzgeber habe bei der eingetragenen Lebenspartnerschaft in der Lebenswirklichkeit keinen typischerweise bestehenden Lebensunterhaltsbedarf gesehen, der eine Gleichstellung nahelegen könnte.
Diese Ausführungen betreffen die Frage, inwieweit der Gesetzgeber in § 40 Abs. 1 Nr. 1 BBesG eine Unterscheidung zwischen verheirateten und in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft lebenden Beamten treffen durfte. Auch insofern ist zu berücksichtigen, dass es im Arbeitsverhältnis um eine Kürzung der Arbeitsvergütung geht, im vorliegenden Fall für den Arbeitnehmer, dem eine Hinterbliebenenversorgung zugesagt wurde. Das ist für die Berechtigung von Unterscheidungen von besonderer Bedeutung, wenn es - wie hier - um den Anwendungsbereich eines europäischen Verbots der unmittelbaren Diskriminierung geht (vgl. BAG 5. September 1989 - 3 AZR 575/88 - zu
- 14 -
II 1 c der Gründe, BAGE 62, 345). Die Berechtigung einer unterschiedlichen Behandlung ist vor dieser rechtlichen Ausgangssituation zu bewerten.
Dabei kann dahinstehen, ob und ggf. unter welchen Voraussetzungen in einer Versorgungsordnung ein typisierter unterschiedlicher Versorgungs-bedarf des Hinterbliebenen nicht nur als sachlicher Grund für eine Unterscheidung herangezogen werden kann, sondern möglicherweise darüber hinaus auch die Annahme einer nicht vergleichbaren Situation rechtfertigt. Jedenfalls müssen die maßgeblichen Regelungen an Unterscheidungen von Gewicht anknüpfen. Das schließt es aus, für die unterschiedliche Behandlung an Unterscheidungsmerkmale anzuknüpfen, die keinen unmittelbaren tatsächlichen Zusammenhang mit einem unterschiedlichen Versorgungsbedarf herstellen (vgl. BAG 26. September 2000 - 3 AZR 387/99 - EzA BetrAVG § 1 Hinterbliebenenversorgung Nr. 8: Haupternährerklausel). Dem wird die Unterscheidung zwischen eingetragener Lebenspartnerschaft einerseits und Ehe andererseits nicht gerecht, weil sich die Lebenssituationen innerhalb beider Gruppen zu unterschiedlich darstellen. Insbesondere ist es nicht ungewöhnlich, dass in einer Ehe keine Kinder erzogen werden oder dies nicht zu erheblichen Versorgungsnachteilen für einen Ehepartner führt. Andererseits ist Kindererziehung auch in eingetragenen Lebenspartnerschaften nicht ausgeschlossen, wovon bereits § 9 LPartG ausgeht.
ee) Ein anderes Ergebnis folgt auch nicht daraus, dass die hier streitbefangene Regelung durch Tarifvertrag getroffen wurde.
Das AGG verbietet eine unmittelbare Benachteiligung in kollektivrechtlichen Vereinbarungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 2 AGG) und damit auch in Tarifverträgen. Die Regelung des § 15 Abs. 3 AGG, nach der eine Entschädigungspflicht bei Anwendung kollektivrechtlicher Vereinbarungen unter bestimmten Voraussetzungen entfallen soll, ist hier nicht einschlägig. Es geht nicht um Entschädigung, sondern um Erfüllungsansprüche. Ebenso gilt die Rahmenrichtlinie, wie sich aus Art. 16 Buchst. b ergibt, auch für Tarifverträge. Das ist mit höherrangigem Recht vereinbar.
- 15 -
Die in Art. 9 Abs. 3 GG geschützte Koalitionsfreiheit ist nicht verletzt. Mit der Schaffung der eingetragenen Lebenspartnerschaft trägt der Gesetzgeber Art. 2 Abs. 1 und Art. 3 Abs. 1 GG Rechnung, indem er den Lebenspartnern zu einer besseren Entfaltung ihrer Persönlichkeit verhilft und Diskriminierungen abbaut (BVerfG 17. Juli 2002 - 1 BvF 1/01, 1 BvF 2/01 - zu B II 1 b bb der Gründe, BVerfGE 105, 313). Gleiches gilt für das aus dem AGG folgende Verbot der an die gleichgeschlechtliche Lebenspartnerschaft an-knüpfenden Diskriminierung. Damit liegt ein Gemeinwohlbelang vor, dem verfassungsrechtlicher Rang gebührt. Der daran geknüpfte Eingriff des Gesetzgebers ist auch verhältnismäßig: Eine weniger weit gehende Eingriffsmöglichkeit besteht nicht. Die Tarifvertragsparteien entscheiden, ob überhaupt eine Hinterbliebenenversorgung gewährt und wie diese der Höhe nach ausgestaltet wird. Dem betroffenen Personenkreis erwachsen dagegen bei der Ausgestaltung ihres Lebens erhebliche Vorteile (vgl. zu den Voraussetzungen eines Eingriffs in die Koalitionsfreiheit: BVerfG 3. April 2001 - 1 BvL 32/97 - zu B 1 und 3 der Gründe, BVerfGE 103, 293).
Das gilt auch vor dem Hintergrund des der Auslegung des AGG zugrunde liegenden Gemeinschaftsrechts. Auch die im EG-Primärrecht durch die Regelung in Art. 139 EG-Vertrag über den Dialog zwischen den Sozialpartnern (dazu EuGH 21. September 1999 - C-67/96 - [Albany] Slg. I 1999, 5751) und durch Art. 136 EG-Vertrag iVm. Art. 6 der Europäischen Sozialcharta und Nr. 11 - 14 der „Gemeinschaftscharta der Sozialen Grundrechte der Arbeitnehmer“ (vgl. dazu EuGH 11. Dezember 2007 - C-438/05 - [Viking] Rn. 43, AP EG Art. 43 Nr. 3 = EzA GG Art. 9 Arbeitskampf Nr. 141; 18. Dezember 2007 - C-341/05 - [Laval] Rn. 90, AP EG Art. 49 Nr. 15 = EzA GG Art. 9 Arbeitskampf Nr. 142) geschützte Tarifautonomie ist nicht verletzt.
Art. 13 EG überträgt der Gemeinschaft die Zuständigkeit, Diskriminierungen ua. wegen der sexuellen Ausrichtung „zu bekämpfen“ (vgl. EuGH 11. Juli 2006 - C-13/05 - [Navas] Rn. 55, Slg. I 2006, 6467). Damit wird deutlich, dass das Primärrecht der Gemeinschaft diese Diskriminierungen ablehnt. Die Europäische Sozialcharta erkennt an, dass alle Arbeitnehmer das Recht auf gerechte Arbeitsbedingungen haben (Teil I Nr. 2). Nach dem Vor-
- 16 -
spruch der Gemeinschaftscharta der Sozialen Grundrechte der Arbeitnehmer ist zur Wahrung der Gleichbehandlung „gegen Diskriminierungen jeglicher Art“ vorzugehen. Damit sind EG-rechtliche Maßnahmen zum Diskriminierungsschutz gerechtfertigt, solange die Tarifautonomie - wie hier - nicht unverhältnismäßig eingeschränkt wird.
ff) Zu Recht hält die Beklagte dem Kläger auch nicht ihren besonderen Rechtsstatus nach dem Gesetz über die Rundfunkanstalt des Bundesrechts „Deutsche Welle“ - Deutsche-Welle-Gesetz - (hiernach: DWG) vom 16. Dezember 1997 (BGBl. I S. 3094), zuletzt geändert durch Gesetz vom 15. Dezember 2004 (BGBl. I S. 3456), entgegen.
Nach § 1 Abs. 1 DWG ist die Beklagte eine Anstalt öffentlichen Rechts. Bedienen sich öffentliche Arbeitgeber - wie hier die Beklagte - arbeitsrechtlicher Regelungsmechanismen, führt dies dazu, dass die allgemein für alle Arbeitgeber geltenden arbeitsrechtlichen Grundsätze Anwendung finden (vgl. BAG 29. April 2004 - 6 AZR 101/03 - zu 4 b cc der Gründe, BAGE 110, 277).
Auch aus Gründen des Tendenzschutzes ergeben sich keine Besonderheiten. Nach § 4 DWG hat die Beklagte die Aufgabe, Deutschland als europäisch gewachsene Kulturnation und freiheitlich verfassten demokratischen Rechtsstaat verständlich zu machen sowie deutschen und anderen Sichtweisen zu wesentlichen Themen, vor allen Dingen der Politik, Kultur und Wirtschaft sowohl in Europa wie in anderen Kontinenten ein Forum zu geben mit dem Ziel, das Verständnis und den Austausch der Kulturen und der Völker zu fördern. Dabei fördert die Beklagte insbesondere die deutsche Sprache. Keines dieser Ziele wird gefährdet oder die Beklagte daran gemessen unglaubwürdig, wenn sie hinterbliebenen eingetragenen Lebenspartnern ihrer Arbeitnehmer eine Hinterbliebenenversorgung gewährt.
Der Senat hat nicht über die Frage entschieden, ob und ggf. welche Ansprüche gegenüber Religionsgemeinschaften und ihren Einrichtungen bestünden (vgl. zu dieser Problematik im Zusammenhang mit ergänzender Auslegung von kirchlichen Regelungen: BAG 26. Oktober 2006 - 6 AZR 307/06 - BAGE 120, 55).
- 17 -
c) Wenn danach - wie in der hier streitbefangenen Versorgungsordnung - eine nach dem AGG unerlaubte Benachteiligung vorliegt, hat der betroffene Arbeitnehmer einen Anspruch auf das vorenthaltene Arbeitsentgelt. Das folgt aus der Wertung in § 2 Abs. 1 Nr. 2 und § 8 Abs. 2 AGG (BT-Drucks. 16/1780 S. 25) und gilt auch für die Hinterbliebenenversorgung (BAG 11. Dezember 2007 - 3 AZR 249/06 - zu II 3 a der Gründe, AP AGG § 2 Nr. 1 = EzA AGG § 2 Nr. 1). Nach dem Rechtsgedanken des § 328 BGB kann diesen Anspruch auch der überlebende Hinterbliebene geltend machen (vgl. BAG 27. Juni 2006 - 3 AZR 352/05 (A) - zu B III 3 a der Gründe, BAGE 118, 340).
d) Obwohl somit überlebende eingetragene Lebenspartner nach dem AGG in gleichem Maße wie überlebende Ehegatten einen Anspruch auf Hinterbliebenenversorgung in der betrieblichen Altersversorgung haben, kann der Kläger daraus für sich nichts ableiten, da der vorliegende Fall nicht dem zeitlichen Anwendungsbereich des AGG unterfällt.
aa) Nach Art. 4 des „Gesetzes zur Umsetzung europäischer Richtlinien zur Verwirklichung des Grundsatzes der Gleichbehandlung“, das am 17. August 2006 verkündet wurde, trat das AGG am 18. August 2006 in Kraft. Übergangsbestimmungen finden sich in § 33 AGG.
Nach § 33 Abs. 1 AGG, der sich entgegen seinem Wortlaut nicht nur auf Benachteiligungen wegen des Geschlechts und sexuelle Belästigungen bezieht, ist das vor Inkrafttreten des AGG anzuwendende Recht auf Sachverhalte anzuwenden, die am 18. August 2006 bereits abgeschlossen waren. Neues Recht ist dagegen anzuwenden, wenn nach dem 17. August 2006 Tatsachen entstehen, die für die Benachteiligungsverbote des AGG erheblich sind. Maßgeblich ist die Benachteiligungshandlung. Das ist zwar in der Regel die zugrunde liegende Entscheidung des Arbeitgebers (vgl. BAG 16. September 2008 - 9 AZR 791/07 - zu A II 1 a aa der Gründe mwN). Der weitere Bestand eines Dauerschuldverhältnisses und die in ihm laufend ausgeübte Benachteiligung stellt aber ebenfalls eine die Benachteiligung begründende Tatsache dar. Sie löst daher die zeitliche Anwendbarkeit des AGG aus. Es geht nicht um eine einzelne, den Status des Arbeitnehmers betreffende, unerlaubt
- 18 -
benachteiligende Entscheidung, mit der die Diskriminierung bereits abgeschlossen ist. Der maßgebliche Vorgang ist bei Inkrafttreten des Gesetzes noch nicht abgeschlossen und kann nicht künstlich aufgeteilt werden (vgl. Suckow in Schleusener/Suckow/Voigt AGG 2. Aufl. § 33 Rn. 3).
Das wird durch die in § 33 Abs. 2 - 4 AGG geregelten Ausnahmetatbestände für den zivilrechtlichen Teil des AGG bestätigt, bei deren Vorliegen in weiterbestehenden Dauerschuldverhältnissen unter bestimmten Umständen noch das alte Recht Anwendung findet. Dieser Ausnahmen hätte es nicht bedurft, wenn nicht das Gesetz auf nach dem Inkrafttreten des AGG fort-bestehende Dauerschuldverhältnisse und dort fortgesetzte Benachteiligungen grundsätzlich anwendbar wäre.
bb) Gründe des Vertrauensschutzes stehen dem nicht entgegen. Es ist weder vorgetragen noch sonst ersichtlich, dass „das finanzielle Gleichgewicht des Systems“ der Altersversorgung bei der Beklagten durch „das Fehlen einer zeitlichen Beschränkung“ „rückwirkend erschüttert“ wird, wie es im Maruko-Urteil vom 1. April 2008 (- C-267/06 - [Maruko] Rn. 77 ff., AP Richtlinie 2000/78/EG Nr. 9 = EzA EG-Vertrag 1999 Richtlinie 2000/78 Nr. 4) formuliert ist. Danach ist es hier nicht geboten, Vertrauensschutz für Beschäftigungszeiten in Betracht zu ziehen, die vor Erlass des Maruko-Urteils liegen. Auch die verfassungsrechtlich geltenden Grundsätze des Vertrauensschutzes und der Verhältnismäßigkeit (dazu BVerfG 30. September 1987 - 2 BvR 933/82 - zu C II 4 der Gründe, BVerfGE 76, 256) verlangen nicht mehr (aA im Ergebnis Bauer/Arnold NJW 2008, 3377, 3380 ff.: Anwendung des AGG nur auf Beschäftigungszeiten seit seinem Inkrafttreten).
cc) Maßgeblich ist bei der Beurteilung der zeitlichen Anwendbarkeit des AGG auf das Dauerschuldverhältnis abzustellen, hinsichtlich dessen der persönliche Anwendungsbereich des Gesetzes eröffnet ist. Das AGG gilt nur für Beschäftigte (§ 6 Abs. 1 AGG), nicht für deren Hinterbliebene. Das ist europa-rechtlich nicht zu beanstanden (vgl. EuGH 23. September 2008 - C-427/06 - [Bartsch] Rn. 17, EzA EG-Vertrag 1999 Richtlinie 2000/78 Nr. 7). Zwar muss der durch die Rahmenrichtlinie geschützte Arbeitnehmer nicht selbst eines der
- 19 -
Merkmale aufweisen, hinsichtlich derer eine unerlaubte Benachteiligung ein-treten kann. Das ändert jedoch nichts daran, dass die Rahmenrichtlinie nur Diskriminierungen erfasst, denen der Arbeitnehmer ausgesetzt ist (vgl. EuGH 17. Juli 2008 - C-303/06 - [Coleman] EzA EG-Vertrag 1999 Richtlinie 2000/78 Nr. 6).
Die Anwendung des AGG setzt deshalb voraus, dass unter seinem zeitlichen Geltungsbereich noch ein Rechtsverhältnis zwischen dem Versorgungsberechtigten und dem Versorgungsschuldner bestand. Das ist hier nicht der Fall, da Herr S, der eingetragene Lebenspartner des Klägers und ehemalige Arbeitnehmer der Beklagten, bereits vor Inkrafttreten des AGG verstorben ist. Der Senat kann deshalb offen lassen, ob für den Anspruch auf Gleichbehandlung bei Inkrafttreten des Gesetzes ein Arbeitsverhältnis bestehen muss oder ob es ausreicht, wenn der Arbeitnehmer mit Betriebsrentenansprüchen bzw. unverfallbaren Anwartschaften ausgeschieden ist.
2. Auch nach dem allgemeinen Gleichheitssatz stehen dem Kläger keine Ansprüche zu.
Allerdings sind auch die Tarifvertragsparteien - zumindest aus der Schutzpflichtfunktion der Grundrechte - an den allgemeinen Gleichheitssatz (Art. 3 Abs. 1 GG) gebunden (vgl. BAG 27. Mai 2004 - 6 AZR 129/03 - zu B II und III der Gründe, BAGE 111, 8; 12. Dezember 2006 - 3 AZR 716/05 - zu II 1 a cc der Gründe, EzA BetrAVG § 1 Nr. 88). Der Inhalt der für die Tarifvertragsparteien deshalb nach deutschem Recht geltenden Pflicht zur Gleichbehandlung ist dabei, ebenso wie es für sonstige Rechtsgrundsätze gilt, europarechtskonform zu ermitteln (vgl. zur EG-rechtskonformen Auslegung nur: EuGH 5. Oktober 2004 - C-397/01 bis C-403/01 - [Pfeiffer ua.] Rn. 114, Slg. I 2004, 8835), und muss den Vorgaben der Rahmenrichtlinie entsprechen. Das gilt zumindest für Zeiten nach Ablauf der in der Rahmenrichtlinie vorgesehenen Umsetzungsfrist für das Merkmal „sexuelle Ausrichtung“ am 2. Dezember 2003 (Art. 18 Abs. 1 Rahmenrichtlinie). Entsprechend dem Schutzzweck der speziellen Diskriminierungsverbote führen Gleichheitsverstöße dazu, dass die ausgeschlossenen Arbeitnehmer dieselben Leistungen verlangen können wie
- 20 -
die Begünstigten (vgl. BAG 28. Mai 1996 - 3 AZR 752/95 - zu III 1 a der Gründe, AP TVG § 1 Tarifverträge: Metallindustrie Nr. 143 = EzA GG Art. 3 Nr. 55).
Damit gilt ab dem Inkrafttreten des Überarbeitungsgesetzes am 1. Januar 2005 dasselbe wie für den Zeitraum ab Inkrafttreten des AGG: Wegen der vom deutschen Gesetzgeber geschaffenen vergleichbaren Lage sind Eheleute und eingetragene Lebenspartner in der betrieblichen Altersversorgung hinsichtlich der Hinterbliebenenversorgung ab diesem Zeitpunkt gleichzubehandeln. Der Gesetzgeber hat für Zeiträume davor eingetragene Lebenspartnerschaften und Ehen hinsichtlich der Altersversorgung der Arbeitnehmer nicht gleichgestellt. Daher war deren Lage bis dahin nicht vergleichbar. Das ist verfassungsrechtlich nicht zu beanstanden. Art. 6 Abs. 1 GG, nach dem die Ehe unter dem besonderen Schutz der staatlichen Ordnung steht, berechtigt den Gesetzgeber, die Ehe gegenüber anderen Lebensformen herauszuheben und zu begünstigen. Die Verfassung selbst bildet mit Art. 6 Abs. 1 GG den sachlichen Grund für eine Differenzierung (BVerfG 17. Juli 2002 - 1 BvF 1/01, 1 BvF 2/01 - zu B II 1 c cc der Gründe, BVerfGE 105, 313; BVerwG 15. November 2007 - 2 C 33/06 - zu 2 a der Gründe, NJW 2008, 868; BFH 20. Juni 2007 - II R 56/05 - zu II 1 a der Gründe, BFHE 217, 183). An diese verfassungsgemäße Unterscheidung durften die Tarifvertragsparteien, denen nur eine gleichheits-und sachwidrige Außerachtlassung der Belange von Ehe und Familie verboten ist (BAG 30. Oktober 2008 - 6 AZR 712/07 - zu II 1 der Gründe), anknüpfen und von einer Gleichstellung für Personen, die vorher verstarben und deshalb nicht mehr in einem Rechtsverhältnis zum Arbeitgeber standen, absehen.
III. Weitergehende Ansprüche kann der Kläger auch nicht aus dem europäischen Recht unmittelbar ableiten, etwa deswegen weil es sich bei der Beklagten als Anstalt des öffentlichen Rechts um eine öffentliche Stelle der Bundesrepublik Deutschland als Mitgliedstaat der EG handelt (vgl. dazu BAG 3. April 2007 - 9 AZR 823/06 - zu II 5 der Gründe mwN, BAGE 122, 54). Nach dem Vorgesagten kann der Kläger aus der Rahmenrichtlinie für Zeiträume vor dem 1. Januar 2005 nichts herleiten. Weitergehende Ansprüche ergeben sich
- 21 -
auch nicht aus dem EG-Primärrecht. Auch danach kommt es für eine unmittelbare Diskriminierung darauf an, ob die betroffenen Personen sich in einer vergleichbaren Lage befinden (vgl. EuGH 9. Dezember 2004 - C-19/02 - [Hlozek] Rn. 44 mit umfassenden Nachweisen für Art. 141 EG, Slg. I 2004, 11491).
Reinecke
Kremhelmer
Zwanziger
Oberhofer
Stemmer
Weitere Auskünfte erteilen Ihnen gern:
 |
Dr. Martin Hensche Rechtsanwalt Fachanwalt für Arbeitsrecht Kontakt: 030 / 26 39 620 hensche@hensche.de |
 |
Christoph Hildebrandt Rechtsanwalt Fachanwalt für Arbeitsrecht Kontakt: 030 / 26 39 620 hildebrandt@hensche.de |
 |
Nina Wesemann Rechtsanwältin Fachanwältin für Arbeitsrecht Kontakt: 040 / 69 20 68 04 wesemann@hensche.de |