- -> zur Mobil-Ansicht
- Arbeitsrecht aktuell
- Arbeitsrecht 2023
- Arbeitsrecht 2022
- Arbeitsrecht 2021
- Arbeitsrecht 2020
- Arbeitsrecht 2019
- Arbeitsrecht 2018
- Arbeitsrecht 2017
- Arbeitsrecht 2016
- Arbeitsrecht 2015
- Arbeitsrecht 2014
- Arbeitsrecht 2013
- Arbeitsrecht 2012
- Arbeitsrecht 2011
- Arbeitsrecht 2010
- Arbeitsrecht 2009
- Arbeitsrecht 2008
- Arbeitsrecht 2007
- Arbeitsrecht 2006
- Arbeitsrecht 2005
- Arbeitsrecht 2004
- Arbeitsrecht 2003
- Arbeitsrecht 2002
- Arbeitsrecht 2001
- Tipps und Tricks
- Handbuch Arbeitsrecht
- Gesetze zum Arbeitsrecht
- Urteile zum Arbeitsrecht
- Arbeitsrecht Muster
- Videos
- Impressum-Generator
- Webinare zum Arbeitsrecht
-
Kanzlei Berlin
 030 - 26 39 62 0
030 - 26 39 62 0
 berlin@hensche.de
berlin@hensche.de
AnfahrtDetails -
Kanzlei Frankfurt
 069 - 71 03 30 04
069 - 71 03 30 04
 frankfurt@hensche.de
frankfurt@hensche.de
AnfahrtDetails -
Kanzlei Hamburg
 040 - 69 20 68 04
040 - 69 20 68 04
 hamburg@hensche.de
hamburg@hensche.de
AnfahrtDetails -
Kanzlei Hannover
 0511 - 89 97 701
0511 - 89 97 701
 hannover@hensche.de
hannover@hensche.de
AnfahrtDetails -
Kanzlei Köln
 0221 - 70 90 718
0221 - 70 90 718
 koeln@hensche.de
koeln@hensche.de
AnfahrtDetails -
Kanzlei München
 089 - 21 56 88 63
089 - 21 56 88 63
 muenchen@hensche.de
muenchen@hensche.de
AnfahrtDetails -
Kanzlei Nürnberg
 0911 - 95 33 207
0911 - 95 33 207
 nuernberg@hensche.de
nuernberg@hensche.de
AnfahrtDetails -
Kanzlei Stuttgart
 0711 - 47 09 710
0711 - 47 09 710
 stuttgart@hensche.de
stuttgart@hensche.de
AnfahrtDetails
Betriebsübergang und Ausschlussfristen
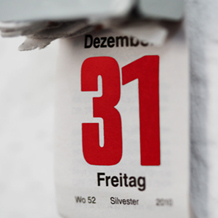 Ausschlussfristen sorgen auch bei einem Betriebsübergang für Stress
Ausschlussfristen sorgen auch bei einem Betriebsübergang für Stress
20.08.2013. Verkauft der Arbeitgeber seinen Betrieb oder einen Betriebsteil, tritt der Erwerber als neuer Arbeitgeber automatisch in die Rechte und Pflichten aus den bestehenden Arbeitsverhältnissen ein.
Diese gesetzliche Überleitung können die betroffenen Arbeitnehmer durch einen Widerspruch verhindern.
In manchen Fällen können solche Widersprüche noch recht lange nach dem Betriebsübergang erklärt werden. Dann werden die Arbeitsverhältnisse mit dem alten Arbeitgeber, dem Betriebsveräußerer, wieder rückwirkend aktiviert, d.h. sie bestehen infolge des Widerspruchs fort, als hätte es den zwischenzeitlichen Übergang auf den Erwerber niemals gegeben.
Fraglich ist, ob Ansprüche gegen den Betriebsveräußerer durch Ausschlussfristen bedroht sind, wenn es der Arbeitnehmer "versäumt" hat, seine Ansprüche bereits vor Erklärung seines Widerspruchs innerhalb der Ausschlussfrist gegenüber seinem alten Arbeitgeber einzufordern oder gar einzuklagen. Dazu hatte er ja während seiner Tätigkeit beim Erwerber, d.h. vor seinem Widerspruch, keinen Grund.
So sieht das auch das Bundesarbeitsgericht (BAG) in einer aktuellen Entscheidung so: BAG, Urteil vom 16.04.2013, 9 AZR 731/11.
- Welche Auwirkungen hat ein Widerspruch, den ein Arbeitnehmer nach einem Betriebsübergang erklärt, auf Ausschlussklauseln?
- Der Fall des BAG: Langjährig erkrankte Reinigungskraft verlangt nach wirksamer Kündigung Urlaubsabgeltung und wird an angeblichen Betriebserwerber verwiesen
- BAG: Tarifvertragliche Ausschlussfristen laufen im Falle eines Widerspruchs, den ein Arbeitnehmer bei einem Betriebsübergang erklärt, erst ab Zugang des Widerspruchs beim Betriebsveräußerer
Welche Auwirkungen hat ein Widerspruch, den ein Arbeitnehmer nach einem Betriebsübergang erklärt, auf Ausschlussklauseln? 
Gemäß § 613a Abs.1 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) hat ein Betriebsübergang zur Folge, dass der Betriebserwerber automatisch bzw. kraft Gesetzes Arbeitgeber der im Betrieb beschäftigten Arbeitnehmer wird. Dadurch wird der Bestand der Arbeitsverhältnisse gesichert.
Die Arbeitnehmer können sich gegen diese rechtliche "Vergünstigung" aber wehren, indem sie der Überleitung ihrer Arbeitsverhältnisse widersprechen. Sie bleiben dann Arbeitnehmer des Betriebsveräußerers, müssen dafür aber meist mit einer betriebsbedingten Kündigung rechnen, da ihr bisheriger Arbeitgeber aufgrund der Betriebsveräußerung keine Verwendung mehr für sie hat.
Bei einer korrekten Unterrichtung der Arbeitnehmer über die Hintergründe und die Folgen des Betriebsübergangs beträgt die Frist für den Widerspruch einen Monat nach Zugang der Unterrichtung (§ 613a Abs.6 BGB). Da viele Unterrichtungen aber unvollständig bzw. fehlerhaft sind, kommt es oft vor, dass das Widerspruchsrecht noch später ausgeübt werden kann, weil die Monatsfrist nach der Rechtsprechung nur gilt, wenn die Unterrichtung in Ordnung war.
Meist ist dann auch der Übergang schon vollzogen, d.h. die Arbeitnehmer war in der Zwischenzeit (= vor Erklärung ihres Widerspruchs) Arbeitnehmer des Erwerbers. Da der Widerspruch Rückwirkung hat, stehen sich die Arbeitnehmer aber infolge ihres Widerspruchs so, als wären ihre Arbeitsverhältnisse immer (= ohne Unterbrechung) beim alten Arbeitgeber verblieben.
An dieser Stelle kommen Ausschlussfristen ins Spiel, die in vielen Tarifverträgen und Arbeitsverträgen enthalten sind. Sie sehen vor, dass arbeitsvertragliche Ansprüche untergehen, wenn sie nicht innerhalb einer bestimmten Frist ab Fälligkeit (der Ausschlussfrist) in einer bestimmten Form (meist schriftlich) angemahnt werden.
Manche Ausschlussklauseln verlangen außerdem, dass der streitige Anspruch binnen einer weiteren Frist eingeklagt werden muss, wenn die Gegenseite den Anspruch ablehnt oder auf die Mahnung nicht reagiert. Dann gilt eine "zweistufige" Ausschlussfrist: Die erste Stufe ist die Mahnung, die zweite Stufe ist die Klage.
Fraglich ist, ab welchem Zeitpunkt solche Ausschlussfristen laufen,
- schon ab der Fälligkeit des Anspruchs
- oder erst ab Erklärung des Widerspruchs gegen den Übergang des Arbeitsverhältnisses auf den Betriebserwerber?
Für den frühen Fristbeginn spricht, dass der Widerspruch rechtlich auf den Zeitpunkt des Betriebsübergangs zurückwirkt. War der Arbeitnehmer aber demnach "immer schon" infolge seines Widerspruchs Vertragspartner des Betriebsveräußerers, hätte er ihm gegenüber Ausschlussfristen einhalten müssen. In diesem Sinne hat im August 2010 das Landesarbeitsgericht (LAG) München einmal entschieden (LAG München, Urteil vom 19.08.2010,4 Sa 311/10 - wir berichteten in Arbeitsrecht aktuell: 10/208 Ausschlussfrist läuft unabhängig vom Widerspruch).
Gegen einen solchen frühen Fristbeginn spricht aber, dass der Arbeitnehmer ja erst ab dem Zeitpunkt seines Widerspruchs wissen kann, dass sein Arbeitsverhältnis rückwirkend wieder auf den alten Arbeitgeber "umgehängt" wurde. Vor Erklärung des Widerspruchs hat der Arbeitnehmer keinen Grund, seinen alten Arbeitgeber anzumahnen.
Und erst recht hat er keinen Grund, ihn zu verklagen, denn eine Klage wäre vor Erklärung des Widerspruchs als unbegründet abzuweisen.
Der Fall des BAG: Langjährig erkrankte Reinigungskraft verlangt nach wirksamer Kündigung Urlaubsabgeltung und wird an angeblichen Betriebserwerber verwiesen 
Im Streitfall erkrankte eine seit 2005 beschäftigte Reinigungskraft im Jahr 2006 schwer und war in der Folge durchgehend arbeitsunfähig krank.
Zum 01.10.2009 verlor der Arbeitgeber, eine Reinigungsfirma, eine wichtigen Auftrag und sprach daher am 06.10.2009 eine betriebsbedingte Kündigung aus, die das Arbeitsverhältnisse zum 23.10.2009 beendete. Diese kurze Kündigungsfrist ergab sich aus dem allgemeinverbindlichen Rahmentarifvertrag für die gewerblichen Beschäftigten in der Gebäudereinigung vom 04.10.2003 (RTV).
Der RTV sieht auch eine zweistufige Ausschlussfrist vor. Danach müssen alle Ansprüche binnen zwei Monaten nach Fälligkeit schriftlich geltend gemacht und binnen zwei weiteren Monaten eingeklagt werden.
Der Arbeitnehmer verlangte mit anwaltlichem Schreiben vom 30.11.2009 Abgeltung des krankheitsbedingt nicht genommenen Urlaubs für die vergangenen Jahre, woraufhin sich der Arbeitgeber mit Schreiben vom 23.12.2009 auf einen angeblichen Betriebsübergang berief: Angeblich sei sein Auftragsnachfolger der richtige Ansprechpartner.
Der Anwalt des Arbeitnehmers widersprach postwendend dem Betriebsübergang und wiederholte seine Aufforderung, Urlaubsabgeltung zu zahlen. Klage auf Urlaubsabgeltung erhob er schließlich am 22.02.2010.
Das Arbeitsgericht Köln (Urteil vom 27.10.2010, 2 Ca 1492/10) und das LAG Köln wiesen die Klage ab (LAG Köln, Urteil vom 07.06.2011, 12 Sa 1530/10). Dabei meinte das LAG Köln im Anschluss an das LAG München (LAG München, Urteil vom 19.08.2010,4 Sa 311/10), der Kläger hätte die zweite Stufe der tariflichen Ausschlussfrist versäumt.
Denn mit dem am 02.12.2009 bei der Beklagten eingegangen Geltendmachungsschreiben vom 30.11.2010 hatte der Anwalt zwar die erste Stufe der zweistufigen Ausschlussfrist gewahrt, so das LAG. Da sich der Arbeitgeber hierzu nicht binnen zwei Wochen, also bis zum 16.12.2009, erklärt hatte, begann die zweite Stufe der Ausschlussfrist zu laufen, die am 16.02.2010 endete, so die Berechnung des LAG. Und da der Anwalt die Klage erst am 22.02.2010 eingereicht hatte, hatte er die zweite Stufe der Ausschlussfrist versäumt.
BAG: Tarifvertragliche Ausschlussfristen laufen im Falle eines Widerspruchs, den ein Arbeitnehmer bei einem Betriebsübergang erklärt, erst ab Zugang des Widerspruchs beim Betriebsveräußerer 
Das BAG hob die Urteile der Vorinstanzen auf und sprach dem Arbeitnehmer Urlaubsabgeltung von jeweils 20 Tagen für die Jahre 2008 und 2009 zu.
Denn nach Ansicht des BAG kann die zweite Stufe einer tariflichen Ausschlussfrist bei einem Betriebsübergang erst dann beginnen, wenn der Arbeitnehmer einen Widerspruch erklärt hat. Denn vor Erklärung des Widerspruchs ist der Betriebsveräußerer ja der falsche Beklagte, und eine unbegründete Klage zu erheben ist nicht im Sinne einer zweistufigen Ausschlussfrist.
Im vorliegenden Fall war allerdings sehr zweifelhaft, ob es überhaupt einen Betriebsübergang gab. Das ändert aber nichts am Ergebnis, denn auf das Nichtvorliegen eines Betriebsübergangs konnte sich der Arbeitgeber hier nach Treu und Glauben nicht berufen, nachdem er zunächst die gegenteilige Behauptung aufgestellt hatte.
Fazit: Obwohl sich das BAG hier nur zur zweiten Stufe einer tariflichen Ausschlussfrist geäußert hat, sind die Urteilsgründe auch auf die erste Stufe einer (tariflichen oder arbeitsvertraglichen) Ausschlussfrist übertragbar. Denn nicht nur Klagen, sondern auch "vorsorgliche" Mahnwellen gegenüber dem bisherigen Arbeitgeber sind sinn- und gegenstandslos, solange der Arbeitnehmer keinen Widerspruch erklärt hat.
Außerdem hat es der Betriebsveräußerer selbst in der Hand, durch eine korrekte Information der Arbeitnehmer über den Betriebsübergang die gesetzliche Monatsfrist für einen Widerspruch in Gang zu setzen. Dann weiß er nach Ablauf der Monatsfrist, mit welchen Arbeitnehmern er es künftig zu tun hat und mit welchen nicht.
Nähere Informationen finden Sie hier:
- Bundesarbeitsgericht, Urteil vom 16.04.2013, 9 AZR 731/11
- Landesarbeitsgericht Köln, Urteil vom 07.06.2011, 12 Sa 1530/10
- Landesarbeitsgericht München, Urteil vom 19.08.2010,4 Sa 311/10
- Handbuch Arbeitsrecht: Arbeitsvertrag und allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) - Ausschlussklausel
- Handbuch Arbeitsrecht: Ausschlussfrist
- Handbuch Arbeitsrecht: Betriebsübergang
- Handbuch Arbeitsrecht: Urlaub, Urlaubsanspruch
- Handbuch Arbeitsrecht: Urlaub und Krankheit
- Handbuch Arbeitsrecht: Urlaubsabgeltung
- Arbeitsrecht aktuell: 18/150 Hemmung einer arbeitsvertraglichen Ausschlussfrist durch Vergleichsverhandlungen
- Arbeitsrecht aktuell: 18/138 Beginn der Ausschlussfrist bei Schadensersatzforderungen
- Arbeitsrecht aktuell: 16/254 Neuregelung zur Schriftform bei Ausschlussfristen
- Arbeitsrecht aktuell: 11/196 Ausschlussklausel in AGB wirkt gegen Arbeitgeber, auch wenn die Frist zu kurz ist
- Arbeitsrecht aktuell: 11/117 Betriebsübergang: Fortsetzungsverlangen nach Betriebsübergang bei Verstoß gegen Unterrichtungspflicht
- Arbeitsrecht aktuell: 11/044 Kündigung bei Betriebsübergang ohne Hinweis auf die Widerspruchsfrist des Arbeitnehmers
- Arbeitsrecht aktuell: 10/208 Ausschlussfrist läuft unabhängig vom Widerspruch
Letzte Überarbeitung: 27. Juni 2018
Weitere Auskünfte erteilen Ihnen gern:
 |
Dr. Martin Hensche Rechtsanwalt Fachanwalt für Arbeitsrecht Kontakt: 030 / 26 39 620 hensche@hensche.de |
 |
Christoph Hildebrandt Rechtsanwalt Fachanwalt für Arbeitsrecht Kontakt: 030 / 26 39 620 hildebrandt@hensche.de |
 |
Nina Wesemann Rechtsanwältin Fachanwältin für Arbeitsrecht Kontakt: 040 / 69 20 68 04 wesemann@hensche.de |
Bewertung:
HINWEIS: Sämtliche Texte dieser Internetpräsenz mit Ausnahme der Gesetzestexte und Gerichtsentscheidungen sind urheberrechtlich geschützt. Urheber im Sinne des Gesetzes über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte (UrhG) ist Rechtsanwalt und Fachanwalt für Arbeitsrecht Dr. Martin Hensche, Lützowstraße 32, 10785 Berlin.
Wörtliche oder sinngemäße Zitate sind nur mit vorheriger schriftlicher Genehmigung des Urhebers bzw.
bei ausdrücklichem Hinweis auf die fremde Urheberschaft (Quellenangabe iSv. § 63 UrhG) rechtlich zulässig.
Verstöße hiergegen werden gerichtlich verfolgt.
© 1997 - 2024:
Rechtsanwalt Dr. Martin Hensche, Berlin
Fachanwalt für Arbeitsrecht
Lützowstraße 32, 10785 Berlin
Telefon: 030 - 26 39 62 0
Telefax: 030 - 26 39 62 499
E-mail: hensche@hensche.de



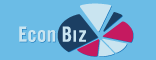

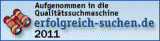

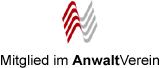





 Autorenprofil
Autorenprofil